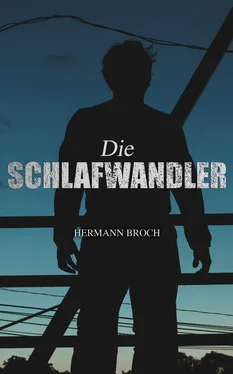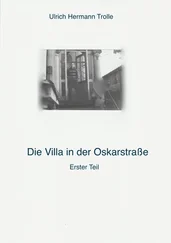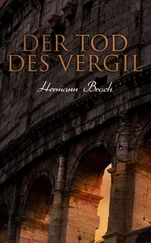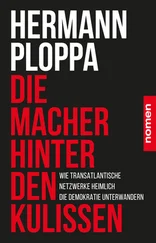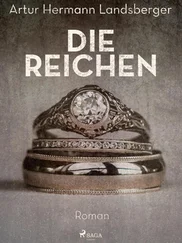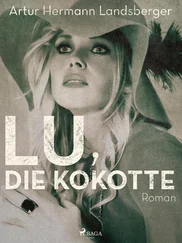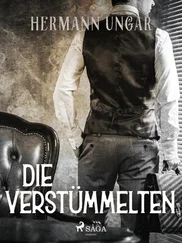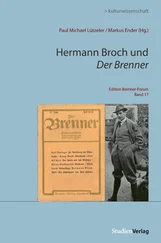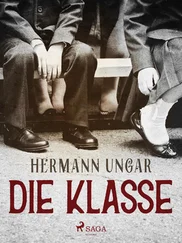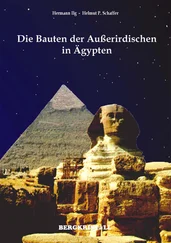Aber wenn er auch diese Gedanken als sinnlos beiseite schob und die Uniform als das Naturgegebene hinnahm, es steckte doch mehr dahinter als eine bloße Bekleidungsfrage, mehr als etwas, das seinem Leben zwar keinen Inhalt, wohl aber Haltung gab. Oft glaubte er die ganze Frage und auch Bertrand mit dem Wort: »Kameraden in des Königs Rock« abtun zu können, obzwar er weit davon entfernt war, damit eine außerordentliche Hochachtung vor dem Rock des Königs ausdrücken zu wollen oder einer besonderen Eitelkeit zu frönen, war er doch sogar darauf bedacht, daß seine Eleganz über eine genau eingehaltene vorschriftsmäßige Korrektheit nicht hinausginge oder von ihr abwiche, und er hörte es auch nicht ungern, als einmal im Kreise der Damen die begründete Ansicht ausgesprochen ward, daß des Uniformstückes hölzern langer Schnitt und die aufdringlichen Farben des bunten Tuches ihm schlecht genug zu Gesichte stünden, ja, daß ein braunsamtener Künstlerrock und ein loser Schlips ihn weit besser kleiden würden. Daß ihm trotzdem die Uniform weit mehr bedeutete, läßt sich teilweise durch die von der Mutter ererbte Beharrlichkeit erklären, die dem einmal Gewohnten unbewegt anzuhängen pflegte. Und manchmal schien es ihm selber, als dürfe es auch für ihn keine andere Haltung geben, obgleich er noch immer voller Groll gegen die Mutter war, welche sich damals den Bestimmungen Onkel Bernhards ohne Widerspruch untergeordnet hatte. Aber nun war es schon einmal geschehen, und wenn einer seit seinem zehnten Lebensjahrdarangewöhnt ist, eine Uniform zu tragen, dem ist das Kleid schon wie ein Nessushemd eingewachsen, und keiner, am allerwenigsten Joachim v.Pasenow, vermag dann noch anzugeben, wo die Grenze zwischen seinem Ich und der Uniform liegt. Und doch war es mehr als Gewohnheit. Denn wenn es auch nicht sein militärischer Beruf gewesen ist, der in ihn hineingewachsen war oder er in ihn, so war ihm die Uniform Symbol für mancherlei geworden; und er hatte sie im Laufe der Jahre mit so vielen Vorstellungen ausgefüttert und ausgepolstert, daß er, in ihr geborgen und abgeschlossen, sie nicht mehr hätte missen können, abgeschlossen gegen die Welt und gegen das Vaterhaus, in solcher Sicherheit und Geborgenheit sich bescheidend oder kaum mehr bemerkend, daß die Uniform ihm nur einen schmalen Streifen persönlicher und menschlicher Freiheit ließ, nicht breiter als der schmale Streifen der Stärkmanschette, den die Uniform den Offizieren gestattet. Er liebte es nicht, Zivil anzulegen, und es war ihm recht, daß ihn die Uniform von dem Besuche anrüchiger Lokale abhielt, in denen er den Zivilisten Bertrand in Begleitung lockerer Frauenzimmer vermutete. Denn oft überkam ihn unheimliche Angst, auch er könne in das unerklärliche Schicksal Bertrands hineingleiten. Deshalb verdachte er es auch seinem Vater, daß er ihn bei dem obligaten Bummel durch das Berliner Nachtleben, mit dem der Besuch in der Reichshauptstadt traditionsgemäß abgeschlossen wurde, begleiten und eben in Zivil begleiten mußte.
Als Joachim am nächsten Tage den Vater zur Bahn brachte, meinte dieser »Nun, wenn du jetzt Rittmeister wirst, werden wir wohl auch ans Heiraten denken müssen. Wie wäre es mit Elisabeth? Sind schließlich ein paar hundert Morgen, die die Baddensen in Lestow drüben haben, und das Mädel wird das Ganze einmal erben.« Joachim schwieg. Gestern hätte er ihm beinahe um fünfzig Mark ein Mädchen gekauft, und heute versucht er es mit einer legitimen Verbindung. Oder hatte der alte Mann vielleicht auch noch Gelüste auf Elisabeth wie auf das Mädchen, dessen Hand Joachim jetzt wieder im Nacken fühlte! Aber unvorstellbar war es, daß einer überhaupt wagen könnte, Elisabeth zu begehren, und noch weniger vorstellbar, daß jemand eine Heilige durch den eigenen Sohn vergewaltigen lassen wolle, weil er es selber nicht besorgen kann. Fast möchte er dem Vater den ungeheuerlichen Verdacht abbitten; freilich ist dem Alten alles zuzutrauen. Ja, man müßte alle Frauen der Welt vor diesem Greis schützen, denkt Joachim, während sie den Bahnsteig entlang gehen und auch noch, als er dem Zug salutierend nachblickt, denkt er dies. Doch als der Zug verschwunden war, denkt er an Ruzena.
Auch abends denkt er noch an Ruzena. Es gibt Frühlingsabende, deren Dämmerung viel länger währt, als es astronomisch vorgeschrieben ist. Dann senkt sich rauchiger, dünner Nebel über die Stadt und gibt ihr jene etwas gespannte Gedämpftheit des Feierabends, der einem Festtag vorangeht. Und es ist auch, als hätte sich das Licht in diesem gedämpften lichtgrauen Nebel so sehr verfangen, daß es immer noch helle Fäden in ihm gibt, wenn er auch schon schwarz und samtig geworden ist. So dauert diese Dämmerung sehr lange, so lange, daß die Inhaber der Geschäfte vergessen, die Läden zu schließen; plaudernd stehen sie mit den Kundinnen. vor der Tür, bis der Schutzmann vorbeikommt und sie auf die Überschreitung der Sperrstunde lächelnd aufmerksam macht. Auch dann blinkt noch Licht aus vielen Läden, denn rückwärts hinter dem Lokale sitzt die Familie beim Abendbrot; sie haben den Balken nicht wie sonst vor den Eingang gezogen, sondern bloß einen Stuhl davorgelegt, um zu zeigen, daß die Kunden nicht mehr bedient werden, und wenn sie fertig gegessen haben, werden sie herauskommen, werden ihre Stühle mitbringen und vor der Ladentüre ausruhen. Sie sind zu beneiden, die kleinen Geschäftsleute und Handwerker, die ihre Wohnung hinter dem Verkaufsraum haben, beneidenswert im Winter, wenn sie die schweren Balken vorlegen, um doppelt geschützt und warril. die lichte Stube zu besitzen, aus deren Glastür zur Weihnachtszeit der geschmückte Baum ins Geschäftslokal lächelt, beneidenswert an den milden Frühjahrs- und Herbstabenden, wenn sie, die Katze auf dem Schoße oder die kraulende Hand auf des Hundes weichem Nacken, vor ihrer Türe sitzen wie auf der Terrasse ihres Gartens.
Joachim, von der Kaserne kommend, geht durch die Vorstadtstraße. Es ist nicht standesgemäß, dies zu tun, und die Offiziere fahren sonst stets im Regimentswagen in ihre Wohnungen. Niemand geht hier spazieren, sogar Bertrand täte es nicht, und daß er nun selber hier geht, ist Joachim so unheimlich, als ob er irgend wo ins Gleiten geraten wäre. Aber ist es nicht fast so, als wollte er sich damit für Ruzena erniedrigen? Oder soll es gar eine Erniedrigung Ruzenas sein? Denn seine Vorstellung beheimatet sie nun ganz deutlich in einer Vorstadtwohnung, vielleicht sogar in jenem Kellerlokal, vor dessen dunklem Eingang Grünzeug und Gemüse zum Verkaufe liegt, während Ruzenas Mutter strickend davor hockt und die dunkle fremde Sprache redet. Er spürt den blakigen Geruch von Petroleumlampen. In dem geduckten Kellergewölbe blinkt ein Licht auf. Es ist eine Lampe, die hinten an der schmutzigen Mauer befestigt ist. Fast könnte er selbst mit Ruzena dort vor dem Gewölbe sitzen, ihre Hand kraulend auf seinem Nacken. Doch er erschrickt, als er sich dieses Bildes bewußt wird, und es wegzuzwingen, versucht er daran zu denken, wie über Lestow die gleiche lichtgraue Abenddämmerung ruht. Und in dem nebelstummen Park, der schon nach feuchtem Grase riecht, findet er Elisabeth; sie geht langsam zum Hause hin, aus dessen Fenstern die milden Petroleumlampen durch die steigende Dämmerung blinken, und auch ihr kleiner Hund ist bei ihr, als ob auch der schon müde wäre. Doch wie er näher und schärfer hindenkt, sieht er sich und Ruzena auf der Terrasse vor dem Hause, und Ruzena hat die Hand kraulend auf seinen Nacken gelegt.
Es verstand sich von selbst, daß man bei diesem schönen FrühlingsweHer in guter Stimmung war und daß die Geschäfte sich gut anließen. So dachte auch Bertrand, der sich seit einigen Tagen in Berlin aufhielt. Aber im Grunde wußte er, daß seine gute Laune doch bloß von den Erfolgen herrührte, die er nun schon seitJahrenbei allen seinen Aktionen hatte und daß er andererseits diese gute Laune brauchte, um Erfolg zu haben. Es war ein freundliches Gleiten, beinahe so, als müßte er sich nicht zu den Dingen hinbewegen, sondern als kämen sie entgegengeschwebt Vielleicht war auch dies einer der Gründe gewesen, um derentwillen er das Regiment verlassen hatte: so viele Dinge gab es, die ringsum sich anboten und von denen man damals ausgeschlossen war. Was sagten ihm einstens die Firmenschilder der Banken, der Rechtsanwälte, der Spediteure? es waren tote Worte, die man übersah oder von denen man gestört wurde. Jetzt wußte er vielerlei von den Banken, wußte, was hinter den Schaltern geschah, ja, er verstand nicht nur die Aufschriften der Schalter, Eskompte, Valuten, Giroverkehr, Wechselkassa, sondern er wußte auch, was in den Büros der Direktion vor sich ging, wußte eine Bank nach ihren Einlagen und ihren Reserven zu beurteilen, und ein Kurszettel gab ihm lebendigen Aufschluß. Er verstand Ausdrücke wie Transit und Zollfreilager bei den Spediteuren undalldies war sehr natürlich in sein Wesen eirigeflossen, ihm so selbstverständlich wie jene messingene Tafel am Steinweg in Harnburg »Eduard v. Bertrand, Baumwollimporte«. Und daß nunmehr eine ebensolche Tafel in der Rolandstraße in Bremen und beim Cotton Exchange in Liverpool zu sehen war, machte ihn geradezu stolz.
Читать дальше