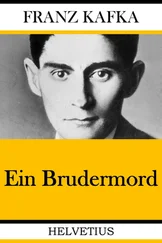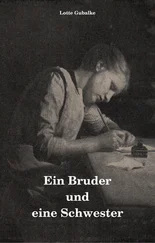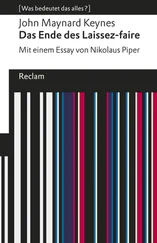Ich hatte noch niemals zuvor einen Toten gesehen, und jetzt lag da ein kleiner Junge vor mir – ein wenig älter als mein Bruder – ohne sich zu regen. Das war Josefli? War das nun dieser Josefli «selig», von dem die Grossmutter immer sprach? Ich wusste damals noch nicht, dass «selig» verstorben hiess.
Niemand sagte mir, was mit diesem Jungen hier los war. Ich wusste bis anhin gar nicht, dass Martha auch einen kleinen Bruder hatte. Sie hatte mir nie von ihm erzählt. Warum war er gestorben? War er auch im Spital gewesen? Ich getraute mich nicht, Fragen zu stellen, und niemand sprach mit mir darüber. Von nun an schlossen wir auch den kleinen Josefli ins Rosenkranzgebet mit ein.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Tod dieses kleinen Jungen in einer Verbindung zu meinem Bruder stand. Wenn mein Bruder auch sterben würde? Täuschte ich mich, spürte ich es, oder wurde es sogar laut ausgesprochen, dass es vielleicht doch besser wäre, wenn mein Bruder auch sterben könnte? Einmal erzählte meine Grosse Tante von einem jungen Mann, der als Kind auch sehr krank war. Seine Eltern bestürmten den lieben Gott so sehr, dass er ihn wieder gesund mache. Der Junge überlebte, kam jedoch später auf die schiefe Bahn und wurde zum Mörder der eigenen Mutter. Ich war verwirrt. Es hiess doch immer, wir sollten für unseren Bruder beten. War es nun plötzlich falsch, den lieben Gott eindringlich zu bitten, unseren kleinen Bruder wieder gesund zu machen?
Anfang Juni kam der lang ersehnte Bericht vom Kinderspital. Es gehe dem Bruder ausserordentlich gut. Die Tuberkulose sei zwar noch nicht ausgeheilt, der Bruder müsse noch in ein Sanatorium zur Kur. Die Grosse Tante brachte mich wieder zu meiner Familie zurück.
Mein kleiner Bruder war da, aber nur für wenige Tage. Er hatte grosse Freude, mich zu sehen und wollte mich packen und umarmen. Doch ich versuchte, ihm immer wieder zu entwischen. Ich hatte solche Angst, auch so krank zu werden wie er. Papa bemerkte meine Not und versicherte mir, dass mir die Krankheit des Bruders nichts mehr anhaben könne.
In all dieser Aufregung um meinen Bruder ging es Mama nicht gut, und sie musste wieder ins Spital. Wieder wurden wir aufgefordert, zu beten. Am Abend rief Papa an, um uns mitzuteilen, dass wir ein kleines Schwesterchen gekriegt hätten. Doch die Stimmung schien gedrückt. Später erfuhr ich, dass es eine sehr problematische Geburt war und es an ein Wunder grenzte, dass Mutter und Kind überlebt hatten.
Was war geschehen? Meine Mutter äusserte gegenüber dem Arzt die Befürchtung, dass es sich bei ihr wohl um einen «Plazentavorfall» handeln könnte, da das Kind nicht spontan auf die Welt kommen wollte. Bei ihrer Mutter war das jüngste Kind – ein Bübchen – aus diesem Grund im Mutterleib erstickt. Der Arzt ignorierte die Warnung der Mutter, packte mit der Zange zu und stach direkt in die Plazenta. Blut spritzte im grossen Bogen raus. «Und das ausgerechnet um die Mittagszeit, wenn es sonst schon so viel zu tun gibt,» dies waren die letzten Worte der Krankenschwester, an die sich die Mutter noch erinnern konnte, bevor sie das Bewusstsein verlor. Mutter und Kind waren in Gefahr. Plötzlich musste alles sehr schnell gehen. Der Arzt entschloss sich zu einem Kaiserschnitt. Es wurde sehr kritisch. Die Mutter hatte bereits viel Blut verloren und war sehr schwach. Sie brauchte viele Bluttransfusionen. Unsere ganze Verwandtschaft war an dieser Geburt mitbeteiligt, denn alle Erwachsenen wurden später zum Blutspenden aufgeboten, damit die Klinik ihre Blutkonserven wieder auffüllen konnte.
Von dieser schweren Geburt erholte sich unsere Mutter nie mehr richtig.
Und nun war Maria plötzlich wieder da. Die neue Stelle hatte ihr nicht gefallen. Im Winter musste sie frühmorgens bei jedem Wetter mit dem Fahrrad die Brote verteilen. Der ausbezahlte Lohn war auch nicht so hoch wie versprochen. Maria fühlte sich ausgenutzt und vermisste den «Familienanschluss», den sie bei uns sehr intensiv erlebt hatte. Sie fragte, ob sie wieder bei uns arbeiten dürfe. Maria kam wie gerufen, war sie doch in diesem Moment für die Mutter eine grosse Hilfe.
Ich kam nun in den Kindergarten. Die meisten Kinder waren bereits ein bis zwei Jahre dort, ich jedoch war neu in der Gruppe. Der Kindergarten wurde von Schwester Maria Leo, einer katholischen Nonne, geführt. Sie galt als eine sehr erfahrene Kindergärtnerin. Mehrere Generationen verschiedener Konfession besuchten bei ihr den Kindergarten. Sie konnte sich später noch an alle mit ihrem Namen erinnern. Der Kindergarten war im alten Casino untergebracht – einem ehrwürdigen Gebäude, welches früher einer ortsansässigen Aristokratenfamilie als Winterquartier diente.
Neben dem einfach gehaltenen Kindergartenraum lagen zwei barocke Ballsäle, wo gelegentlich noch gesellschaftliche Anlässe abgehalten wurden. Diese Räume waren für uns tabu. Schwester Maria Leo beheimatete in dem einen Raum den Sankt Nikolaus und im andern das Christkind. So standen wir das ganze Jahr unter himmlischer Beobachtung. Immer wieder hörten wir Flügel rascheln und wetteiferten untereinander, wer wohl schnell einen Blick auf das vorbeihuschende Christkind erhaschen oder die tiefe Stimme von Sankt Nikolaus vernehmen konnte. Während des ganzen Jahres waren wir bemüht, uns viele goldene Einträge und möglichst wenige schwarze Striche in Nikolaus’ grossem Buch zu verschaffen.
Im Advent dann kamen die hehren Gestalten leibhaftig – Sankt Nikolaus, begleitet von einem Tross von Engeln – bei uns zu Besuch, und dann wurde abgerechnet. Sankt Nikolaus mit seinem weissen langen Bart war zwar ein milder Mann, der uns glaubwürdig mit feuchten Augen vorspielen konnte, wie traurig ihn unsere Missetaten stimmten. Er war ein alter Freund meines Grossvaters, wie ich später erfuhr, und er war Sankt Nikolaus aus «Berufung». «Rutscht mir doch alle den Buckel runter», soll er seinen Kollegen einmal zugerufen haben, als sie ihn ärgerten, «in zwei Monaten bin ich wieder der Sankt Nikolaus und der glücklichste Mensch!»
Der Brief vom Kinderspital mit der Überweisung in die Kinderheilstätte stammt vom 1. Juni 1953. Am 19. Juni wurde unsere kleine Schwester geboren. Einige Tage später, am 27. Juni, war der Eintrittstermin für unseren Bruder ins Sanatorium. Wie haben die Eltern das alles nur geschafft? Ich vermute, dass wieder die Verwandtschaft da war und half.
Die Kinderheilstätte trug den sinnigen Namen «Heimeli». Wenn ich die Fotos von damals anschaue, sehe ich unsern kleinen Bruder in einer Blumenwiese sitzen, umringt von anderen Buben und Mädchen. «Unsere Kinder reden noch immer von ihm», schrieb Schwester Alice später. Ich habe sie nie kennengelernt, da auch hier nur unsere älteste Schwester zu Besuch durfte. Schwester Alice muss damals eine wichtige Bezugsperson für unsern Bruder gewesen sein. Auch später erkundigte sie sich immer wieder nach seinem Wohlbefinden und wie er sich zu Hause wieder eingelebt habe!
Der Bruder hatte während seiner Krankheit das Sprechen verlernt und musste wieder neu gehen lernen. Die ärztlichen Berichte aus der Heilstätte, welche alle drei Monate zu Hause eintrafen, wurden von uns voll Spannung erwartet und die Bemühungen um den kleinen Sohn vom Vater herzlichst verdankt, erfreut über seine guten Fortschritte und in der Hoffnung, dass er bald gesund und munter in die Familie zurückkehren könne.
Sept. 53
Die allgemeine Erholung ist ordentlich. Der Knabe ist ziemlich lebhaft und gut gelaunt. Eine Fortsetzung der Kur für weitere 3 Mt. ist unbedingt angezeigt.
Dez. 53
Die «geistige» Entwicklung ist befriedigend, er beginnt zu sprechen, allerdings noch undeutlich. Aufgrund des Röntgenbefundes und mit Rücksicht auf die durchgemachte Meningitis und die Jahreszeit ist die Fortsetzung der Kur unbedingt angezeigt. Wir haben um eine Kurbewilligung von weiteren 3 Monaten ersucht.
Читать дальше