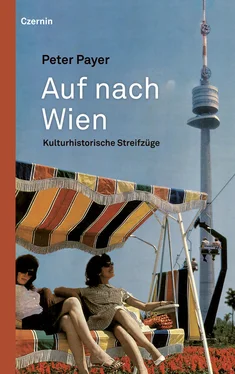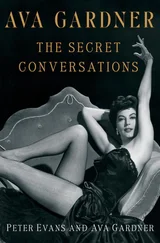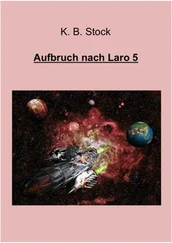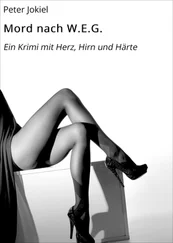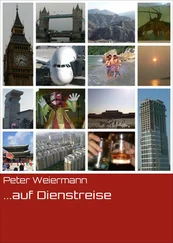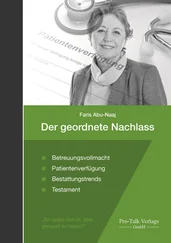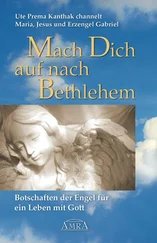Blumenschmuck am Schwarzenbergplatz, Foto: Martin Gerlach, um 1910
Auernheimer bezog sich hier auf die hohen Masten der elektrischen Bogenlampen, die aufgrund ihrer schneckenförmigen Ausleger »Bischofsstäbe« genannt wurden und an und für sich schon ästhetisch anspruchsvoll gestaltet waren. Sie hatten nun zusätzlich im unteren Bereich einen floralen Schmuck erhalten. Dieser war erstmals im November 1905 anlässlich des Besuchs des spanischen Königs Alfons XIII. an den Lampen der Ringstraße und am Schwarzenbergplatz angebracht worden. Da die Blumenkörbe auch bei den Wienern großen Anklang fanden, wurden sie beibehalten und in den folgenden Jahren beträchtlich vermehrt.
Wie sehr sie der Bevölkerung binnen kurzer Zeit ans Herz gewachsen waren, lässt sich daran erkennen, dass ihre Anbringung selbst nach den Verwüstungen des Ersten Weltkriegs eine ungebrochene Fortsetzung erfuhr. Voll Stolz vermeldete man im Städtewerk »Das Neue Wien«, dass die Blumenkörbe an den Lichtmasten nunmehr wieder gefüllt und vermehrt würden. Ihre Zahl sei im Jahr 1926 auf insgesamt 83 gestiegen. Hoffnungsfroh blickte das »Rote Wien« den neuen Zeiten entgegen. Die Stadt mit der »ewigen Schaulust« (Stefan Zweig) hatte im Straßenschmuck ihren unverwechselbaren Ausdruck gefunden.
Eine Tradition, die bis heute anhält. So kann man sich in der Währinger Straße vor dem Café Weimar nach wie vor an einem Bogenlampenmast aus der Gründerzeit in originaler Farbgebung samt Blumenkorb erfreuen, eine Privatinitiative des Cafetiers zum hundertjährigen Jubiläum seines Lokals. Und letztlich sind auch das in Mode gekommene »urban gardening« und die davon inspirierten blumengeschmückten Blechdosen an diversen Verkehrsmasten in diese Richtung zu interpretieren. Ein kleiner Stadtgarten in luftiger Höhe zur Freude und Repräsentation der Bevölkerung.

Bissspuren in der Durchfahrt zur Hofburg, Foto: Peter Payer, 2018
Den dritten und letzten, im wahrsten Sinne eindrucksvollsten Hinweis auf eine Wiener Begebenheit verdanke ich dem Kunsthistoriker und Denkmalexperten Andreas Lehne. In einem seiner Bücher beschreibt er ein Detail der Wiener Hofburg, an dem wohl nicht nur ich schon viele Male vorüberging, ohne es zu bemerken: Die Bissspuren der Hofpferde an einem Holzbalken in der Durchfahrtshalle des Leopoldinischen Traktes.
In dem zwischen Innerem Burghof und Heldenplatz gelegenen Raum waren über Jahrzehnte die vom Hof benötigten Reitpferde angebunden. Beständig knabberten die Rösser an jenem Querbalken, der dort die Fahrspuren trennt. Eine mehr oder weniger bewusste Geste des tierischen Zeitvertreibs. Die Zähne gruben sich mit der Zeit immer tiefer ein, hinterließen markante Furchen und Rillen. Und sie hätten das Holz, so Lehne, wohl durchgebissen, wären nicht die Gründung der Republik und die Erfindung des Automobils dazwischengekommen.
Derartige kleine und größere Möblierungselemente des Straßenraumes aus dem Fin-de-Siècle sind gerade in Wien erstaunlich zahlreich erhalten. Insbesondere in der Ringstraßenzone, aber nicht nur dort; denken wir etwa an die alten, im historistischen Stil designten Pissoirs und Bedürfnisanstalten, an diverse Beleuchtungskörper und Umfriedungen bis hin zu Kanaldeckeln und Pollern. Dass jedoch ausgerechnet die relativ anfälligen Holzbalken die Zeit überdauerten und von sämtlichen Umbauten, Krieg und Devastierung verschont wurden, grenzt beinahe an ein Wunder. Und so sind sie gerade in ihrer Unmittelbarkeit Denkmäler der besonderen Art als die letzten im öffentlichen Raum präsenten Gebrauchsspuren, die vom Alltagsleben des Wiener Hofes geblieben sind.
Anhand der kleinen hölzernen Berge und Täler lässt sich der Verlauf der Zeit in bequemer Handhöhe ertasten und die imperiale Vergangenheit der Stadt, in der Pferde noch ein wichtiges Verkehrsmittel waren, auf einzigartige Weise erspüren. Jedenfalls ein erfühlbarer Ort mit besonderer Aura, der uns weit in die Vergangenheit zurückzuführen vermag und der gemeinsam mit dem nostalgisch verbrämten Klang der Fiakerpferde auf dem Kopfsteinpflaster als Signum jener Stadt fungiert, der so gerne ein ausdauernder Blick zurück nachgesagt wird. Womit wir wieder beim Klischee wären.

Werbeplakat in Wien, 2019
ALS MAN LUFT IN FLASCHEN FÜLLTE
»Die Sommerfrische ist zurück!« Euphorisch verkünden die Medien das Comeback einer Urlaubsform, die lange Zeit als überholt und verstaubt galt. Einschlägige Destinationen vom Semmering bis zum Salzkammergut werden als kulturell hoch aufgeladene Orte mit »Retro-Touch und Hipsterkomfort« gepriesen; investmentfreudige Privatinitiativen versuchen leer stehende Villen und Hotels wiederzubeleben. Das Label »Sommerfrische« scheint im heutigen Tourismus eindeutig wieder an Zugkraft zu gewinnen. Marketingtechnisch ist es ja ein überaus gelungener Begriff, mit der Kombination von zwei so positiv besetzten Ausdrücken wie Sommer und Frische. Sogar kleine Sommerfrische-Museen sind bereits entstanden, die die lokale Geschichte aufarbeiten, etwa in Schönberg am Kamp oder in Küb am Semmering. Und immer öfter hört und liest man von Freunden und Bekannten aus der Stadt: Ich bin auf Sommerfrische.
Doch was verbirgt sich hinter dem offenkundigen Boom? Liegt die erneute Zugkraft der Sommerfrische angesichts wiederkehrender Hitzewellen an ihrem Versprechen einer sinnlich anders erlebbaren Gegenwelt? Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie eng Sommerfrische und umfassender »Sinneswechsel« seit jeher konnotiert sind.
Es war Ende des 19. Jahrhunderts, als die Sommerfrische-Bewegung deutlich an gesellschaftlicher Breite gewann. Angehörige des aufsteigenden Großbürgertums, aber zunehmend auch die gehobene Mittelschicht wurden zu prominenten Trägern dieser Übersiedelung auf Zeit. Sie alle bekundeten damit ihre soziale Stellung: gesellschaftliche Distinktion durch Teilhabe an der Sommerfrische. Bürgerliche Familien konnten, mussten und wollten es sich leisten, vier Monate im Jahr mitsamt Familie und Dienstboten der Stadt zu entfliehen.
Die Großstädte wurden im Sommer merkbar leerer. Allein in Wien schätzte man um 1900 die Anzahl der Stadtflüchtigen in der »Saison« auf 100.000 bis 150.000 Personen. Eine »Urbanisierung« im weitesten Sinne hatte eingesetzt; eine Großstadt wie Wien mit ihren mittlerweile fast zwei Millionen Einwohnern reichte, so gesehen, viele Hunderte Kilometer weit ins Land hinein, hatte ihre Ausleger im Hochgebirge und an den Seen und verbreitete dort ihre Kultur und ihren Lebensstil.

Ansichtskarte, 1913
Ein zentraler, von vielen Städtern erwünschter Gegensatz war dabei das Eintauchen in eine andere Sinneswelt. Es war die Sehnsucht nach einer Erholung von der Vielzahl urbaner Impressionen, nach einer Wiederbelebung der abgestumpften Sinne und einer häufig empfundenen Überreizung auf allen Ebenen, visuell, olfaktorisch und besonders akustisch.
Die moderne Großstadt und die bürgerliche Gesellschaft, deren reibungsloses Funktionieren kontrollierten Abläufen, diszipliniertem Verhalten und strikten Affektregulierungen zu verdanken war, benötigte eine Projektionsfläche, einen Sehnsuchts- und Ruheort, wie ihn die Sommerfrische gleichsam auf utopische, fast schlaraffenlandähnliche Weise darstellte. Nicht zufällig kam damals etwa für das Salzkammergut der romantisch geprägte Begriff der »Seelenlandschaft« auf.
Читать дальше