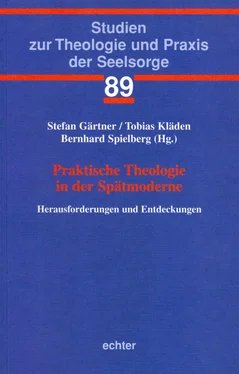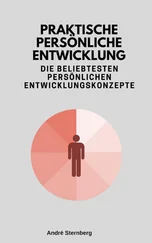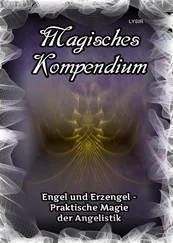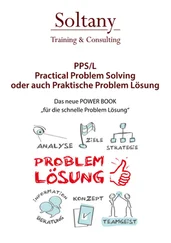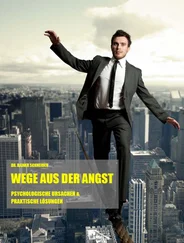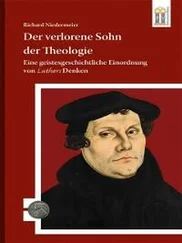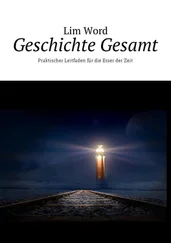1 ...6 7 8 10 11 12 ...25 „Vielleicht lässt sich […] auf dem Boden der Theologie selbst […] ein Weg finden, sich der Postmoderne-Thematik angemessen zu nähern. […] Stellt nicht gerade der christliche Gottesbegriff eine Möglichkeit dar, Einheit zu denken, ohne totalitär zu werden, Vielheit aber, ohne die Differenz in kontrastloser Indifferenz […] untergehen zu lassen? […] Vom christlichen Gottesbegriff her […] ist Vielheit Reichtum, totalisierte Partialität aber Sünde: die klassische Sünde der Auflehnung gegen Gott. Denn nur er ist der Eine; es macht den christlichen Glauben aus, dieses Eine als das zugleich Viele und […] Nichttotalitäre zu denken.“ 119
Entsprechende „differenzhermeneutische Spurenelemente christlicher Theologie “ 120führen zu einem „Ausfindigmachen von Momenten des Widerstreits“ 121in der Theologie selbst und damit auch zu „Theologien, deren Gedankengänge sich nicht dem Rhythmus der Moderne anbiedern, stattdessen aber in der Auseinandersetzung mit der Postmodernediskussion eine ureigene […] Thematik neu entdecken“ 122.
Eine in diesem Sinne spätmoderne Praktische Theologie wird den handlungstheoretischen Konsens 123hinter sich lassen und sich ihrem methodologischen Dreischritt gemäß 124weiter ausdifferenzieren: in eine empirische Pastoraltheologie, die mit Neugierde und Leidenschaft die eigene Gegenwart erkundet („Sehen“), eine kritische Pastoraltheologie, welche die theologische Urteilskraft des Volkes Gottes schärft („Urteilen“) und eine pragmatische Pastoraltheologie, die das Gespräch mit kirchlichen Verantwortlichen sucht („Handeln“):
„Man kann grundsätzlich von einer wechselseitigen […] Ergänzung der verschiedenen praktisch-theologischen Ansätze ausgehen. Eine solche Multiperspektivität ermöglicht erst eine angemessene Analyse der Vielschichtigkeit religiöser Ausdrucksformen in der Spätmoderne.“ 125
Ein intradisziplinäres Gespräch dieser fachinternen Multiperspektivität ist eine Herausforderung, die das ganze Fach intellektuell neu beleben könnte – zumindest dann, wenn theologische Intellektualität die „Fähigkeit meint, die Wirklichkeit gleichzeitig aus mehr als einer Perspektiven zu sehen“ 126:
„Sie stellt alles in Frage, denn sie hat mit den ersten und letzten Dingen zu tun und kann von ihnen nicht lassen, hat sie aber eben auch alles andere als in der Hand – und weiß es auch noch. […] Betrachtet man dann auch noch die […] diachrone [bzw. synchrone, Ch. B.] Komplexität der Theologie, […] geraten die Dinge ins Tanzen. Wo wächst größerer Perspektivenreichtum? Komplexität wohin man blickt […]. Als Katholik bin ich gezwungen, mich ihnen [den Differenzen der eigenen kirchlichen Tradition, Ch. B.] zu stellen: jenen, auf die ich stolz bin, wie den anderen […]. Das alles ist ein einziger Problemgenerator. Und nicht der unintelligenteste.“ 127
6. Pluralitäten kultivieren
Der soziale Körper des Volkes Gottes ist längst von einem Plural von differenten Idealtypen des Kirchlichen durchzogen – in unsystematischer Reihung ein Kaleidoskop von älteren und neueren Versuchen einer Zuordnung:
| Katholizismus: |
fundamentalistischer Sektor, interaktiver Sektor, Sektor diffuser Katholizität, Sektor formaler Organisation, Bewegungssektor 128 |
| Sozialformen: |
gottesdienstzentrierte Ritenkirche, gemeindliche Insider-kirche, professionalisierte Sozialkirche 129 |
| Pfarrformate: |
Pfarrer-Pfarren, Aktivisten-Pfarren, verbindliche Gemeinden, schöpferische Netzwerke 130 |
| Gemeindentypen: |
vorbürgerliche Betreuungsgemeinde, bürgerliche Angebotsgemeinde, nachbürgerliche Beteiligungsgemeinde 131 |
| Priester: |
zeitloser Kleriker, zeitnaher Kirchenmann, moderner Gemeindeleiter, zeitoffener Gottesmann 132 |
| Diakone: |
liturgie-zentrierter Levit, helfend-diakonischer Samariter, politisch-diakonischer Prophet 133 |
| Pastoralreferenten: |
kirchliche Volkstheologen/-innen, funktionale Presbyter/-innen, konsequente Weltlaien 134 |
| Jugendarbeit: |
religiös interessierte Spirits , sozial engagierte Humans , erlebnismäßig orientierte Funs 135 |
Das solchermaßen plural strukturierte Volk Gottes sucht sich mit Tapferkeit, Erfindungsgeist und Lebenswitz längst eigene Orte im spätmodernen Alltag der Gegenwart – und ist seiner Theologie damit voraus:
„Die Theologie ist […] zur Zeit eher mit bilanzierenden Projekten beschäftigt […] denn mit der Bearbeitung innovativer Themen […], wie sie sich aus der Situation des Volkes Gottes […] ergeben. […] Es soll daher die Vermutung zur Diskussion gestellt werden, dass die deutsche katholische Theologie […] nach ihrem Status als Hoffnungsträgerin […] im konziliaren Aufbruch nunmehr […] gegenüber der realen Problemlage des Volkes Gottes […] in einen spezifischen Rückstand geraten ist. […] Solange die Theologie sich mit dieser Gegenwart im Muster entsolidarisierenden Kulturpessimismus‘ […] auseinandersetzt, gerät sie massiv in Rückstand zum Volk Gottes […]. [Dessen Mitglieder führen längst ein eigenes, Ch. B.] Leben in den Pluralitätsstrudeln der Postmoderne […].“ 136
Man kann mit dieser Situation auf sehr verschiedene Weise umgehen. Einen Ansatzpunkt bietet einmal mehr Karl Rahner:
„P. [Pluralismus] im unvermeidl. Sinn einer kreatürl. Notwendigkeit bedeutet die Tatsache, daß der Mensch u. sein Daseinsraum […] trotz der Einheit in Gott […] aus so verschiedenen […] Wirklichkeiten gebildet werden, daß die Erfahrung des Menschen selber von ursprünglich mehreren Quellen herkommt […] u. er weder theoretisch noch praktisch diese Vielfalt auf einen einzigen Nenner bringen kann […], von dem allein aus diese Vielfalt […] beherrschbar wäre. Die […] Einheit der Wirklichkeit ist […] als […] eschatolog. Hoffnung da, nicht aber als verfügbare Größe. Dieser P. [Pluralismus] ist der Index der Kreatürlichkeit: nur in Gott ist alles eins […].“ 137
Diese protologisch begründete und eschatologisch offengehaltene Sichtweise von Pluralität teilen nicht alle, die sich auf Rahner berufen – wie zum Beispiel Thomas Pröpper mit seiner ‚Münsteraner Schule‘ theologischer Letztbegründung, der sich mit einem entsprechend positiven Gegenwartsbezug schwertut, weil er den Begriff der Spätmoderne im Sinne postmoderner Beliebigkeit versteht: „Der Spätmoderne weiß nicht mehr, was er denken soll, weil er alles denken kann. Im pluralistischen Einerlei traut er sich keine Wertungen mehr zu. […] Neu ist nicht das Problem des Pluralismus, sondern wie aus der Not eine fröhliche Tugend gemacht [wird]“ 138. Anders Elmar Klinger mit seiner ‚Würzburger Schule’ 139einer befreiungstheologisch gewendeten und spätmodern angeschärften Konzilstheologie in der Spur Rahners. Für ihn ermöglicht Pluralität ein „neues Denken von Gott“ 140jenseits einer Moderne, deren Denken in einer „Reihe von Fußnoten zu Platon“ 141aufgehe:
„Es steht in einem direkten Widerspruch zum Platonismus. Es denkt Einheit und Vielheit anders. In der platonischen Tradition ist die Vielheit von der Einheit bestimmt und aus ihr abgeleitet. Sie geht aus ihr hervor und geht in sie zurück. Sie verhalten sich wie der Teil und das Ganze. Das Viele ist dem Einen untergeordnet, das Eine steht über dem Vielen […]. Im neuen Denken liegt das Verhältnis umgekehrt. Die Vielheit steht vor der Einheit, der Teil vor dem Ganzen. Die Einheit verkörpert Vieles und das Viele kann zur Einheit werden. Es ist das Fundament der Einheit. […] Auf dem Boden des Pluralismus wird das Denken Gottes selber neu.“ 142
Klinger zufolge schafft Pluralität die schöpferische „Polarität“ 143von potenziell kreativen Differenzen, in denen Neues entstehen kann. Mit den Worten seines Lehrers Rahner gesprochen:
Читать дальше