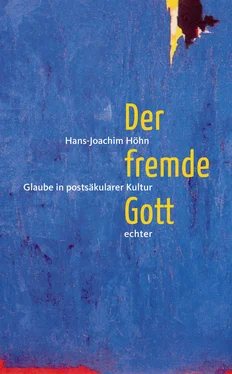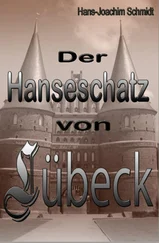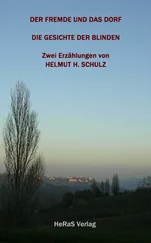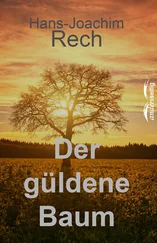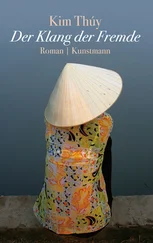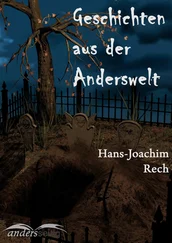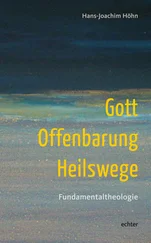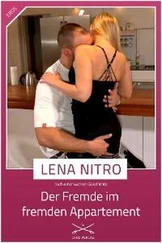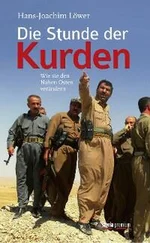• Alles, was der Mensch übernatürlichen Mächten und Gewalten zugeschrieben hat, muss ihm zurückerstattet werden, weil es ursprünglich ihm zukommt und Teil seines ur-eigenen Vermögens ist (L. Feuerbach).
• Alles, was der Mensch an Trost angesichts trostloser Lebensumstände bei der Religion gesucht hat, muss als billige Vertröstung entlarvt werden, weil es die Veränderung der Verhältnisse blockiert (K. Marx).
• Alles, was der Mensch „über“ sich wähnt, verhindert die Reifung dessen, was er „in“ sich hat, und lässt ihn „infantil“ bleiben (S. Freud).
Der Gottesgedanke wird als Projektion der dem Menschen eigenen Entwurfs- und Verwirklichungsmacht auf ein fiktives Außerhalb kritisiert. Hat der Mensch seine Potenz ganz erfasst, wird diese Projektion überflüssig und zum Störfaktor, der die Selbstverwirklichung der Vernunft hemmt. Glauben erscheint als eine rational nicht gedeckte Haltung, die vom Menschen aufgegeben werden muss, will er zu sich selbst kommen. Aussagen über „Transzendenz“ erscheinen als überflüssige Zusatzbehauptung zur tatsächlich erfahrbaren Wirklichkeit. Religiöse Rede von Gott unterliegt folglich dem Sinnlosigkeitsverdacht.
Das Autonomieideal der Moderne verlangt vom Menschen, in allen Fragen der Wirklichkeitserkenntnis und der Lebensgestaltung nur den Imperativen der Vernunft zu folgen. Mit dieser Aufforderung geht kein neues Zwangsregime einher. Vielmehr sichert sie erst Freiheit und Selbstbestimmung. Politische Selbstbestimmung ist angewiesen auf die Freiheit und die Pflicht, nach Gesetzen zu leben, die Gesetze der Vernunft sind. Vernünftig ist der Mensch, der es unternimmt, seine Unfreiheit und Unmündigkeit selbst zu überwinden und ein freies und gerechtes Miteinander der Menschen kraft eigener Einsicht und in eigener Verantwortung zu gestalten. Die Autonomie der Naturerkenntnis und der soziokulturellen Sachbereiche (Wissenschaft, Wirtschaft, Politik) macht die Hypothese „Gott“ zur Erkenntnis und Gestaltung von Natur und Gesellschaft überflüssig. Die Welt versteht sich von selbst und „funktioniert“ ohne sein Eingreifen oder Zutun. Es geht auch ohne ihn. 28Es ist geradezu ein Unterscheidungsmerkmal moderner und vor-moderner Welterklärungskonzepte, ob darin noch die Größe „Gott“ auftaucht.
Aus der Möglichkeit der Weltinterpretation und Weltgestaltung ohne Gott macht die Moderne die Notwendigkeit der Weltbewältigung ohne Gott – um der Autonomie der theoretischen wie der praktischen Vernunft willen. Was ich ohne einen anderen kann , das soll ich gefälligst auch alleine tun – so lehrt die Neuzeit. Und so macht sie aus der Möglichkeit des Menschseins ohne Gott die Notwendigkeit einer Menschlichkeit ohne Gott. Daher steht die Moderne nicht allein im Zeichen der Autonomie der Vernunft, sondern auch im Zeichen der Negation Gottes. 29Der faktische Lauf der Welt gibt ihr Recht. Er bestätigt kontinuierlich die Annahme von Gottes Nicht-Notwendigkeit zur Erklärung innerweltlicher Abläufe und Sachverhalte. Man kann mit ihm in der Welt nichts mehr anfangen, weil man alles auch ohne ihn in Gang setzen kann. Was der Mensch in ihr Neues aufführt, gelingt ohne göttlichen Beistand. Die Welt ist erklärbar ohne Gott und der Mensch kann menschlich sein ohne Gott. Gott lässt sich negieren, weil man nicht sieht, was einen Gott, der als moralische, naturwissenschaftliche, politische Arbeitshypothese abdanken musste, von einem Gott unterscheidet, den es gar nicht gibt. 30Was, wie und wer Gott sei, wird für eine Gott los gewordene Zeit offenkundig zu einer müßigen Frage. Ein Gott, der nirgendwo antreffbar ist, ist kein göttlicher Gott mehr, von dem es einmal hieß, er sei allgegenwärtig. Wenn man mit Gott im Horizont dieser Welt nichts mehr anfangen kann, ist er ins Beliebige abgedrängt und überflüssig geworden. Ein überflüssiger Gott ist kein wirklicher Gott.
Ein Gott, der offenbar kein „richtiger“ Gott (mehr) ist, ist nichts Richtiges – und darum kann das Reden von ihm auch nicht richtig sein. Es lässt sich unschwer zeigen, dass religiöse Aussagen über „Gott und die Welt“ sinnlos werden, sollten sie den Status empirischen Wissens von Tatsachen besitzen (z. B. „Gott befindet sich in einem Paralleluniversum“) oder als expressive Ausdrucksformen subjektiver Emotionen aufgefasst werden können (z. B. „Ich habe das Gefühl, dass Gott die Welt erschaffen hat“) bzw. als Hypothesen auftreten, die bestimmte Wirklichkeitsannahmen fingieren (z. B. „Christen tun so, als ob Jesus von Nazareth Gott als Vater habe“). 31Wenn nun ebenso gezeigt werden kann, dass keine andere Sprachform zur Verfügung steht, um das zu artikulieren, was Christen „eigentlich“ meinen, dann deutet dies weniger auf ein Versagen der Sprache und der Möglichkeit vernünftiger Rede hin. Vielmehr scheint darin deutlich zu werden, dass Christen – entgegen ihrer Behauptung – eigentlich nichts Vernünftiges zu sagen haben.
Gegen diese Schlussfolgerung wird in Religionskreisen zunehmend auf ein vielfaches „Vernunftversagen“ in der Moderne verwiesen und bestritten, dass alles, was zu sagen ist, in der Sprache der neuzeitlichen Vernunft formuliert werden muss. Deren Sprache und Sache gelten als kompromittiert und konterkariert durch das Widervernünftige, an dem die Religion teilhaben würde, sollte sie sich die Sache und Sprache der Vernunft zu eigen machen. In der Tat haben sich die von der Moderne ausgelösten Rationalisierungsprozesse längst als höchst ambivalent herausgestellt. Die Dialektik der Aufklärung hat die Gleichsetzung von Autonomie und Fortschritt als voreilig erwiesen. Es sind die Siege der aufgeklärten Moderne, die ihre Krisen hervorrufen. 32Ihre ökologischen Krisen und ökonomischen Pathologien lassen danach fragen, ob sie bei ihren Fortschrittsprojekten nicht ihr Autonomie- und Säkularitätsideal überdehnt hat. Der Kern dieses Ideals besteht in der Vorgabe, nur mit jenen Ressourcen auszukommen, welche die säkulare Vernunft mit ihren eigenen Mitteln erschließen und sichern kann. Hat sich die Moderne mit diesem Ideal nicht übernommen? Wird nicht jetzt sichtbar, dass sie auf Kräfte angewiesen ist, die „jenseits“ des Säkularen zu entdecken sind? Drängt sich nicht neu die Notwendigkeit auf, sich für das „Andere“ der Vernunft zu interessieren?
Das Projekt einer Weltbeherrschung als uneingeschränkter Ausführung menschlicher Autonomie bleibt zweifellos so lange unerfüllbar, wie jene Bedingungen menschlichen Daseins ausgeblendet bleiben, welche diesseits und jenseits der Vernunft zu orten sind. Hier gilt der Grundsatz: Es geht zwar niemals ohne Vernunft, aber auch nicht mit der Vernunft allein („sola ratione numquam sola“). Nicht nur Grenzen des Wachstums, sondern auch Grenzen der Vernunft sind unbestreitbar. Sie werden dort sichtbar, wo sich die Autonomie- und Fortschrittsversprechen der Moderne als unerfüllbar erweisen. In einer Zeit gewachsener Sensibilität für ihre ökologischen und ökonomischen „Entgleisungen“ braucht es nicht zu verwundern, wenn es eine neue Offenheit für jenes Krisen- und Lebenswissen gibt, das die Religion repräsentiert. In ihm spricht sich aus, was der Mensch nicht hinter sich lassen darf, wenn er vorankommen will. Abgewirtschaftet haben jene Größen und Kräfte, die nur ein für Mensch und Natur ruinöses, zweckrationales und instrumentelles, auf ein Unterwerfen der Wirklichkeit abgerichtetes „Herrschaftswissen“ verwalten. Hoch im Kurs stehen Traditionen, die ein „Verständigungswissen“ offerieren, das den Menschen wieder in Einklang mit sich und seiner Welt bringen kann.
Die damit einhergehende – vielfach eher behauptete oder beschworene als empirisch belegte – Renaissance der Religion, De-Säkularisierung der Kultur und Re-Spiritualisierung von Lebensdeutungen 33hat jedoch wenig Nachfrage für die Rede von Gott ausgelöst. 34Der „postsäkulare“ Trend zur Religion hat die Gottesfrage weitgehend ausgelassen. Und wo sie dennoch publizistisch aufgegriffen wurde, hat die einschlägige Literatur zwar dafür gesorgt, dass die Rede von Gott wieder im Kommen ist, 35ohne jedoch ein Kommen Gottes ansagen zu können. Bei aller Notwendigkeit, sich für das (religiöse) „Andere“ der Vernunft zu interessieren, besteht offensichtlich kein Anlass, mit dieser Notwendigkeit die Frage nach Gott zu assoziieren. 36Trotz aller Dialektik von Säkularisierungsprozessen bleibt ein Hauptsatz der neuzeitlichen Religionskritik in Geltung: Für das Reden von Gott besteht keine innerweltliche Notwendigkeit.
Читать дальше