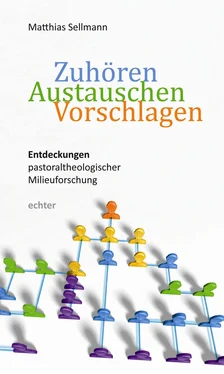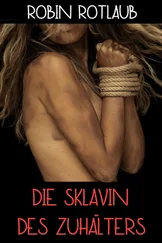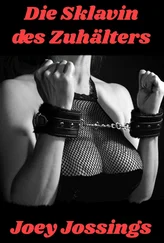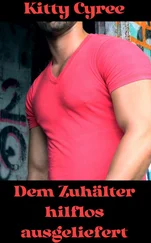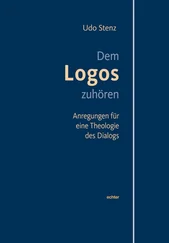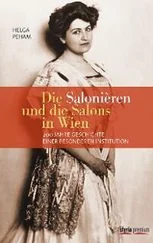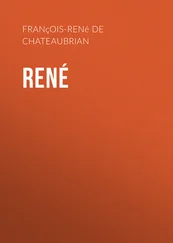37 Congar 1968: 416.
38 Vgl. Kasper 1987: 295 f.
39 So Schmiedl 2012: 15 in seinem Gesamtüberblick über 50 Jahre Rezeptionsgeschichte des Vatikanum II. Das folgende Zitat ebd: 16.
40 Vgl. nur Erbacher 2012.
41 Vgl. Ebertz 2006b: 38 f sowie die einschlägigen Konzilspassagen im Register von Herders Theologischem Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 1: 850.
42 Zur Diskussion vgl. Collet 2002, v. a. 100–105. 172–196.
43 Theobald 2006: 81.
44 Rahner 1967a: 629.
45 Ebd.: 628; dort auch das folgende Zitat; vgl. zum Ganzen auch Rahner 1967d: 18: „Das ist ein Vorgang höchst seltsamer, gefährlicher und in einer Ekklesiologie noch gar nicht reflektierten Art.“
46 Rahner 1967d: 38.
47 Theobald 2006: 71.
48 Vgl. ebd.: 75–77.
49 Vgl. ebd.: 74. 77. 81.
50 Zur Schemaverwendung in GS vgl. Sander 2005: 637–640. 644–650. Zur Problematik des Konzeptes kurz Klein 1999: 248 f.
51 Zur Entdeckung des ‚resonare‘ vgl. Fresacher 2009: 60–62 sowie bereits in milieusensibler Absicht Garhammer 2008.
52 Ebd.: 83.
53 Das Bild vom ‚Hören‘ ist in der geistlichen Literatur sehr bekannt; vgl. nur Hemmerle 1999.
54 Vgl. unten unter 3.2.
55 Vgl. ausführlich und von den Konzilsdokumenten her Hennecke 1997: 27–142.
56 Hierin liegt ja eine wesentliche Begründung, warum Theologiestudierende unter großen Mühen Sprachen lernen, die man jenseits von Kirche und Theologie ja nur wenig gebrauchen kann: Neutestamentliches Griechisch, Hebräisch usw. Es geht im Letzten darum, hermeneutische Optionen zu erarbeiten und zu erhalten, also für Weite zu sorgen, und nicht jenen auf den Leim zu gehen, die bestimmte Deutungen bestimmter Textstellen für alternativlos halten.
57 Vgl. Papst Paul VI. 1975 sowie Französische Bischofskonferenz 2000.
58 Vgl. Die Deutschen Bischöfe 2000. Im Ganzen zu ‚Zeit zur Aussaat‘ vgl. Sellmann 2004. Zu ‚Evangelii Nuntiandi‘ vgl. Die Deutschen Bischöfe 2000: 15 ff; zu den deutschen und französischen Entstehungsprozessen der bischöflichen Papiere vgl. Müller 2004: 229–238; zur Sprachproblematik rund um die Übersetzung des Wortes ‚proposer‘ vgl. Müller 1999: 320 f.
59 Französische Bischofskonferenz 2000: 60 (im Original teils kursiv).
60 Die Deutschen Bischöfe 2000: 40 (im Original teils hervorgehoben).
61 Vgl. Papst Paul VI. 1975: ‚Evangelii Nuntiandi‘ nimmt in der Nr. 23 wohl auf GS 42 und 45, an keiner Stelle aber auf die Theologie in GS 44 Bezug; der Text umkreist auch fast alle Ziffern von ‚Ad Gentes‘, nicht aber die zu GS 44 ähnliche Passage in AG 22. Der Befund stimmt nachdenklich, da Papst Paul VI. sich in den Anfangsnummern deutlich auf das Erbe des Konzils besinnt und als grundlegendes Problem die Frage aufwirft: „Ist die Kirche – ja oder nein – nach dem Konzil und dank des Konzils (…) fähiger geworden, das Evangelium zu verkünden (…)?“ (Nr. 4). Diese Frage soll ‚Evangelii Nuntiandi‘ beantworten – und kann dies offensichtlich ohne Erwähnung des ‚lex evangelizationis‘ aus GS 44.
62 Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre 2007: Etwa die Nummer 63 der ‚Lehrmäßigen Note‘ behandelt direkt den Ausgangspunkt von GS 44, zitiert GS hier aber gerade nicht. Vielmehr wird die in GS 44 und AG 22 betonte Wechselseitigkeit des Offenbarungslernens in das gewohnte Frage-Antwort-Schema gebracht: Die Kirche hat bereits vor dem Kulturkontakt eine unwandelbare Botschaft; die Kultur fragt danach; die Kirche ist bereit, Sitten und Gebräuche didaktisch in die Verkündigung einzubeziehen; letztlich aber geht es um das Verkünden der Einen und das Hören der Anderen.
63 Dieses Beispiel bringt ausgerechnet der Chef der bekannten Werbeagentur ‚Zum goldenen Hirschen‘ Marcel Loko 2012.
64 Vgl. zum Ganzen einer pluralitätskompatiblen Kirche auch Wenzel 2009 sowie nochmals Theobald 2006. Beide Autoren beziehen sich auf einen grundlegenden und beeindruckenden Aufsatz von Karl Rahner über das Problem der Säkularisation (Rahner 1967b). Rahner kann hier zeigen, dass die säkulare Gesellschaft für die Kirche deswegen begrüßenswert ist, weil sie ihr die Falschheit eines bestimmten theologischen Integralismus vor Augen führt. Falsch ist dieser, weil er die Freiheit der Menschen missachtet (These 1) und eine (Selbst-)Idealisierung betreibt, die die Last des Daseins unzulässig abmildert (These 5) . Akzeptiert man aber Freiheit als Grundbestimmung des Gotteswillens, sind die Konsequenzen beträchtlich: Kirche wird selbst zu einer pluralen Größe (These 2); ihr Auftrag der Gesellschaft gegenüber ist ein prophetischer – und damit ein inhaltlich bestreitbarer (These 3); eine neue theologische Disziplin wird nötig, eine Pastoraltheologie, die jene Erkenntnisse beibringt, die für das Handeln der Kirche unabdingbar, aus eigenen Offenbarungsquellen aber nicht erschließbar sind (These 4).
3 Kurzes fazit und Ausblick
auf den weiteren Gedankengang
Soweit die zunächst im Konzeptionellen verbleibende Vorstellung des neuen pastoraltheologischen Dreischrittes, wie er sich aus der ganzen Pastoralkonstitution und vor allem aus ihrer Nummer 44 ergibt. Die Perspektive bleibt in diesem ganzen Teil I klassisch theologisch, und manche Leserin, mancher Leser wird ungeduldig darauf warten, dass endlich die Milieuforschung behandelt wird. Zwar ist sicher deutlich geworden, in welcher Funktion diese zum Einsatz kommen wird: nämlich als operative Durchführung jener Kontextbezogenheit, deren Konstitutivität für die kirchliche Selbsterkenntnis in den zurückliegenden Gedankengängen hergeleitet wurde. Aber es braucht noch etwas Zeit, dies konkret durchzuführen. Erst ab Kapitel 5 wird die soziologische Milieutheorie als diejenige Wissenschaft identifiziert, die es in hervorragender Weise erlaubt, dem Auftrag von GS 44 nachzukommen, sich als Kirche in die gegebenen kulturellen Kontexte einzustellen und die eigene Identität von dieser Dezentrierung der Perspektive her zu gewinnen. GS 44 ist eine Programmatik, die die Theologie von sich aus sowohl inhaltlich wie methodisch in die Interdisziplinarität verweist. Dabei dürfte deutlich geworden sein, dass – in diesem Fall – die Soziologie mehr ist als eine reine Hilfswissenschaft, eine Magd (ancilla) der Theologie. Denn wir haben gesehen, dass die Kontexterkenntnisse die Offenbarung erschließende Informationen bedeuten, gerade weil sie aus jener nicht abgeleitet werden können. Man verlässt darum auch nicht das Gebiet der Theologie, wenn man soziologische Milieuforschung betreibt – jedenfalls dann nicht, wenn das Erkenntnisziel des ganzen Unternehmens darin liegt, die je aktuelle Selbstmitteilung Gottes besser erfassen zu wollen.
Wie der pastoraltheologische Dreischritt operativ durchgeführt werden kann; inwiefern soziologische Milieuforschung das ‚auscultare‘, ‚commercium‘ und ‚proponere‘ der Kirche präzisiert und zu verarbeitbaren Daten macht, das ist Gegenstand der Kapitel ab der Nummer 5.
Davor liegt ein weiterer notwendiger Zwischenschritt, den das Kapitel 4durchführt. Hier ist das vor allem an Empirie interessierte Leseinteresse um Geduld zu bitten – oder um das Vorblättern. Denn es bedarf neben der konzilsgeschichtlichen noch einer systematischen Sondierung. Wenn man es genauer betrachtet, war die bisherige Argumentation eine ‚ad auctoritatem‘. Ihre Kraft lag in dem Hinweis auf eine externe Autorität, nämlich der eines ganzen ökumenischen Konzils der Weltkirche und damit auch der lehramtlich höchst denkbaren. Die aktivierte Logik war: Das Konzil hat den Text so verabschiedet, also müssen wir das auch so umsetzen. Nun sind Argumente ‚ad auctoritatem‘ eher schwach. Sie überzeugen den, der bereits dazugehört, weil er dieselbe Autoritätszuschreibung vornimmt wie der Argumentierende. Und auch wenn das Kapitel 2 neben der reinen Konzilsargumentation bereits einige offenbarungstheologische Analysen von Rahner und Theobald vorgelegt hat, so steht und fällt doch die Stringenz des Gedankenganges mit der Grundakzeptanz des Konzils und vor allem seiner Pastoralkonstitution. Wie wir gesehen haben, ist das aber prekär: Durchaus nicht jeder nachkonzilstheologische Ansatz ist der Meinung, dass ausgerechnet in GS 44 der Durchbruch, der ‚Anfang des Anfangs‘ liegt, sondern anderswo – oder, bei manchen, eben auch nirgendwo. Wenn selbst die lehramtlichen Nachfolgedokumente ganzer Synoden und Kongregationen zur Evangelisierung ohne jeden Hinweis auf das ‚lex evangelizationis‘ aus GS 44 auskommen und die dort gegebene plurale Perspektive in die gewohnte integrale zurückdrehen, ist zwar nach wie vor an das lehramtliche Gewicht des Konzilstextes zu erinnern. Trotzdem tut man gut daran, noch mehr Substanz aufzubieten.
Читать дальше