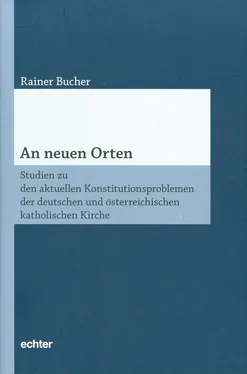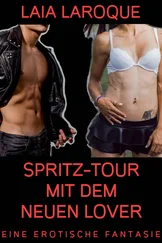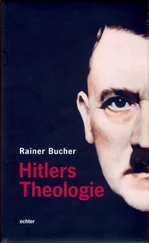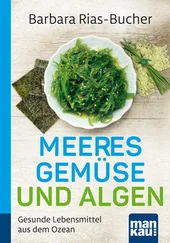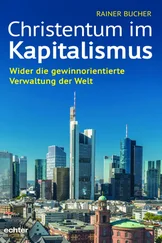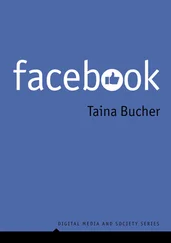Im Rahmen des von Karl Rudolf geleiteten „Wiener Seelsorge-Instituts“ bildete sich daraufhin eine spezielle Arbeitsgemeinschaft „Katholische Aktion und Pfarrgemeinde“. Jetzt erst setzte sich die eigentlich für die „Katholische Aktion“ konstitutive Idee durch, sie nicht als reine Zusammenfassung katholischer Vereine, sondern als völlig neue Bewegung zu verstehen und zu errichten. Das zielte auf nichts weniger denn einen wirklichen Systemwechsel in der pastoralen Basisorganisation. Bis dorthin hatte sich katholisches Laienleben auch in Österreich vor allem in den nach 1848 gegründeten Vereinen abgespielt, die „Pfarre“ war gerade in Folge des Josephinismus vor allem ein „Amt“, an das man sich bei Bedarf, und möglichst nur dann, wandte wie an ein anderes Amt. Zumindest konzeptionell wurde die pastorale Basisorganisation nun radikal auf das Projekt einer explizit gemeinschaftsbezogenen „Pfarrgemeinde“ umgestellt.
„Nur die Organisationsidee der Pfarrgemeinde allein ist ein wirklich Ganzes, ein ideelles, natürliches und übernatürliches, territoriales und einheitliches Ganzes“ 224– so der bereits zitierte Referent zur Jugendpastoral P. Ferdinand Bruckner O.Cist auf der IV. Wiener Seelsorgertagung. Dieses Projekt zielt dabei auf nichts weniger denn auf umfassende, ja totale Erfassung der Gläubigen:
Der Zeitgeist ist nun heute einmal aufs Totale, aufs Ganze gerichtet und tut am liebsten dort mit, wo totale Ideen in totalen Formen Gewähr für entscheidende allgemeine Neugestaltung bieten. Diesem Zeitgeist stehen die partikularen Vereinsformen und -ideen auf die Dauer unebenbürtig gegenüber … Deshalb die verantwortungsschwere, aber vom innersten Erlebnis getragene Frage: Gibt es im katholischen Bereich eine Organisationsidee, auf der eine großzügige einheitliche, vom Wesen her total wirkende, und doch mannigfaltige Gemeinschaftsbildung (der Jugend) möglich wäre? Wenn ja, dann ist es nur die Organisationsidee der Pfarrgemeinde! 225
Im „Wesen der Pfarrgemeinde liegt die geistig religiöse, personale und territoriale Totalität; wenigstens theoretisch und grundsätzlich, wenn auch im Leben nie ganz verwirklicht.“ 226
Den Planern dieser pastoralen Umgestaltung war die Größe ihrer Aufgabe klar: „Es gehört zu den schwersten Problemen, das längst verkümmerte Pfarrbewusstsein in den Leuten wieder lebendig zu machen“ 227, so Franz Schebeck, ein anderer Referent dieser Tagung in seinem Rückblick auf das erste Jahr der neuen Katholischen Aktion unter dem bezeichnenden Titel „Die Pfarrgemeinde als Lebenszentrum der Katholischen Aktion“. Dazu war vieles notwendig: Schebeck wusste, dass es darum ging, „ die Pfarrgemeinschaft in ihrer Ursprünglichkeit wieder herzustellen“ 228, den „ Klerus … wieder für den Gedanken der Pfarrgemeinschaft“ 229zu gewinnen, das „längst verkümmerte Pfarrbewußtsein in den Leuten wieder lebendig zu machen“ 230, und dass die „ Gewinnung und Schulung der Laienhelfer “ 231erst noch begonnen werden musste. Er forderte ein „ Pfarrheim , zum wenigsten einen Pfarrsaal “ 232, vor allem aber ging es um die „Erfassung der ganzen Pfarre “ 233: „Erst die in diesem Sinne aufgebaute lebendige Pfarrgemeinde wird eine fähige Trägerin und fruchtbare Wirkerin der Katholischen Aktion sein können“ 234. Hier findet sich an zentraler Stelle bereits, was auch in der nachkonziliaren Gemeindetheologie zum programmatischen Leitwort werden sollte: die „lebendige Pfarrgemeinde“. Schon die Wiener „Weihnachts-Seelsorgertagung “ des Jahres 1933 trug explizit jenes Motto, das bis vor kurzem den zentralen pastoralen Konzeptbegriff für die Basisorganisation der katholischen Kirche hierzulande bildete: „Die lebendige Pfarrgemeinde“ 235.
Kardinal Innitzer machte sich dieses Programm in seinen erwähnten Richtlinien vom 18. 12. 1934 voll und ganz zu eigen. Innitzer fordert die „ Errichtung von Pfarrheimen “, die Einsetzung eines „ Pfarrbeirat(s) “, „allgemein zugängliche Pfarrabende “ und die „ Schulung der Laienapostel “. Der Pfarrer ist der Führer der Pfarrgemeinde, er beruft die „Führer der Naturstände“. „Als Naturstände sind die Gruppen der Männer, Frauen, der männlichen und weiblichen Jugend anzusehen, und zwar in der Ganzheit aller Pfarrangehörigen“. Die angesprochene „ Zellenarbeit“ besteht aber nach Innitzer darin, „dass in planmäßiger Auswahl der Laienapostel die ganze Pfarre durchorganisiert wird.“ 236
Die zentralen Strukturen dieses Konzepts einer Gemeindetheologie im Rahmen der Katholischen Aktion und innerhalb des autoritären Ständestaates werden markant sichtbar im Vorwort Kardinal Innitzers im „Jahrbuch der katholischen Aktion in Österreich“ des Jahres 1935. Mit Oppositionsbildungen, die auch in der Gemeindetheologie der 70er Jahre zentral wurden, werden spezifische Aufwertungszuschreibungen an die Laien vorgenommen, dies in einem konkret handlungsbezogenen wie in einem dogmatischen Sinne. Die Laien sollen „von bloß Besorgten zu Mitsorgern, von bloß Betreuten zu solchen, die auch betreuen, werden“ 237, denn schließlich besitze der Christ „als Getaufter und Gefirmter priesterlichen Charakter, … so dass er in seiner Weise berufen sei, in einem rechtverstandenen allgemeinen Priestertum zur Welt, die ihn umgibt, zu stehen und in ihr zu wirken.“ 238
Doch auch hier findet sich bereits eine charakteristische Dopplung von Aktivierung und Domestizierung. Denn das alles gelte, so Innitzer, nur „in bewusster Bei- und Unterordnung unter die kirchliche Hierarchie“ 239. „Ein Heer, das zur Schlacht, auf Eroberung auszieht, ohne rechte Zu- und Unterordnung der einzelnen Teile unter der Führung, hat von vorne herein keine Aussicht auf Erfolg, auf Sieg“. Noch „tiefer“ freilich sei „die Unterordnung unter die amtliche Hierarchie … begründet in der Glaubenstatsache, dass Papst und Bischöfe und in ihrem Auftrag die Priester die von Christus unmittelbar zu seiner Vertretung bestellten Hüter und Führer im Reiche Gottes sind.“ Die Arbeit der Laien unterliege daher „in allen Phasen“ der „ordnenden, sichernden und führenden Gewalt“ 240des Bischofs und seiner Vertreter. Innitzer lässt kein Missverständnis über das Ziel dieser pastoralen Erneuerung aufkommen:
Es geht um nichts mehr und nichts weniger, als dass die Kirche sich anschickt, ihren Totalitätsanspruch, den sie von Christus ihrem göttlichen Stifter an alle Menschen und an alle menschlichen Verhältnisse hat, wieder und mit allem Nachdruck zu stellen. Christus soll wieder oder endlich das Haupt der gesamten erlösten Menschheit werden. 241
4 „Gemeindetheologie 1970“ und „Gemeindetheologie 1935“ – ein Vergleich
4.1 Historische Kontinuitätslinien
Zwischen der „Gemeindetheologie 1970“ und der „Gemeindetheologie 1935“ existieren zwei unverkennbare historische Kontinuitätslinien. Ihre Relevanz ist allerdings eigens zu prüfen. Zum einen wurden beide Konzepte in Wien entworfen und damit im einzigen deutschsprachigen Bereich, in dem sich das vatikanische Konzept der hierarchiegeleiteten „Katholischen Aktion“ gegen das ursprünglich deutsche „Katholizismus“-Konzept des Verbände- und Vereinswesens durchsetzen konnte. Man war sich dieser Alternativstellung durchaus bewusst: „Die Vereinsidee, aus liberalen und demokratischen Zeiten stammend und für diese Zeiten notwendig und nur so möglich – muß formal und inhaltlich eine Umwandlung durchmachen, soll sie in die neue Zeit passen, die organisch, total und autoritär denkt.“ In „organisatorischer Hinsicht ist die stärkere Einordnung in die Arbeit und das Leben der Pfarre sowie die Berufung und Sendung der Führer von oben statt ihrer Wahl von unten ein Ausdruck jener Umwandlung“ 242– so Joseph E. Mayer im „Jahrbuch der Katholischen Aktion in Österreich 1935“. Ähnlich auch die Äußerung des Jugendseelsorgers Bruckner auf der erwähnten Seelsorgertagung 1935: „Unsere Vereine stammen aus einer Zeit, die für die gesamt-katholische Bewegung der Pfarrgemeinden noch nicht reif war“, es sei daher „ nicht Verlust und Untergang, sondern große Gnade und Auferstehung, daß wir heute die Vereinsidee hineinwachsen sehen dürfen in die große Idee der Pfarrgemeinde .“ 243
Читать дальше