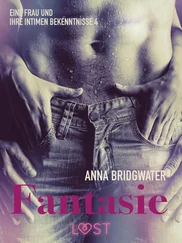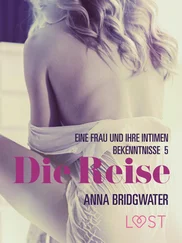Jeder Frau ihre Stimme
Здесь есть возможность читать онлайн «Jeder Frau ihre Stimme» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Jeder Frau ihre Stimme
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Jeder Frau ihre Stimme: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Jeder Frau ihre Stimme»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Gleichstellungsbüros bis hin zur Fristenlösung und der #MeToo-Debatte. Mit Porträts von Persönlichkeiten wie Margrith Bigler-Eggenberger, der ersten Bundesrichterin, und Antoinette Hunziker, der ersten Chefi n der Schweizer Börse, und weiteren. Reich illustriert, bietet dieser Band einen pointierten Überblick über die letzten fünfzig Jahre Frauengeschichte in der Schweiz.
Jeder Frau ihre Stimme — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Jeder Frau ihre Stimme», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Einen klaren Konnex zwischen Menschenrechten und uneingeschränkten staatsbürgerlichen Rechten stellte die Berner Lehrerin und Frauenrechtlerin Ida Somazzi in einer Rede zum hundertjährigen Jubiläum des schweizerischen Bundesstaats 1948, ein halbes Jahr vor der UNO-Deklaration, explizit her. Dennoch avancierte diese Verbindung im Kalten Krieg nicht zum zentralen Argument der Frauenbewegung in ihrem Kampf um das Stimm- und Wahlrecht. 44Zwar forderte der Frauenstimmrechtsverein Zürich 1954 im Vorfeld eines kantonalen Urnengangs zum Frauenstimmrecht die Männer unmissverständlich mit der Aussage «Stimmrecht ist Menschenrecht» zu einem Ja auf. Die meisten Frauenverbände dagegen sprachen sich für ein Nein aus, weil diese Abstimmung von der kommunistischen Partei der Arbeit (PdA) initiiert worden war. So appellierten die befürwortenden Stimmen in der Nachkriegszeit mehrheitlich an helvetische Werte, wie die demokratische Mitbestimmung als Pflichterfüllung, die Zusammenarbeit in der Familie oder, wie es im Plakat mit dem gemeinsam Kartoffeln erntenden Ehepaar hiess, «zämme schaffe, zämme stimme», ohne die patriarchalen Machtverhältnisse zu analysieren oder zu kritisieren. 45Erst die Diskussion um die Ratifikation der EMRK hob in den späten 1960er-Jahren die Bedeutung des Diskriminierungsverbots für die Einforderung des Wahl- und Stimmrechts hervor. Doch im Kontext der fremdenfeindlichen Schwarzenbach-Initiative, die zu eben dieser Zeit hohe Wellen schlug und 1970 von den Schweizer Männern nur knapp abgelehnt wurde, hatten Menschenrechtsargumente in der Schweiz allgemein einen sehr schweren Stand.
Doch auch nach der Einführung des Frauenstimmrechts blieben in den 1970er-Jahren die alten Argumentationslinien in der organisierten Frauenbewegung und unter den gewählten Politikerinnen wirksam, wenn es um die Gleichstellungspostulate ging: gleiche Pflichten bei gleichen Rechten, partnerschaftliches Zusammenarbeiten von Männern und Frauen. Insbesondere für den Bund Schweizerischer Frauenorganisationen (BSF), aber auch für einen Teil der ehemaligen Frauenstimmrechtsaktivistinnen und weitere Frauenverbände wie den Schweizerischen gemeinnützigen Frauenverein (SGF) und die Schweizerische Vereinigung der freisinnigen Frauen (SVFF) geriet der analog zur Wehrpflicht der Männer von Frauen oder Mädchen zu leistende «Dienst am Vaterland», ob im militärischen oder in anderen Bereichen, zu einer Frage von staatsbürgerlicher Bedeutung. 46Alle diesbezüglichen Impulse der 1970er-Jahre versandeten längerfristig. Zum einen scheiterten die Vorlagen wegen der erstarkenden feministischen Bewegung, für die ein geschlechterspezifischer Dienst – die Männer in der Armee, die Frauen im sozialen Bereich – unter der damaligen Vorgabe der mit mehrmonatiger Haft bestraften Verweigerung des Militärdienstes zugunsten eines Zivildienstes schlicht nicht diskussionswürdig war. Sie scheiterten aber ebenso an der unterschiedlichen Schwerpunktsetzung anderer Frauenverbände und dem geringen Interesse vieler Männer an einer obligatorischen Dienstpflicht der Frauen. 47
Entgegen diesem Trend zur Verknüpfung von Pflichten und Rechten, der bereits den frühsoziologischen Diskurs französischer Feministinnen im 19. Jahrhunderts geprägt hatte, 48betonten zwar nicht die Verbände, wohl aber einzelne Frauenrechtlerinnen ebenso vor als auch nach 1971 die Bedeutung der Menschenrechte. Dazu gehörten die 1934 geborene spätere erste Bundesrichterin Margrith Bigler-Eggenberger und die um mehr als eine Generation ältere Juristin Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger (1901–1988); Sozialdemokratin die eine, Mitglied des Schweizerischen Katholischen Frauenbunds (SKF) die andere. So hielt Ruckstuhl-Thalmessinger in einer von der International Alliance of Women herausgegebenen Schrift 1968 zwar fest, dass die Umsetzung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte noch zu wünschen übrig lasse, aber dessen ungeachtet bleibe sie «für die Frauen eine Verkündigung von einem nie erreichten Wert. Dadurch wird ihnen eine unanfechtbare Grundlage geboten, um ihre Befreiung zu erwirken.» 49Ruckstuhl-Thalmessingers Befreiungsdiskurs verweist auf eine Schnittstelle zwischen ihren Erwartungen und jenen der neuen Generation von Feministinnen.
Befreiung, Autonomie und Frauenbeziehungen
In den 1970er-Jahren drehte sich der transnationale Diskurs der sich neu entfaltenden Frauenbewegung massgeblich um «Befreiung». Er bestimmte in Analogie zu US-amerikanischen und westeuropäischen Vorbildern auch die Namensgebung der sich formierenden Gruppen in der Schweiz: Frauenbefreiungsbewegung (FBB) und Mouvement de libération des femmes (MLF). Diese Befreiung definierte sich nicht über die gesetzliche Umsetzung der Menschenrechte, sondern über uneingeschränkte Selbstbestimmung, symbolhaft verdichtet in der Verfügung über den eigenen Körper im Kontext der Reproduktion, das heisst auch von Verhütung und Abtreibung. In ihren Anfängen setzte die Frauenbefreiungsbewegung den Begriff «Befreiung» noch gleich mit dem Kampf der ehemaligen Kolonialstaaten gegen imperiale Verfügungsmacht. Das wandelte sich in den 1970er-Jahren. Die neue Frauenbewegung verstand nun unter Befreiung zunehmend «Autonomie». Damit setzte sie einen Kontrapunkt zur «Integration», welche die älteren Frauenverbände verfolgten, die sich einbringen wollten, indem sie beispielsweise in gesetzgebenden Kommissionen mitarbeiteten. Autonomie hiess für die neue Frauenbewegung, sich abzugrenzen, von geschlechtergemischten Organisationen und Gruppierungen generell, auch von der Neuen Linken mit ihrer Fixierung auf Produktionsverhältnisse im Besonderen. 50Mit linken Männern liierte Frauen tauschten sich in den von den USA inspirierten Selbsterfahrungsgruppen über die gesellschaftliche Dimension ihrer alltäglichen Zurücksetzung im Privaten aus. Sie verweigerten unter dem Slogan «Das Private ist politisch» die Subsumierung feministischer Zielsetzungen unter vorgegebene Leitlinien. Vielmehr verknüpfte die neue transnationale feministische Bewegung Kapitalismus- und Patriarchatskritik, die sich der Deutungshoheit von Männern jedwelcher politischer Couleur und Machtposition entzog. Sie übernahm zwar kämpferische Begriffe der militanten Arbeiterbewegung und das Symbol der erhobenen Faust. In Verbindung jedoch mit dem Frauenzeichen markierte es den eigenständigen Kampf gegen die Unterdrückung – ein Symbol von transnationaler Kraft, das bis heute Frauen auf verschiedenen Kontinenten zu mobilisieren vermag. Während zu Beginn der 1970er-Jahre auf Flyern und Transparenten die geballte Faust das Frauenzeichen als Fessel sprengte, so wandelte sich das Symbol in der Folge gewonnener Autonomie zu einem positiven Zeichen selbstbewussten Frauseins, das sich patriarchaler Definitionsmacht entzog. 51
Die Verbindung von Autonomie und Patriarchatskritik führte zu ganz spezifischen Aktionsformen. Die Frauen bildeten Arbeitsgruppen, die gänzliche Planungs- und Handlungsfreiheit hatten. Eine zentrale Entscheidungsinstanz gab es nicht. Der hierarchiefreie Austausch zwischen Frauen stand im Vordergrund. Doch um sich autonom auszutauschen und unabhängig zu handeln, brauchte es Räume. So erkämpfte sich die neue Bewegung zuerst in Zürich, dann in weiteren Städten meist von den lokalen Behörden und mit unterschiedlichem Einsatz – von Verhandlungen wie in Zürich bis zu Hausbesetzungen wie in Genf 52– zu «Frauenzentren» deklarierte Liegenschaften. In diesen Treffpunkten tauschten sich Frauen in Selbsterfahrungsgruppen aus, disputierten über Politik, gestalteten Projekte, planten Aktionen und eröffneten Beratungsstellen.
Äusserst initiativ zeigten sich bei dieser Suche nach autonomen Räumlichkeiten in den grösseren Städten neu entstandene Lesbengruppen: die Gruppe Sappho s’en fout in Genf und die Homosexuelle Frauengruppe (HFG) in Zürich. Sie grenzten sich von der Bewegung der Homosexuellen ab, da nach ihrer Erfahrung auch dort vorwiegend Männer das Sagen hätten. Erstmals traten Lesben nach aussen als selbstbewusst agierende Gruppe auf, sparten jedoch auch nach innen nicht mit Kritik an den bewegten Frauen. Sie hätten es satt, sagten beispielsweise Genferinnen, in Selbsterfahrungsgruppen immer das Jammern über die privaten Konflikte mit den eigenen Männern – «nos mecs» – zu hören oder nur über den straflosen Schwangerschaftsabbruch zu debattieren: «Ce n’est pas l’homosexualité qui nous réprime. C’est vous.» 53Längerfristig avancierten die Lesben in den Städten zum militantesten Kern der neuen Frauenbewegung. Sie waren entscheidend an der Entwicklung von autonomen sowohl hierarchie- als auch männerfreien Lebens- und Arbeitskulturen beteiligt. Sie sahen Lesbischsein bis in die späten 1980er-Jahre auch als politisches Programm und Frauenbeziehungen als befreiende Praxis. Bereits 1974 erkämpften sich Lesben in Zürich ein eigenes «Lesbenzimmer» im eben erst eröffneten Frauenzentrum an der Lavaterstrasse 4, wo zwei Arbeitsgruppen ab 1975 fast zeitgleich zwei neue Zeitschriften planten und gestalteten: die Lesbenfront (später Frau ohne Herz) mit scharfer Kritik an der gesamtgesellschaftlich dominierenden «Heterosexualität» zum einen, die Fraue-Zitig (später FRAZ) als Sprachrohr der verschiedenen thematischen Arbeitsgruppen zum andern, die beide weit über Zürich hinaus Verbreitung fanden. 54Von zwei abgegrenzten Strömungen zu sprechen, wäre allerdings verfehlt, vielmehr zeigten sich auch innerhalb der neuen Frauenbewegung Pluralitäten mit unterschiedlicher Akzentsetzung, selbst bei Themen mit gleicher Zielrichtung wie der Forderung nach «freier Abtreibung»: von der sexuellen Ausbeutung und Not ärmerer Frauen über die Selbstbestimmung und Verfügung über den eigenen Körper bis zur grundsätzlichen Ablehnung männlich definierter Praktiken der Sexualität.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Jeder Frau ihre Stimme»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Jeder Frau ihre Stimme» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Jeder Frau ihre Stimme» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.