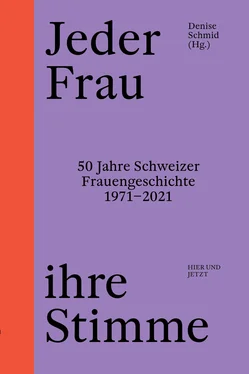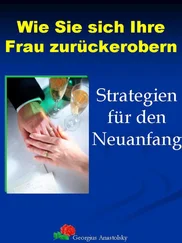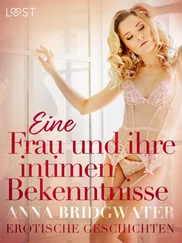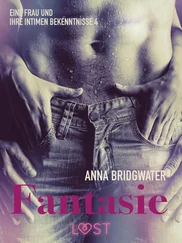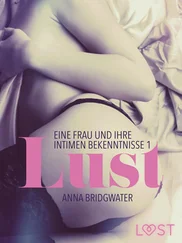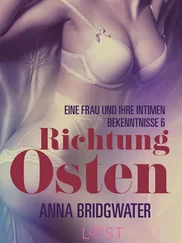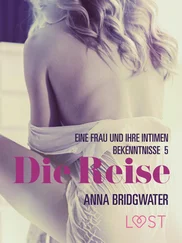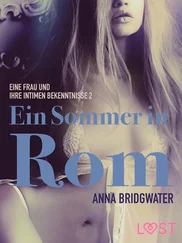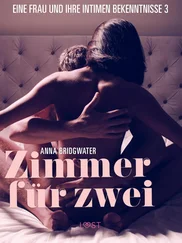Die späte Ausdehnung des Grundrechts auf Partizipation auf das weibliche Geschlecht ist Frauenorganisationen zu verdanken, die gegen das Ansinnen der Regierung, die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) unter Vorbehalten zu unterzeichnen, 1968/69 mit vehementem Protest – vom diskreten Lobbying bei Parlamentariern über den Grossanlass im Berner Kursaal bis zum Marsch nach Bern – reagiert hatten. Sie ist das Resultat eines Rekurses auf transnationale Rechtsverbindlichkeiten, konkretisiert in den völkerrechtlich garantierten Menschenrechten. Diese schreiben unmissverständlich das Diskriminierungsverbot und damit auch die Gleichheit von Frau und Mann fest. Auf dieses unverrückbare Prinzip bezog sich die spätere SP-Politikerin Emilie Lieberherr, als sie im März 1969 auf dem Bundesplatz im Namen der rund 5000 für das Frauenstimmrecht Demonstrierenden verkündete: «Nicht als Bittende, sondern als Fordernde stehen wir hier.» 35
Fordern, nicht bitten, das sagten ebenso die mehrheitlich jungen Frauen, die sich im Gefolge des 1968er-Aufbruchs zur «Frauenbefreiungsbewegung» formierten, welche erst im Laufe der 1970er-Jahre als feministisch definiert werden sollte. Unabhängig von Rechtsparagrafen verstanden sie sich als ausserparlamentarische Aktivistinnen, die sich auch ohne formelle Partizipationsmöglichkeiten über provokative Aktionen in den Medien Gehör zu verschaffen wussten. Nicht ums Mitgestalten ging es den «Neo-Feministinnen», so die Bezeichnung der Westschweizer Historikerin Sarah Kiani, sondern um die grundlegende Veränderung der Gesellschaft. Im Gegensatz zum Rekurs auf die abstrakte Ebene des Rechts verwiesen sie auf konkrete Lebenswelten, auf alltäglich erfahrene Abhängigkeiten. Diese zeigten sich in der unhinterfragten Nutzung der Arbeit, des Einkommens und des Körpers von Frauen, zementiert durch die ebenso formelle wie informelle Definitionsmacht männlicher Autoritäten. Diese alltäglichen Erfahrungen von Unterordnung und Ausbeutung waren nicht an Staatsgrenzen gebunden. Daher verstanden sich die widerständigen und aufbegehrenden jungen Frauen als Teil einer transnationalen sozialen Bewegung. Das grenzüberschreitende Mobilisierungspotenzial lag in der konkreten Forderung nach Abschaffung der Abtreibungsparagrafen im Strafrecht. Die Parole «freie Abtreibung» trieb von Frankreich über Deutschland bis Italien Frauen zu Tausenden auf die Strasse. Das Ziel dieser transnationalen, sich um die Abtreibungsfrage konstituierenden neuen Frauenbewegung war nicht die Integration in bestehende öffentlichrechtliche Strukturen politischen Handelns, sondern Autonomie: hierarchiefreie Räume des Denkens und Begehrens, die von keinen vorgegebenen Strukturen und Abhängigkeitsverhältnissen eingeschränkt würden.
Und: Das Stimmrecht war in diesem transnationalen Aufbruch von Frauen der späteren 1960er-Jahre kein Thema, sondern historische Reminiszenz – ausser in der Schweiz, präziser noch: der deutschen Schweiz. In den drei Westschweizer Kantonen Genf, Waadt und Neuenburg war das Stimmrecht schon seit Beginn der 1960er-Jahre Realität. Die Frauenstimmrechtsfrage hatte für das Mouvement de libération des femmes (MLF) keine Dringlichkeit mehr. Vielmehr sahen sie dessen Nutzen für die gesellschaftliche Umgestaltung als allzu beschränkt. «Das Frauenwahlrecht ist nicht genug» sprayte die Front des Bonnes Femmes am 7. Februar 1971 an Wände der Stadt Genf. 36Der Kampf um das Frauenstimm- und -wahlrecht sei passé, sagten auch die jungen Zürcher Feministinnen bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt im November 1968 im Schauspielhaus: «Auch wenn das Stimmrecht in einigen Jahren Realität sein wird, müssen wir erkennen, dass der Anspruch der Frauen auf Gleichberechtigung keineswegs erfüllt ist, dass damit nur eine formale Gleichstellung erreicht wird. […] Andere, direkte Kampfformen müssen gefunden und verwirklicht werden, die Aktionen müssen an den immer noch aktuellen Missständen im Leben der Frauen selbst ansetzen.» 37Es gehe um viel weiter reichende Forderungen, die das gesamte private, öffentliche, soziale und wirtschaftliche Leben tangierten, wie Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, die «himmelschreiende» Lohnungleichheit, die zivilrechtliche Diskriminierung im Vermögens- und Eherecht, auch um antiautoritäre Kinderbetreuung. Die Transnationalität und die staatskritische Haltung der Bewegung waren zusammen mit der Orientierung an lebensweltlichen Erfahrungen und dem Föderalismus mit seinen ungleichen Tempi in der Rechtssetzung mit ein Grund für das geringe Interesse der neuen Feministinnen an nationalstaatlich definierten Gesetzesverfahren, ja dafür, dass sie sich sogar mit provokativen Aktionen darum foutierten und sich von der vereinsmässig organisierten Frauenbewegung distanzierten, nicht selten in ignoranter Überheblichkeit.
Zwei Faktoren erzeugten in der Schweiz allerdings die nicht zu unterschätzende spezifische Wirkung, dass sich die in Vereinsstrukturen organisierte Frauenbewegung und die neue, über informelle Arbeitsgruppen, Aktionen und Demonstrationen agierende Frauenbewegung nach Einführung des Frauenstimmrechts 1971 in der Schweiz immer wieder gegenseitig dynamisierten: zum einen die Wechselwirkung zwischen der im Verhältnis zu anderen westlichen Staaten späten Umsetzung der rechtlichen Gleichstellung im Gesetz, und der Mobilisierungseffekt direktdemokratischer Instrumente zum anderen. Dieser Dynamisierungsprozess erwies sich als spannender als die gegenseitige Abgrenzung oder das Sprechen von zwei «Wellen». 38Er barg viel kreatives Potenzial in sich und brachte die Pluralität der Positionen und deren Schnittstellen zum Ausdruck. 39Diese zeigten sich im Befreiungsdiskurs, in Fragen der gesetzlichen Liberalisierung der Abtreibung, der Schaffung feministischer Beratungsstellen und Institutionen zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen, der Verankerung der Gleichstellung und des Mutterschaftsschutzes in der Verfassung und in der positiven Wertung von Frauenbeziehungen. Doch obwohl die Diskussion um die Ratifizierung der EMRK Ende der 1960er-Jahre der Einführung des Frauenstimmrechts den notwendigen Schub verlieh, kam den Menschenrechten trotzdem lange ein geringes argumentatives Gewicht zu, bei den jüngeren Feministinnen noch weniger als bei der älteren Generation von Frauenrechtlerinnen. 40
Geringe Gewichtung der Menschenrechte
Die Frauenrechtsbewegung der Schweiz war seit ihren Anfängen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in internationale Organisationsstrukturen eingebunden, die gleiche Rechte von Männern und Frauen mit unterschiedlichen Begründungen einforderten. Sie bezog sich in ihrer Argumentation weniger auf das Prinzip der «Gleichheit», sondern verwies weit häufiger auf die herrschende «Ungerechtigkeit». Es sei «ungerecht», dass Frauen und Männer nicht gleichermassen Einfluss auf die Gesetzgebung ausüben könnten und deshalb ebenso in Familie und Beruf diskriminiert seien, hiess es bereits um 1912 im ersten Flugblatt des Schweizerischen Verbands für Frauenstimmrecht (SVF). 41Noch nach dem Ja vom Februar 1971 hob die Waadtländer Juristin und langjährige Vizepräsidentin des SVF, Antoinette Quinche, rückblickend diese Argumentationslinie hervor: «Nous avons donc toujours mis l’accent sur l’injustice faite aux femmes.» 42
Vor dem Hintergrund, dass die in Vereinen organisierten Frauen in Kriegszeiten bedeutende Aufgaben zur Existenzsicherung von Familien in prekärer Lage übernommen hatten, legitimierte insbesondere in der deutschen Schweiz ein bedeutender Teil der Frauenrechtlerinnen ihren Anspruch auf staatsbürgerliche Mitbestimmung mit dem Argument, dass Frauen und Männer wegen ihrer sich ergänzenden Kompetenzen nicht lediglich im privaten Bereich zusammenarbeiten müssten. Nur so könnten Frauen analog zu den Männern die von ihnen zu leistenden Pflichten zum Wohle aller übernehmen. Wie die befürwortenden Parteien beschworen auch Frauenverbände oft ländlich geprägte Familienbilder kooperierender Paare, obwohl eine Mehrzahl der sich exponierenden Frauenrechtlerinnen alleinstehende Berufstätige wie Lehrerinnen oder Juristinnen waren. Diese sahen sich im Alltag immer wieder mit Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts konfrontiert und als «alte Jungfern» diskreditiert. Seit Langem war die enge Verknüpfung von «Rechten» mit «Pflichten» im männlich definierten Diskurs zum schweizerischen Milizsystem stark verankert. Er setzte demokratische Mitbestimmung, ehrenamtlichen Einsatz in politischen Gremien und Wehrpflicht weitgehend gleich. So untergrub die enge Verknüpfung von «Rechten» mit «Pflichten» das in den Menschenrechten festgeschriebene Diskriminierungsverbot, das keiner Vorbedingung bedarf. 43
Читать дальше