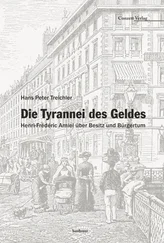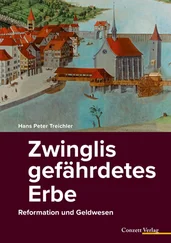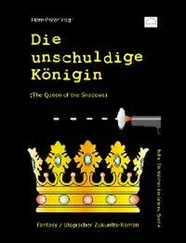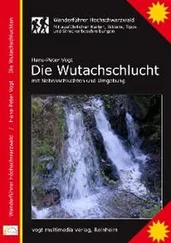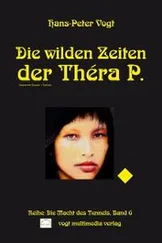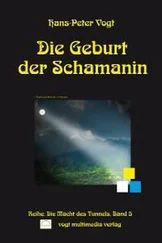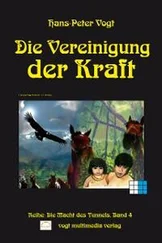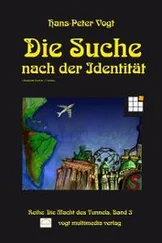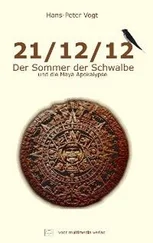Als Verena Knecht, spätere Conzett, mit 13 Jahren in einer Zürcher Seidenfärberei als Hilfsarbeiterin ihre erste Stelle antrat, machte sich im nahen Basel der dortige Professor für Klassische Philologie – mit einem Jahresgehalt von 3000 Franken – Gedanken über die Frage, was uns Heutige denn von den alten Griechen unterscheide: «Wir Neueren haben vor den Griechen zwei Begriffe voraus, die gleichsam als Trostmittel einer durchaus sklavisch sich gebarenden und dabei das Wort ‹Sklave› ängstlich scheuenden Welt gegeben sind: wir reden von der ‹Würde des Menschen› und von der ‹Würde der Arbeit›.» Friedrich Nietzsche, der hier über die Gesellschaft seiner Gegenwart nachdenkt, zögert nicht, den noch fast rechtlosen modernen Industriearbeiter mit dem antiken Sklaven zu vergleichen, der quasi eine blosse Sache in der Hand des ihn besitzenden Herrn war. Für reines Wortgeklingel hält Nietzsche es, von der «Würde der Arbeit» und der «Würde des Menschen» zu sprechen, während in Tat und Wahrheit der nur schlecht verhüllte Sachverhalt der Sklaverei vorliege. Diese Diagnose führt Nietzsche allerdings nicht zu klassenkämpferischen Parolen: Zwar glaubt er im Unterschied zu Papst Leo XIII. nicht an eine «unveränderliche Ordnung der Dinge», hält aber dennoch die Fronarbeit von Sklaven für eine notwendige Basis grosser Kultur.
Diese politisch reaktionäre Auffassung, die Nietzsche später überwunden hat, war freilich schon damals keine längerfristig erfolgversprechende Option. Vielmehr wurde grundsätzlich die Notwendigkeit eingesehen, die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft zu verbessern. Auch in einem Obrigkeitsstaat wie dem Deutschen Reich bescherten die Sozialreformen Bismarcks der Arbeiterschaft zunächst eine Krankenversicherung, dann eine Unfall- und schliesslich eine Rentenversicherung, die zu einer schrittweisen Verbürgerlichung der Industriearbeiterschaft führten. Diese Verbesserungen wurden nicht durch eine Revolution von unten erreicht, etwa durch die Enteignung der Kapitaleigentümer, sondern durch den Ausgleich der Interessen zwischen der Arbeiter- und der Arbeitgeberschaft. Gesellschaftlich-politische Initiativen, wie sie Verena Conzett sowohl in Interessensgruppierungen wie dem Schweizerischen Arbeiterinnenverband und dem Schweizer Arbeiterbund als dann auch in ihrem Unternehmen entfaltete, waren wegleitend.
Das Arbeiterinnenschicksal des 19. Jahrhunderts ist uns fremd geworden, weil wir uns kaum vorstellen können, wie wenig Freiräume dieses Schicksal der eigenen Lebensgestaltung liess. Zwar war es im rechtlichen Sinne keine Sklaverei, Fabrikarbeiterin zu sein, aber die scheinbare Freiheit, jederzeit kündigen zu können, war keine echte Freiheit, denn die Alternative zur Fabrikarbeit hiess Hunger und Not. So bestand zwar kein rechtlicher, aber ein ökonomischer Zwang, auf dem Posten zu bleiben. Im Blick auf solche Verhältnisse liesse sich sagen, dass Sklaverei in einem weiteren Sinne des Wortes erst dann abgeschafft wäre, wenn wir wirklich über die eigene Zeit verfügen können. Das 20. Jahrhundert hat in Mitteleuropa der durchschnittlichen «Arbeitnehmerin» gewiss positive Veränderungen gebracht, gerade verglichen mit den bescheidenen Verbesserungswünschen der Arbeiterinnen des späten 19. Jahrhunderts: ein paar Rappen mehr Lohn, ein freier Samstagnachmittag, etwas weniger als 13 Stunden tägliche Arbeitszeit. Die Wünsche der Menschen sind während der vergangenen 150 Jahre kontinuierlich gewachsen, damit auch ihre Erfüllungschancen: Niemand muss mehr im Alter von 13 Jahren eine Fabrikanstellung antreten oder eine 100-Stunden-Woche absolvieren. Der Traum der Verbürgerlichung, der damalige Arbeiterinnen umtrieb, ohne dass er wie bei Verena Conzett in Reichweite rückte, hat sich für viele ehemalige «Proletarier» verwirklicht. Der Rahmen, innerhalb dessen wir über unsere eigene Zeit verfügen können, ist stetig gewachsen. Wir können heute den Traum der Individualisierung träumen und ihn uns mindestens teilweise erfüllen, selbst wenn wir kein Erwerbseinkommen haben, sondern uns auf die sozialen Sicherungssysteme verlassen (müssen).
Aber die Frage bleibt, ob wir tatsächlich allen Zwängen entronnen sind. Sind wir nicht immer noch gezwungen, unsere Zeit mit Dingen zuzubringen, die wir vielleicht nicht tun wollen? Die Vergegenwärtigung der vergangenen Arbeiterinnenschicksale dient – neben dem Interesse, das sie um ihrer selbst willen verdienen – auch wesentlich dazu, uns bewusst zu machen, wie weit gesteckt unsere Freiheitsspielräume sind. Wir sollten uns fragen, was wir mit der Zeit machen, von der uns jetzt so viel mehr zur freien Verfügung steht als unseren Ahninnen und Ahnen. Begeben wir uns womöglich freiwillig in andere Knechtschaften – indem wir die Zeit beispielsweise mit Fernsehen oder im Internet vertrödeln? Und tun wir das, was wir tun, weil wir es tun wollen, oder tun wir es nur, weil wir es aus ökonomischen Gründen tun zu müssen glauben? Keine unwesentliche menschliche Aufgabe ist es, die Welt, in der man leben will, mitzugestalten – für andere und für sich selbst Freiräume zu schaffen.
Andreas Urs Sommer
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.