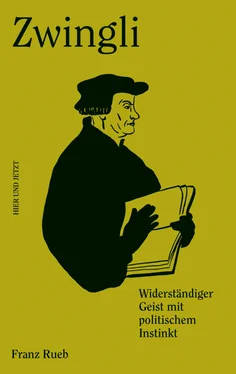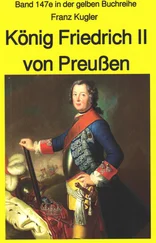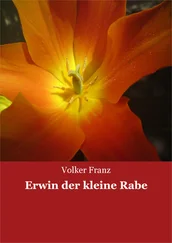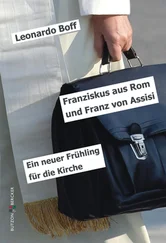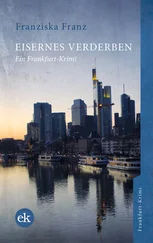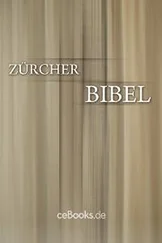Verblüffend ist ebenso, wie früh und engagiert Ulrich Zwingli sich mit dem Zustand seines Vaterlandes befasste, wie klar seine Haltung und Position zu den haarsträubenden Problemen des Landes sich geformt haben, obwohl er noch immer ein Anhänger des Papstes war und sich seine Katholizität noch in keiner Weise aufgeweicht hat. Die Tagsatzung hat mehrmals über die Jahre den Solddienst verboten, davon war der Papst aber immer ausgenommen, ohne dass sich Zwingli daran gestört hätte. Er gibt dem Hofhund in seinem vaterländischen Gedicht eine äusserst wichtige Rolle, der Hund nimmt die Rolle des Geistlichen ein, der wachsam ist, der bellt, wenn Gefahr in Sicht ist. Er hat also schon da, 26-jährig, vom Amt des Geistlichen eine Auffassung und Haltung, die es ihm verbietet, zu schweigen, sich zu ducken, sich zu verdrücken, wenn Verführer sich im Land ausbreiten. Dieser Mann ist schon ganz früh nicht nur ein äusserst kritischer Geist mit fundierter Bildung, er ist ein politischer Zeitgenosse, ein politischer Kopf, und es drängt ihn, die Vorgänge zu analysieren und seine Analyse seiner Umwelt mitzuteilen. Wir können davon ausgehen, dass er die Haltungen und Ansichten auch in seine Kanzelreden eingeflochten hat. Auffallend ist vor allem auch, dass in dem grossen Fabelgedicht nicht der geringste konfessionelle Ton oder Gedanke angeschlagen wird. Selbst in der Moral von der Geschichte am Ende kommt nichts Derartiges auf.
Doch Zwingli befasst sich zwei Jahre später, in einem grösseren Feldzugsbericht 1512, wieder mit der Reisläuferei der Eidgenossen in die Lombardei. Es ist nicht klar, ob das Dokument ein Erlebnisbericht ist, das heisst, die Zwingli-Forschung streitet, ob der Autor dabei war als Feldprediger oder ob er wiedergibt, was ihm erzählt wurde. Allerdings ist die Reportage so detailliert, so anschaulich und teilnehmend geschildert, dass kaum daran zu zweifeln ist, so kann nur ein Zeuge berichten.
Jedenfalls, der Papst hatte sich inzwischen mit Spanien und Venedig in der Heiligen Liga zusammengeschlossen, um nach wie vor die Franzosen aus Italien zu vertreiben. Der Bericht von Zwingli ist farbig, teils geradezu lustig. Eine grundlegende kritische Haltung im Geiste seiner Fabel ist hier kaum vorhanden, wohl weil der Verfasser die Taten seiner Eidgenossen im Interesse des Papstes begriff. Der Wortführer für die Sache Roms ist der Walliser Kardinal Schiner, der den Dienst am Christentum gegen den französischen König ins Zentrum rückte. Nach Schiner ging es um die Angelegenheiten der Kirche und um die Ordnung in Italien. Das war natürlich eine Verschleierung der politischen Realität.
Von Schiners umsichtigem politischen Interesse im Lande erzählt der Autor Emanuel Stickelberger: wie Kardinal Schiner Zwingli in Glarus besuchte, wie er vorher in der Wirtschaft die Bauern und Handwerker mit Bewunderung von Zwingli sprechen hörte, wie er ihn aufsuchte, im Garten bei einer Musikprobe aufstöberte, wie er dann ein abendliches intensives Gespräch unter Humanisten mit dem Landpfarrer führte, über die Kirche, über Gott und die Welt, über den Papst, die Franzosen und die Kronenfresser, die Glarner Pensionäre, über die griechischen und lateinischen Dichter und Philosophen. Der Papstfreund Schiner warb um den aussergewöhnlichen Geistlichen, wollte ihn für die päpstlichen Interessen gewinnen, als Werkzeug für die Pläne des Heiligen Stuhles in Rom.
Seit mehr als 100 Jahren waren die Eidgenossen auf der ganzen Linie siegreich, wo sie an einem Krieg teilnahmen. Sie galten in Europa als Musterkrieger. Der Zwingli-Biograf Oskar Farner spricht in diesem Fall von «Kriegs-Theologie in fragwürdigem Sinne». Denn der Glarner Kirchherr sei «völlig hineingerissen in das Kraftgefühl der Grossmachtpolitik, wie sie die Eidgenossen nunmehr eingeschlagen haben». Vergessen schienen das grosse kritische Gedicht über die Mächte in Europa und sein Aufruf nach Bescheidenheit der Eidgenossenschaft.
Natürlich, der Kurie war die Parteinahme des Glarner Kirchherrn hoch willkommen, sie belohnte den jungen Geistlichen mit einer päpstlichen Pension. Der Hauptmann des Glarner Haufens bot ihm in Pavia ein Landgut an, in welches er sich ein Jahr oder länger hätte zurückziehen können. Zwingli dachte aber nicht daran, sein Hirtenamt zu verlassen. Auch die Franzosen boten ihm ein Jahrgeld an, doch hat er es ausgeschlagen. Die päpstliche Pension schlug Zwingli erst 1520 definitiv aus, als er bereits in Zürich war.
Nun, Geschenke des Kaisers und des Papstes waren nach allgemeiner Sitte erlaubte ehrenvolle Auszeichnungen. Darum betrafen die Verbote von Pensionsgeldern nur solche von Fürsten. Zwingli selbst sagte darum 1526, er sei sein Leben lang von Pensionsgeldern unbefleckt geblieben, ausser von päpstlichen. Deswegen fühlte er sich nicht zur Entschuldigung ermahnt.
Eigenartig ist, dass nach dieser Vorgeschichte von Zwinglis Beschäftigung mit der eidgenössischen Politik ein so gewaltiges Ereignis wie die Schlacht von Marignano in seinem Leben kaum Erwähnung fand. War er nun als Feldprediger in Marignano dabei? Hat er seine Glarner Kämpfer tatsächlich begleitet? Es gibt von ihm keine persönliche Erwähnung dieses so wichtigen, ja schwerwiegenden Falles, es gibt keine Briefzeile darüber, jedenfalls ist keine erhalten. Nie geht Zwingli auf diese gigantische, schmählich verlorene Schlacht ein. Man muss doch annehmen, dass sie einem Teilnehmer, und sei er nur Beobachter gewesen, als traumatisches Erlebnis stets in Erinnerung geblieben ist. Oder war er gar nicht Beobachter der Schlacht?
Der französische König wollte Mailand zurückerobern, mit Schweizer Söldnern, und der Papst wollte es wieder befreien, auch mit Schweizer Söldnern. Mailand war eine Stadt, die 100 000 Einwohner zählte. Die einwohnerstärkste Stadt auf Schweizer Boden war damals Basel mit 10 000 Bewohnern.
Am 6. September 1515 kamen die Schweizer Truppen in Lonza an. Zwei Tage später predigte Zwingli seinen Glarner Landsleuten auf dem Marktplatz in Lonza kurz vor der vernichtenden Niederlage, ermahnte sie zur Einigkeit und zur Treue zum päpstlichen Bündnis. Es gibt einige Zeugen für Zwinglis Anwesenheit in Marignano. Doch von ihm selbst ist kein Wort aufzufinden.
Da die Tagsatzung, die damalige Zusammenkunft der führenden Männer der eidgenössichen Orte, das Söldnerproblem nie in den Griff bekam, war es möglich, dass im französischen Heer eine stattliche Zahl Schweizer Söldner gegen die eigenen Landsleute kämpfte. Dem jungen König Frankreichs mit Namen Franz gelang es, das eidgenössische Heer zu spalten. Er bot den Schweizern 700 000 Kronen, wenn sie ihm das Herzogtum Mailand überliessen. Daraufhin zogen rund 10 000 Mann aus Bern, Solothurn, Freiburg und dem Wallis ab und kehrten nach Hause zurück, was durchaus ein Verrat an der Eidgenössischen Tagsatzung war. Doch diese reagierte nicht.
Nun waren die Franzosen zahlenmässig in noch weit stärkerer Übermacht. Die Gegner hatten viel mehr Artillerie, also Kanonen, und weit mehr Krieger. Die Eidgenossen verloren in der folgenden Schlacht mehrere Tausend Mann. Die eidgenössischen Krieger setzten auf die falschen Kriegsmittel, sie waren mit ihren Hellebarden waffentechnisch unterlegen und wurden zudem taktisch übertölpelt. Aber sie hatten auch keine Einigkeit, keine Moral, keine Disziplin, noch konnten sie sich auf ihre übliche Schlagkraft verlassen. Das föderalistische System der Eidgenossenschaft, das muss man so sagen, war Nährboden für Gespaltenheit. Die Gier nach Eroberungen und nach Beute der Krieger lockte sie zu militärischen Ausschweifungen nach Oberitalien. Sie wurden grossmachtsüchtig und sie rannten fast blind ins Verderben. Unter den Schweizer Söldnern drohte sogar ein Bruderkrieg.
Zwingli hatte wohl gegen die Spaltung des eidgenössischen Heeres gepredigt, wie der Zuger Ammann Werner Steiner als Chronist festhielt. Hätte man auf Zwingli gehört, wäre diese Katastrophe nicht über die Schweizer hereingebrochen, meinte der Chronist.
Читать дальше