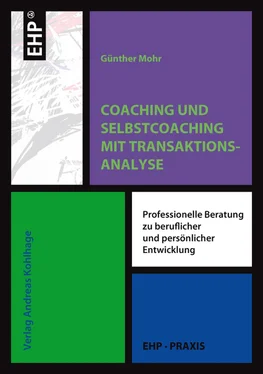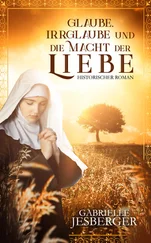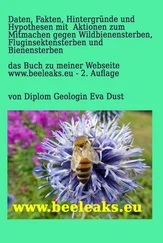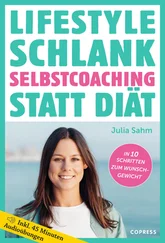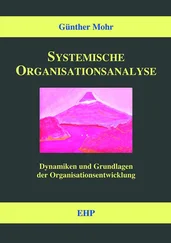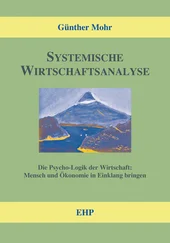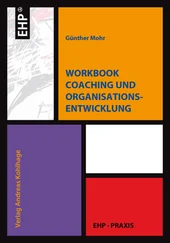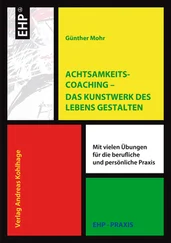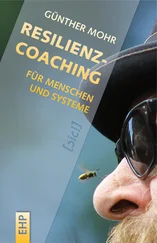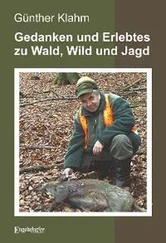| 3.8 |
Trauer – das unregistrierte Alltagsgefühl |
| 3.9 |
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit – zwei zentrale Gefühle in Veränderungsprozessen |
| 3.10 |
Macht und Gefühl |
| 3.11 |
Der Lebensstrom im Alltag, in Krisen und in der Entwicklung |
| 3.12 |
Der Lebensstrom in der Begegnung zwischen Menschen |
| 3.13 |
Die Aufgaben im Coaching |
| 3.14 |
Generationenübergreifende Gefühle |
| 3.15 |
Fundamentalinterventionen im Coaching |
| 3.16 |
Im Coaching den inneren Beobachter schulen |
| 3.16.1 |
Wissen um das eigene Persönlichkeits»kostüm« |
| 3.16.2 |
Der »Entscheider« |
| 3.16.3 |
Der »Beobachter« |
| 3.16.4 |
Der Zugang des »inneren Körpers« |
| 3.16.5 |
Praktische Tipps zur Wahrnehmungsschärfung im Coaching |
|
|
| 4. |
Organisationale Kompetenz – Systemisches Coaching |
| 4.1 |
Systembegegnung |
| 4.2 |
Systemannäherung |
| 4.3 |
Systemankoppelung |
| 4.4 |
Formulierte Coachinganlässe |
| 4.4.1 |
Die Beziehung Führungskraft–Mitarbeiter |
| 4.4.2 |
Die Beziehung zum Unternehmen |
| 4.4.3 |
Die Beziehung der »Führungskraft« zu sich selbst |
| 4.5 |
Coachingperspektiven |
| 4.5.1 |
Die Perspektive des Führungssystems |
| 4.5.2 |
Die Perspektive der Rolle |
| 4.5.3 |
Die Perspektive der Persönlichkeit |
| 4.6 |
Coaching unter Nutzung der Rollen-Perspektive |
| 4.6.1 |
Organisationsrollen, Professionsrollen, Privatrollen, Gemeinwesenrollen |
| 4.6.2 |
Rollenperspektive und Veränderungsrichtung |
| 4.7 |
Systemdynamiken |
|
|
| 5. |
Coaching bei verdeckten Ebenen – Aufmerksamkeitsteuerung |
| 5.1 |
Das Unbewusste |
| 5.2 |
Aufmerksamkeit |
| 5.3 |
Lernprozesse verändern den Aufmerksamkeitsgrad |
| 5.4 |
Die Dimensionen des Unbewussten |
| 5.4.1 |
Der unbewusste Alltag |
| 5.4.2 |
Unbewusste Illusionen |
| 5.4.3 |
Unbewusste Lebensplanziele und Übertragung |
| 5.4.4 |
Der unbewusste Lebensstrom |
| 5.5 |
Theoretische Modelle des Unbewussten |
| 5.6 |
Coaching und das Unbewusste |
| 5.6.1 |
Klassische tiefenpsychologische Ansätze |
| 5.6.2 |
Hellinger-Arbeit und Aufstellungen |
| 5.6.3 |
Ericksonsche Arbeit |
| 5.6.4 |
Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP) |
| 5.7 |
Das Unbewusste der Organisation |
|
|
| 6. |
Praxis I: Diagnostik, Phasen, Interventionen und Wirkung |
| 6.1 |
Diagnostik im Coaching |
| 6.2 |
Prozessdiagnose |
| 6.3 |
Phasen und Grundfiguren der Coachingintervention |
| 6.4 |
Coaching-Interventionen in der Kontaktphase |
| 6.5 |
Coaching-Interventionen in der Inhalts- und Konfliktphase |
| 6.6 |
Coaching-Interventionen in der Konsolidierungsphase |
| 6.7 |
Coaching-Interventionen in der Resultatsphase |
| 6.8 |
Auswirkungsebenen des Coachings |
| 6.9 |
Die Kriterien guten Coachings |
|
|
| 7. |
Praxis II: Detailarbeit – Coaching des Verhaltens |
| 7.1 |
Arbeit mit dem Häusermodell |
| 7.2 |
Psychologische Beratung im Unterschied zu Therapie |
| 7.3 |
Coaching im Beziehungsverhalten |
| 7.4 |
Anwendungen im Veränderungsbereich »Beziehung« |
| 7.4.1 |
Veränderung in der Kommunikation |
| 7.4.2 |
Veränderung in der Konfliktbewältigung |
| 7.5 |
Coaching und der Veränderungsbereich »Verhalten« |
| 7.6 |
Der Siegeszug der Verhaltenstherapie im Management |
| 7.7 |
Veränderungsbereich »Verhalten« im einzelnen |
| 7.7.1 |
Aufbau von Verhalten |
| 7.7.2 |
Abbau von Verhalten |
| 7.7.3 |
Steuerung durch kognitive Verhaltensregeln |
| 7.7.4 |
Selbstkontrolltechniken – Eigensteuerung von Verhalten |
| 7.8 |
Ein möglicher Prozessablauf |
| 7.9 |
Abschließendes zur Detailarbeit |
|
|
| 8. |
Praxis III: Coachinggruppen in Unternehmen |
| 8.1 |
Beispiel für Coachinggruppen: »Praxisberatung Führung und Management« |
| 8.2 |
Die Organisation der Coachinggruppen |
| 8.3 |
Die Themen in den Coachinggruppen |
| 8.4 |
Coaching als Supervision der Führungskraft |
| 8.5 |
Methodische Instrumente |
| 8.6 |
Resonanz der teilnehmenden Führungskräfte |
| 8.6.1 |
Nutzen |
| 8.6.2 |
Arbeitsweise der Praxisberatung (Supervision) |
| 8.7 |
Prinzipien einer Inhouse-Coachingstelle |
|
|
| 9. |
Praxis IV: Das Entwicklungspentagon der Kompet |
| 9.1 |
Das Entwicklungspentagon der persönlichen Sozialkompetenz |
| 9.1.1 |
Lernkompetenz |
| 9.1.2 |
Gefühlskompetenz |
| 9.1.3 |
Motivationskompetenz |
| 9.1.4 |
Vertriebskompetenz |
| 9.1.5 |
Supportkompetenz |
| 9.2 |
Einwände gegen das Entwicklungspentagon der Sozialkompetenzen |
| 9.3 |
Abschließendes zur Zielbestimmung |
|
|
| 10. |
Theoretischer Ausklang: Muster |
| 10.1 |
Musterbildung |
| 10.2 |
Nutzen von Mustern |
| 10.3 |
Das Vier-Türen-Modell: Entwicklung und Veränderung von Mustern |
| 10.3.1 |
Muster konstruieren |
| 10.3.2 |
Wahlfreiheit zwischen Mustern erhöhen |
| 10.3.3 |
Vom Muster zum Fluss |
| 10.3.4 |
Musterfreiheit |
| 10.4 |
Musterperspektiven |
| 10.5 |
Das Sechs-Fenster-Modell: Diagnoseebenen bei Mustern |
| 10.5.1 |
Neuronale Muster: Die Hardware und der Kleber |
| 10.5.2 |
Visuelle Muster: Von Yves Klein-Blau und von Marken |
| 10.5.3 |
Auditive Muster: Die Welt ist Klang |
| 10.5.4 |
Bewegungs- und Verhaltensmuster: Typisches |
| 10.5.5 |
Beziehungs- und Systemmuster: Interpersonale Resultate |
| 10.5.6 |
Professionsmuster |
| 10.6 |
Abschließendes |
Literatur
Wem ist nicht zu danken, wenn man ein Buch schreibt: dem, der das Haus gebaut hat, in dem man jetzt sicher und warm arbeiten kann; dem, der die Nahrung hergestellt hat, die man verzehrt; dem, der einen etwas gelehrt hat und so weiter und so fort. Nichts entsteht ohne viele, viele andere Menschen, die heute und früher gelebt haben.
Dennoch will ich einige speziell erwähnen. Dieses Buch wäre nicht möglich gewesen ohne die Anregungen, die ich durch tägliche praktische Arbeit als Coach erfahren habe. Coaching ist Entwicklung und Lernen. Dies hört nie auf, auch für den Coach nicht.
Читать дальше