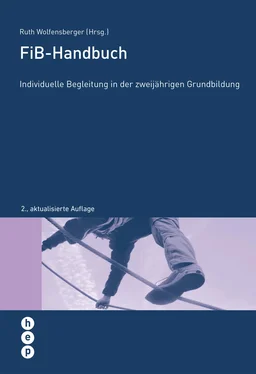«Resilienz» – ein fragwürdiges, ja gefährliches Konzept?
Hiller vertritt die These, dass die individualistisch psychologisierenden Konzepte von Resilienz der vereinfachenden und verheerenden Aussage Vorschub leisten, es gäbe eben Jugendliche, denen nicht mehr zu helfen sei. Dies insbesondere dann, wenn Resilienz als personale Eigenheit oder biogenetische Disposition verstanden werde. Sicher gibt es Menschen, denen gesundheitsgefährdende Verhältnisse weniger anhaben können als anderen, die Krankheiten und Unfälle ohne Beeinträchtigungen überstehen, während andere daran zugrunde gehen. Das ist aber, laut Hiller, auch in der Medizin kein Grund, Trainingsprogramme zur Stärkung der subjektiven Widerstandsfähigkeit gegen gesundheitliche Risiken zu entwickeln.
Die Mediziner machen ihre Arbeit, ohne sich zu fragen, bei welchen Patienten sich die Arbeit eher lohnt, weil sie aufgrund einer angeborenen oder kultivierten Widerstandsfähigkeit gesünder weiterleben als andere. Es gilt dort, Leben zu retten oder Leiden zu mindern, ohne danach zu fragen, ob und wie lange ein Patient die Intervention überlebt und ob oder wie sich dessen Resilienzprofil durch die Behandlung verändert. Das Resilienzkonzept geht von einer gefährlichen Ursache-Wirkungs-Theorie aus. Denn davon, dass unsere pädagogischen Bemühungen Erfolg zeigen, dass sich unsere Anstrengungen bei den Jugendlichen in Widerstandsfähigkeit umwandelt oder manifestiert, können wir keinesfalls ausgehen.
Wenn wir von biogenetischer Disposition ausgehen, dann ist die Gefahr gross, dass wir all jene fallen lassen, die eben nicht mit den erhofften Resultaten aufwarten können, die zum Beispiel mit geringen kognitiven Fähigkeiten, emotionaler Instabilität, unzureichender Sozialkompetenz oder anderen Beeinträchtigungen leben müssen. Hiller sagt meines Erachtens zu Recht, dass sich meist erst im Nachhinein feststellen lässt, wer jetzt traumatische Erlebnisse, Krisen und Katastrophen besser und mit weniger Schaden überstanden hat. «Da daraus prognostisch nichts folgt», sagt er, «ist es zweckmässiger, solche Befunde als glückliche Zufälle zu interpretieren; sie haben keinerlei Bedeutung, weder für die Theorie noch für die Praxis einer Pädagogik, die um die prinzipielle Unverfügbarkeit ihrer Bemühungen weiss und die deshalb ausdrücklich darauf verzichtet, ihre Investitionen nach Massgabe messbarer Zuwächse an erwünschten Wirkungen bei ihren Adressaten zu kalkulieren und zu dosieren. Folglich kann das Resilienzkonzept weder die theoretischen noch die praktischen Bemühungen um Jugendliche und junge Erwachsene in riskanten Lebenslagen sehr viel weiter bringen.»
Es ist jedoch klar, dass Unterstützungs- oder Arbeitsbündnisse mit jungen Menschen, die im Elend aufwachsen müssen, nötig sind.
Hiller bietet daher ein interessantes Modell an, das er an die Stelle pädagogischer «Resilienztrainings» stellt. Er argumentiert mit den Soziologen Adorno und Luhmann, die das Ziel der «integrierten Persönlichkeit» infrage stellen, weil es (unter anderem) «dem Individuum jene Balance der Kräfte zumutet, die in der bestehenden Gesellschaft nicht besteht und auch gar nicht bestehen sollte, weil jene Kräfte nicht gleichen Rechtes sind.» Hiller bietet dafür «biophile Allianz» an.
Vergegenwärtigung und biophile Allianz
Was ist also zu tun, wenn wir uns nicht mehr auf die Zielvorstellung der stabilen, gesunden Persönlichkeiten, der unauffälligen Entwicklung und der erfolgreichen Integration verlassen sollen? Hillers Antwort:
«Mit pluralen Verhältnissen tatsächlich rechnen, Überraschungen zum Metier machen, pädagogische Erlösungs-, Verbesserungs- und Steigerungsphantasien als theoretisch wie praktisch hinderlich begreifen und sich eingestehen, dass bei dem Versuch, aus Problemkindern und schwierigen Jugendlichen bessere, tauglichere Menschen machen zu wollen, sie also möglichst weitgehend zu «fördern», um sie zu «normalisieren», bei Lichte besehen nicht viel mehr herauskommen kann, als unauffällige, belanglose, langweilige Serientypen.»
Hillers radikale Sichtweise ermöglicht uns, einen Schritt zurückzutreten, unsere Interessen zu überdenken und schliesslich den Jugendlichen in brisanten Lebenslagen eine Art Mentorat, eine Begleitung oder eine «förderliche Komplizenschaft» auf Zeit anzubieten. Dies ist ein neuer Ansatz, wenn wir die Aufgaben und Ziele der fachkundigen individuellen Begleitung überdenken.
Hiller erörtert ausführlich auch die Idee, sich nicht mehr auf ganzheitliche Persönlichkeitsbildung einzuschiessen, mit dem Ziel, allseitig entfaltete, gut integrierte Persönlichkeiten zu «schaffen». Dafür bezieht er sich auf das Konzept der «Teilkarrieren». Die Erläuterung des ganzen Konzepts ist bei Hiller nachzulesen – er bezieht sich unter anderen auf Luhmann und Bourdieu. – Ich beschränke mich auf einen rudimentären Hinweis, da mir das Konzept bestechend scheint und im Ansatz zumindest diskussionswürdig und Diskurs fördernd für Beratende und Begleitende.
Sich als begleitende Person auf ein Co-Management von Teilkarrieren einzulassen, würde bedeuten, dass wir akzeptieren, dass die Jugendlichen im Alltag Teilkarrieren in folgenden Lebensbereichen durchlaufen:
›Ausbildung/Beschäftigung
›Finanzen
›Legalität
›soziale Beziehungen, soziales Netz
›Gesundheit
›Zeitmanagement
›Umgang mit Ämtern, Behörden etc.: Zivilkompetenz
›Aufenthalt/Wohnung
Wenn man also die Vorstellung aufgibt, Menschen handelten immer als autonome Subjekte und gestalteten ihr Leben selbstverantwortlich und ganzheitlich, dann wird es möglich, die einzelnen Bereiche oder eben «Teilkarrieren» entsprechend fraktioniert auf Gelingen oder Nichtgelingen hin zu untersuchen und förderlich zu unterstützen oder zu «co-managen».
So ist es den Jugendlichen möglich, in einigen Alltagsbereichen Erfolge zu verzeichnen und Ressourcen zu orten, was zumindest den Eindruck und das entsprechende Glücksgefühl oder die Befriedigung vermittelt, nicht generell als Person zu versagen, sondern Teile des Alltags im Griff zu haben und mehr oder weniger erfolgreich zu bewältigen. Die Begleitung ist dann eine pragmatische Alltagsbegleitung, die dem/der Begleiter/in oder Co-Manager/in mit zunehmender Erfahrung Kenntnisse und Netzwerkwissen in verschiedensten Alltagsbereichen einbringt; im schuleigenen Fördernetzwerk, in der entsprechenden Berufsbildung, im Asylrecht, in der Schuldenberatung, bei Arbeits-, Sozial-, Jugend- und Ausländerämtern, bei diversen Fachstellen, Stipendienämtern, Therapeut/innen, Ärzt/innen und Opferhilfestellen, um nur einige zu nennen. Der Begriff des Co-Managements suggeriert bewusst, dass da jemand ist, der/die das Management übernimmt, das heisst, dass die oder der Jugendliche zumindest einige seiner Teilkarrieren selbst steuert oder nach einer befristeten Hilfe wieder selbst managt.
Dies scheint mir als Aufgabe anspruchsvoll genug. Ob unser Einsatz fruchtet, ob er im ökonomischen Sinn etwas bringt, bleibt dahingestellt. Wir müssen nur überzeugt sein, dass er in diesem Augenblick wichtig und nützlich ist.
In diesem Sinn möchte ich noch ein längeres Zitat Hillers (2006) anfügen, das die biophile Allianz sehr schön beschreibt.
«... sich kontinuierlich und auf lange Sicht mit Gelassenheit, Geistesgegenwart und Kompetenz, also einfallsreich und humorvoll-flexibel auf Jugendliche und junge Erwachsene einlassen, die in Schwierigkeiten stecken, sie ertragen und aushalten, ihnen Chancen zuspielen und ihnen die Gewissheit vermitteln, dass sie auf uns zählen können, komme, was da wolle; kurz und knapp eine ‹biophile Allianz› mit ihnen eingehen, in einem beiderseitigen Lernprozess dem ‹Leben aufhelfen› (Jürg Jegge 1986) und sich dabei stets neu überraschen lassen, – so lässt sich eine Pädagogik umreissen, die ihre theologischen Eierschalen und ihre teleologische Verbissenheit abgestreift hat: Sie hält sich an die Maxime des Predigers aus der hebräischen Bibel: ‹Tu deine Arbeit, denn du weißt nicht, ob sie dir gelingt› (Pred.11,6). Ob und wie lange Kinder und Jugendliche, die Zutrauen fassen und sich auf Arbeitsbündnisse mit uns einlassen, weil wir für sie verlässlich erreichbar bleiben und uns von ihnen auch dann nicht abwenden, wenn es ganz schwierig wird, ob solche junge Menschen irgendwelche Widerstandskräfte von welcher Qualität und Stabilität auch immer ausbilden, oder ob sie sich – trotz unserer Bemühungen und Warnungen – auf bisweilen aberwitzige Weise selbst erproben, sich dabei gefährlich aufs Spiel setzen und im Extremfall zugrunde gehen (vgl. dazu Schroeder 2005), das bleibt unserer Verfügbarkeit entzogen: ‹Erziehung ist keine handhabbare Ursache, die kontrollierbare Wirkungen hervorbringt (Oelkers 1990)›.»
Читать дальше