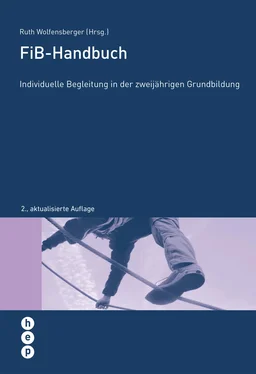Wer früh und konstant die Erfahrung gemacht hat, dass Krisen vorübergehen können und dass man sich Hilfe holen kann, hat entschieden bessere Voraussetzungen, schwierige Lebenssituationen zu meistern.
Wenn dieser Prozess von Vertrauenspersonen aus Familie, Freundeskreis oder Berufsfeld begleitet wird und wenn Erwachsene vorhanden sind, die ein Rollenmodell liefern, bergen diese Entwicklungsschritte sehr viel Potenzial; wenn Jugendliche aber in einem instabilen Umfeld leben, mit Eltern oder Bezugspersonen, die – falls überhaupt vorhanden – nicht belastbar oder selbst bedürftig und labil sind, ist oft die nötige Kraft und Energie für diese Festigung und Stabilisierung der Persönlichkeit nicht vorhanden. Es erstaunt immer wieder, welche Rollen Jugendliche in ihrem familiären Umfeld übernehmen müssen. Die Betreuung kleinerer Geschwister, alkoholkranker, abhängiger oder depressiver Eltern, Ersatzfunktion für einen fehlenden Partner eines Elternteils oder Vermittler/in bei permanenten Kämpfen und Streitereien. Nicht zu unterschätzen sind auch intrafamiliäre oder als Abgrenzung gegen aussen ausgetragene kulturelle Differenzen. Wo radikale religiöse oder kulturelle Vorstellungen aufeinanderprallen, stehen die Jugendlichen oft hilflos zwischen den Fronten. Sie fühlen sich nicht nur allein, sie sind es auch. Da hilft kein facebook oder Instagram; auch wenn fast alles öffentlich wird, ist die persönliche Einsamkeit und Isolation der Jugendlichen zum Teil gross. Wenn dann Probleme mit dem Alleine-Wohnen, Schulden, Abhängigkeiten, gesundheitliche Probleme, Straffälligkeit und anderes mehr dazukommen, braucht es Hilfe von aussen.
integrieren
Für Jugendliche mit Migrationshintergrund kommen noch einige zusätzlich erschwerende Faktoren dazu: Die Verpflanzung in ein neues Land, in eine neue Kultur und neue Wohnverhältnisse, das Kommunizieren in einer fremden Sprache, die Gewöhnung an andere Gepflogenheiten und Konventionen, die dem Gewohnten manchmal diametral entgegenstehen, neue Erwartungen, fremde (Gender-)Rollen, eine neue Peergruppe, die Gefahr, ausgegrenzt zu werden, anders zu sein. Generationenkonflikte entstehen, da sich die Jugendlichen oft schneller und stärker integrieren wollen, als es die ältere Generation verkraftet. Ernährungsgewohnheiten, Religion, Politik und Freizeitmöglichkeiten, Freundeskreis, neu erlebte Freiheiten und kulturelle Werte werden zu Konfliktstoff in den Familien.
Die Akkulturation wirkt sich verstärkt auf den Prozess der Identitätsfindung aus. Es müssen zusätzlich noch Strategien entwickelt werden, um die neue Lebenssituation zu bewältigen. Es gilt zu entscheiden, ob und in welchen Bereichen man sich integrieren oder anpassen will – oder ob allenfalls eine Trennung (Ghettoisierung) und Verhaftung in der «alten» Kultur gewählt wird. Diese Prozesse können schmerzhaft sein und sind nicht ganz freiwillig. Die sozialen, kulturellen und ökonomischen Faktoren können Zwänge schaffen, die von den Jugendlichen als extrem beengend und bedrohend erlebt werden. Die Akkulturationsstrategien werden generell von mehr oder weniger stark erlebtem Stress begleitet, der vorübergehend Irritation, Angst oder Depressivität auslösen kann.
Es versteht sich von selbst, dass bei schwach qualifizierten Jugendlichen, vor allem bei jungen Frauen, die Probleme kumulieren können und eine Begleitung und Unterstützung dringend notwendig ist.
Zum Beispiel ...
Geschichten aus der Praxis
Gratwanderungen
«Endlich sehe ich Sie wieder!»
Schminke und Outfit sind professionell, ihre Augen strahlen, es geht ihr gut: N. hat vor eineinhalb Jahren ihre Lehre als DHA abgeschlossen und ist jetzt Vize-Account-Managerin (!) der Kosmetikfirma X. in einem grossen Basler Warenhaus. Sie plaudert mit mir begeistert über ihren Job und ihre Zukunftspläne – bis die Kundinnen sie wieder beanspruchen.
Auf der Heimfahrt im Tram denke ich zurück:
Am Anfang erfüllt N. alle gängigen Klischee-Vorstellungen vom erst 16-jährigen «Landei» aus dem luzernischen Hinterland, das in der Stadt seinen Traumjob gefunden hat: eine Lehre in einem Parfümeriegeschäft.
Die Probleme beginnen bald nach Lehrbeginn: Die Berufsbildnerin lehnt FiB ab («Einmischung haben wir nicht nötig!»), N. wird ausgenutzt (pro Monat 52 Überstunden), am Inventurtag arbeitet sie 16 Stunden am Stück, ohne Pause.
N. hat Angst vor Interventionen (es ist ja ihr Traumjob und Nachfolgerinnen stehen jederzeit Schlange) und bittet mich, nichts zu unternehmen. Es fällt mir sehr schwer, diesen Wunsch zu akzeptieren!
N.s grosse Liebe zu S. geht in Brüche, gesundheitliche Probleme kommen hinzu. Sie schleppt sich durch den ersten Winter mit Psychopharmaka. An einem Tiefpunkt (es kommt noch Alkohol dazu) schreibt sie mir eines Nachts einen seitenlangen Brief über ihr bisheriges Leben: Scheidung der Eltern, körperliche Übergriffe durch den Vater, Drogen, streng religiöse Grosseltern versuchen, den «Teufel in ihrer Seele» auszutreiben – nichts fehlt in dieser erschütternden Biografie. Ich bin so aufgewühlt und ratlos, dass ich mich mit meiner FiB-Vorgesetzten über N. unterhalte. Ihr Rat: Einfach da sein, immer wieder versuchen und – die (einzige) Konstante in N.s Leben sein.
Das zweite Lehrjahr ist geprägt von Schwankungen zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt: N. muss zweimal ins Spital; meine Kollegin und ich versuchen, mit privaten Nachhilfestunden die Wissenslücken von N. aufzufüllen. Mit wenigen Ausnahmen arbeitet sie genügend. Das grenzt für mich an ein Wunder (und lässt ihre Ressourcen ahnen).
Im zweiten Frühling tritt, fast unbemerkt, eine Beruhigung ein: Ihre Anrufe und SMS nach 22 Uhr werden seltener bei mir, das Ende der Lehre ist abzusehen. Eines Tages im Mai erklärt mir N. strahlend, dass sie sich für einen Visagisten-Kurs im Herbst angemeldet hat.
Sie schafft das QV mit 4,5 im Schnitt, bedankt sich überschwänglich für alles und verschwindet aus meinem Leben – bis … Siehe Anfang!
Einfach da sein und aushalten, vertrauen – obwohl ich zeitweise nicht wusste, in was –, das habe ich gelernt. Und offenbar kann auch das Jugendlichen bisweilen helfen, auf der richtigen Seite des Grates den Weg wieder zu finden.
Christine Heer
leisten
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wenn Jugendliche in die Berufswelt integriert werden wollen, werden sie gnadenlos an ihren Leistungen gemessen. Sehr viele Probleme von Jugendlichen, gleich welcher Art, äussern sich früher oder später in mangelhaften Leistungen und/oder Lernschwierigkeiten. Viele Faktoren können Auslöser für einen Leistungsabfall sein. Darum braucht es eine sorgfältige Abklärung, ein ausführliches Gespräch, bis die wirkliche Ursache der Lernschwierigkeiten angegangen werden kann. Auch Mangel an Motivation oder Konzentration haben vielerlei Ursachen, sind diffus und führen zum Absinken der Leistungen. Wenn wir die Jugendlichen einigermassen sicher über den Grat zwischen Jugendlichem und Erwachsenem bringen wollen, müssen wir bereit sein, sie bei Gefahr zu begleiten, aufmerksam zu sein, Zeit für sie zu haben.
Übergang und Rituale
«Am Übergang zwischen Schule und Beruf stehen die Jugendlichen vor vielfältigen Herausforderungen und Veränderungen. Sie lassen die «Kinderwelt» hinter sich und wachsen heran zu jungen Frauen und Männern. Seitens der Gesellschaft werden neue Anpassungserwartungen an sie gestellt und damit noch nicht genug; die jungen Menschen müssen sich auch noch im Klaren sein, was sie als Individuum in ihrem Leben wollen. Alles in allem handelt es sich um eine beachtliche Entwicklungsarbeit, die von den jungen Leuten zu leisten ist. Diese Veränderungsarbeit ist für das Individuum umso bedeutungsvoller, als derzeit davon ausgegangen wird, dass es die Übergänge sind, die den Lebenslauf eines Menschen prägen und nicht die ruhigeren und stabilen Perioden. Kein Wunder, dass im Zusammenhang mit Übergängen von krisenhaften Phasen geredet wird und dass es sich um Zeiten handelt mit einer Unzahl von ungeklärten Fragen und drängenden Unsicherheiten. Was zur Klärung drängt, ist im Gespräch und mit der kundigen Begleitung einer erfahrenen Person einfacher zu bewältigen als im Alleingang.» (Ledergerber/Ettlin 2006) Diese Feststellung trifft nicht nur für Mentoring-Programme zu, sie ist auch für die individuelle Begleitung in der zweijährigen Grundbildung zentral. Individuelle Begleitung fördert und unterstützt die Übergangskompetenzen der Jugendlichen:
Читать дальше