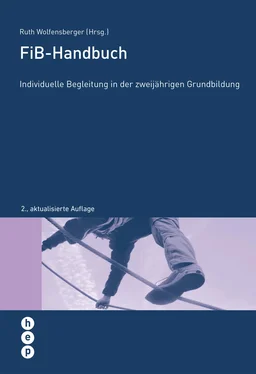Die berufliche Grundbildung fällt für die meisten Jugendlichen zusammen mit einer schwierigen und labilen Phase in der persönlichen Entwicklung. Die Übergangsphase von der Kindheit zum Erwachsensein bringt zusammen mit Unsicherheit und Angst auch wechselnde Gefühle mit sich. Das Verhältnis zum eigenen Körper, zur Sexualität und allenfalls zum andern (oder gleichen) Geschlecht ist noch nicht geklärt. Erste Erfahrungen vermitteln nicht nur Höhenflüge, sondern auch Zweifel und Versagensängste. Die Frage «Ist das normal?» schwingt bei vielen körperlichen und seelischen Erst-Erfahrungen mit und kann oft mit niemandem schlüssig und beruhigend besprochen und geklärt werden. Die Jugendlichen leben mit starken Gefühlsschwankungen, die einmal als Allmachtsgefühle und Selbstüberschätzung, dann wieder als Minderwertigkeitsgefühle und depressive Verstimmungen erlebt werden. Alle diese Gefühle sind im Moment stark und überwältigend, daneben hat nicht mehr viel anderes Platz. Schule und Beruf sind da oft Nebenschauplätze.
«Die Leiden des jungen Werther» haben die Jugendlichen des späten 18. Jahrhunderts epidemieartig erfasst, das Leiden an der Liebe hat zu einer Welle von Depressionen und Suiziden geführt. Das erste Leiden an der Liebe, die Selbstzweifel, die Verletzlichkeit und Unzulänglichkeit kann für junge Menschen auch heute noch radikal und umfassend sein.
Erikson (1965) beschreibt in seinem immer noch gültigen Phasenmodell der menschlichen Entwicklung die spätere Pubertät und die Adoleszenz mit «Leistung gegen Minderwertigkeitsgefühl» und «Identität gegen Rollenkonfusion», das frühe Erwachsenenalter mit «Intimität gegen Isolierung». Auch ohne genaue Zuschreibungen von Alter oder Entwicklungsphasen (sie sind nicht mehr so klar zuzuordnen wie vielleicht vor 50 Jahren) umschreiben die Begriffspaare ziemlich deutlich die Kämpfe und Kriegsschauplätze, denen unsere Lernenden ausgeliefert sein können – und denen sie sich oft auch flächendeckend ausliefern. Da ist viel Konflikt- und Krisenpotenzial vorhanden. Dem Gefühl der Unzulänglichkeit und Minderwertigkeit müssen Leistungen entgegengesetzt werden, die Beachtung und Aufmerksamkeit finden. Nicht immer ist Beachtung und Aufmerksamkeit in der Schule oder im Betrieb das Ziel, die Achtung und der Respekt in der Peergruppe ist meist entscheidender. Die Akzeptanz und der Kampf um den Platz in der Gruppe erfordert viel Energie. Es wird polarisiert und radikalisiert, es gibt nur Freund oder Feind, gut oder böse. Man will bestätigt, geachtet, geliebt werden, wenn sonst schon alles aus den Fugen gerät.
Statusübergänge erfordern Kraft. Man muss ein bestimmtes Verhalten zeigen, damit einem der erwünschte Status von der Umwelt zuerkannt wird. Status beinhaltet Rechte und Pflichten; Regeln müssen verinnerlicht und neue Handlungsspielräume erschlossen werden. Die neuen Rollen und Handlungsmuster, das Werte- und Normensystem muss erprobt und immer wieder den eigenen Bedürfnissen angepasst oder verworfen werden. Für Jugendliche, die nie erlebt haben, dass auch ein schmaler Grat begangen werden kann oder dass auch unüberwindlich scheinende Hindernisse bewältigt werden können, kann diese Zwischenphase gefährlich und gefährdend sein. Einzige Konstanz und Stabilität wird dann in Gruppen, Cliquen, Gangs, bei «Brüdern» verschiedener politischer Couleur oder bei pseudoreligiösen Gruppierungen gefunden. Sich gegen die Erwartungen oder Verbindlichkeiten der Gruppe zu stellen, eigenständig zu denken und handeln, erfordert eine Reife, die oft noch nicht vorhanden ist. Identität ergibt sich nicht einfach von selbst, sie muss vielmehr von jedem jungen Menschen erschaffen – ich würde sogar sagen – neu erfunden werden.
sein
Im engeren psychologischen Sinn wird Identität als einzigartige Persönlichkeitsstruktur verstanden. Dabei ist nicht nur das Selbstverständnis oder die Selbsterkenntnis der eigenen Person wichtig. Auch die Wahrnehmung der Persönlichkeitsstruktur durch andere spielt eine zentrale Rolle (Grob/Jaschinsky, 2003). Die Identität konstruiert sich aus Selbst- und Fremdbild. Beim psychologischen Begriff der Identität handelt es sich um die Integration der eigenen Lebensgeschichte, die schliesslich dem Einzelnen ein Gefühl von Kontinuität, Einheit und Sinn für seine Lebensgestaltung bietet. Dazu gehört sowohl das sogenannte Selbst, das sich auf das Wesentliche eines Menschen bezieht, auf das, was diesen Menschen ausmacht, als auch das Selbstkonzept, das aus einer kognitiven und einer affektiven Komponente besteht und sich der Umwelt vor allem über die Handlungen der Person erschliesst.
Die Frage «Wer bin ich?» dürfte viele unserer Jugendlichen nachhaltig beschäftigen. Die Ergänzungsfrage «Und wenn ja, wie viele?» hat zwar durchaus eine humoristische Note, wird aber in einigen Fällen einen bitteren Beigeschmack haben. Vorübergehende Rollenkonfusion gehört dazu, wenn der eigene Platz in Familie, Freundeskreis und Gesellschaft gefunden werden soll. Für die Soziologie endet die Jugendzeit, wenn der/die Jugendliche in die neuen Rollen hineingewachsen ist. Dies betrifft die Rollen in Beruf, Partnerschaft und Familie, als Konsument/in und als politische/r Bürger/in (Hurrelmann 1997). Die Identitätsfindung ist für Erikson ein lebenslanger Prozess, die Jugendphase ist für ihn dann abgeschlossen, wenn grundlegende Fragen der Identität beantwortet sind.
Nach James E. Marcia verläuft die Identitätsfindung meist von übernommener Identität über die kritische Identität bis zur erarbeiteten Identität. Verschiedene Ereignisse oder Umstände können die Übergänge begünstigen oder auslösen. Die Auslöser können in verschiedenen Bereichen stattfinden: Beruf, Religion, Politik, Geschlechterrolle oder intime Beziehungen. Übergänge zur diffusen Identität oder das Verbleiben in der diffusen Identität werden meist durch kritische Lebensereignisse, z. B. Verlust einer wichtigen Bezugsperson, verursacht.
Es ist nicht zwingend, dass alle Jugendlichen alle Stadien durchlaufen, es ist auch nicht immer so, dass die Entwicklung in der erarbeiteten Identität endet. Auch ein regressiver Verlauf oder Stagnation sind möglich.
Neben der Familie und der Peergruppe haben im mittleren Jugendalter auch der Beruf und die Schule einen Einfluss auf die Entwicklung der Identität.
kommunizieren
Eine grosse neue Herausforderung hat sich für die Jugendlichen in den letzten Jahren ergeben. Die digitalen Technologien und neuen Medien wie Smartphone, Tablets und Co. haben die Art und Weise des Kommunizierens, Lernens und Arbeitens grundlegend und unwiderruflich verändert. Dabei ist nicht die neue Technologie das Problem, damit können Jugendliche gut umgehen und entwickeln erstaunliche Kompetenzen, aber die gesellschaftlichen Forderungen, vor allem von Seiten der Peergroup, sind sehr zeitintensiv, bauen Druck auf und definieren einen grossen Teil der Freizeit. Es ist selbstverständlich, immer erreichbar und immer präsent zu sein. Alles ist öffentlich, alles wird sofort beurteilt und gewertet. Das Smartphone ist in permanenter Körpernähe. Darauf kann keinen Moment mehr verzichtet werden. Die Pflege der Freundesgruppen auf facebook, Whatsapp und Instagram sind eine im wahrsten Sinne des Wortes unheimliche Vollzeit-Beschäftigung. Das Simsen, Posten, Twittern, Googeln, Sharen und Liken gehört ununterbrochen dazu. Der Druck, ein von einem «Freund» gepostetes Bild nicht sofort gelikt oder auf einen Hashtag nicht reagiert zu haben, kein Selfie vom heutigen Ausgang gepostet oder die Whatsapp-Party-Einladung verschlampt zu haben ist enorm. Kein Wunder reicht es oft nicht mehr, sich auch noch für den Unterricht oder berufliche Anforderungen zu konzentrieren. Abhängigkeit, Stress, Reizüberflutung, Überforderung, Kopfschmerzen, Mobbing in den sozialen Netzwerken und Depressionen haben zugenommen.
Читать дальше