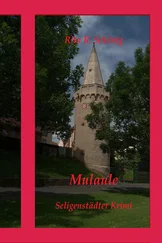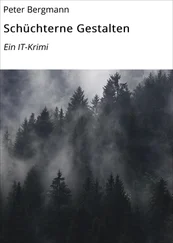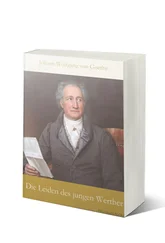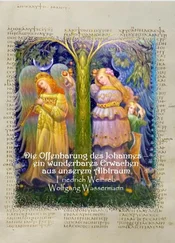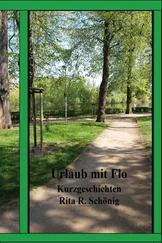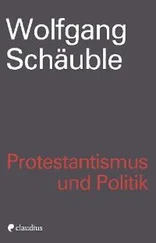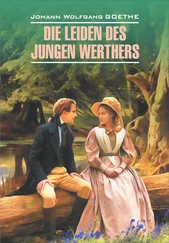Der zweite Teil des Buches schließt an die Qualitätsdiskussion Rittelmeyers an, fokussiert aber die akustische Qualität der Schule. Gerhart Tiesler befasst sich mit der akustischen Sanierung von Klassenzimmern. Es wird anhand von empirischen Studien gezeigt, wie sich Räume mit schlechter Akustik auf das Interaktionsgeschehen im Klassenzimmer auswirken, insbesondere vor dem Hintergrund der ›Öffnung‹ des Lernens. Die physiologischen Vorgänge, hervorgerufen durch akustischen Stress, werden erklärt. Demgegenüber wird an Beispielen erörtert, wie sich die akustische Sanierung von Klassenzimmern auswirkt. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Beanspruchung der Lehrkräfte gewidmet. Zusammenfassend legt Tiesler dem Leser einige Konsequenzen aus den empirischen Studien nahe. An diese Überlegungen schließt der Text von Christian Nocke unmittelbar an mit der Absicht, Leitlinien für die akustische Gestaltung des Schulraums vorzustellen. Der Autor erklärt in einem knappen Aufriss die Grundlagen und die Bedeutung der raumakustischen Planung und Gestaltung von Räumen. Besonderes Augenmerk wird auf die Nachhallzeit entsprechend der DIN 18041 gelenkt. Anhand unterschiedlicher Raumgrößen und Nutzungsweisen werden Konsequenzen für die raumakustische Planung in Schulen gezogen. Eine empirische Studie an einer Grundschule verdeutlicht die unterschiedlichen raumakustischen Verhältnisse vor und nach der Sanierung von Klassenzimmern.
Um das Klassenzimmer geht es auch im dritten Teil des Buches. Allerdings sind die Beiträge von Wolfgang Schönig und Christina Schmidtlein-Mauderer sowie von Michael Kirch und Kai Nitsche ausschließlich auf die Nutzung des Mobiliars im Kontext von Lehren und Lernen konzentriert. Der Text von Schönig und Schmidtlein-Mauderer referiert eine empirische Studie zum Gebrauch des »flexiblen Klassenzimmers« in verschiedenen Schularten. Dazu werden der gegenwärtige Reformkontext gekennzeichnet und die Bestandteile des flexiblen Klassenzimmers vorgestellt. Anschließend wird anhand von Bildmaterial und exemplarischen Originalzitaten von Lernenden und Lehrenden aufgezeigt, wie das flexible Klassenzimmer tatsächlich verwendet und von beiden Gruppen (teils unterschiedlich) beurteilt wird. Abschließend werden die Ergebnisse kommentiert und Vorschläge für eine Integration des flexiblen Klassenzimmers in den Schulalltag und die Kultur der jeweiligen Schule unterbreitet. Michael Kirch und Kai Nitsche plädieren dafür, den Integrationsproblemen früh zu begegnen, nämlich bereits in der ersten Phase der Lehrerausbildung. Sie stellen flexible Grundschulklassenzimmer vor, die zudem mit einer Anlage für den Video-Mitschnitt ausgestattet sind. Dieses Ensemble wird für die Schulpraktika der Lehramtsstudierenden der Ludwig-Maximilians-Universität München genutzt. Es erlaubt, die Unterrichtsversuche einzelner Studierender zeitgleich in einen benachbarten Seminarraum der Studierendengruppe zu übertragen. Die Studierenden erfahren auf diese Weise, dass das Klassenzimmer keine zu vernachlässigende Größe ist, sondern die räumlichen Verhältnisse bereits bei der Unterrichtsplanung hinsichtlich der Passung mit den anderen Strukturmomenten des Unterrichts wie z.B. mit Zielen, Methoden und Medien sorgfältig bedacht werden müssen.
Dass Schule und Unterricht immer auch mit Machtkonstellationen verbunden sind, wird im vierten Teil des Bandes erörtert. Laura Kajetzke und Jessica Wilde ist wichtig zu verdeutlichen, dass trotz der Bestrebungen der Öffnung von Unterricht auch für das flexible Klassenzimmer die Frage nach Macht und Kontrolle zu stellen ist. Dazu bedienen sich die Autorinnen soziologischer Konzepte, insbesondere der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) von Bruno Latour. Macht wird mit Foucault und Latour als ein Phänomen gesehen, das nicht allein in der Begegnung von Subjekten erzeugt wird, sondern das auch durch scheinbar periphere Elemente wie die Materialität des Raumes entsteht – der Raum wird zum Akteur. Mit der ANT zeigen Kajetzke und Wilde, wie die Materialität bzw. die Artefaktwelt von »klassischen« und »flexiblen« Klassenzimmern neu vermessen werden kann. Dabei ist auch von Interesse, welche Machtwirkungen – positive wie bedenkliche – durch das flexible Klassenzimmer entstehen können. In einem weiteren Schritt wird der Zusammenhang von Bewegungen und Macht sowie von ermöglichenden und einschränkenden Bedingungen im Klassenzimmer erhellt. Ina Herrmann öffnet den Fokus der machttheoretischen Betrachtung des Klassenzimmers und betrachtet die Schule-Umwelt-Relation unter dem Gesichtspunkt von Öffnung und Schließung. Ihr Text geht von dem Widerspruch aus, dass sich die räumlich-institutionellen Grenzen des Pädagogischen zwar auflösen, aber der Schulraum noch weitgehend auf die Schließung räumlicher Grenzen hin angelegt ist. Mithilfe des poststrukturalistischen Ansatzes von Michel Foucault wird zunächst am Beispiel einer Realschule die Schule-Umwelt-Abgrenzung erklärt. Der Bautypus dieser Schule wird sodann mit der Foucault’schen Figur des »Panopticons« konfrontiert. Danach wird die Mikroperspektive eingenommen und die »zellenförmige« Architektur am konkreten Beispiel gekennzeichnet. Abschließend wird auf die baulichen Hindernisse einer »Entgrenzung des Pädagogischen« durch die Schularchitektur hingewiesen.
Der fünfte und letzte Teil des Buches ist perspektivisch ausgerichtet. Er schließt an die in den anderen Kapiteln referierten Qualitätsstandards und Leitlinien für eine pädagogisch ausgerichtete Schularchitektur an und markiert die Eckpunkte für eine Schulentwicklung, die eine anspruchsvolle Lernkultur, das Anliegen der Lebensraumorientierung und die Schulraumgestaltung zusammenzubringen versucht. Am Anfang steht der Beitrag von Karin Doberer und Michael Brückner, dem die Erfahrung der pädagogischen Baubegleitung in Korrespondenz mit Architekten zugrunde liegt. Zunächst werden die Versäumnisse im Schulbau vor dem Hintergrund moderner Lernanforderungen aufgezeigt und die räumlichen Voraussetzungen für Kooperation im Kollegium als unzulänglich charakterisiert. Vorgestellt wird das Konzept »Raumfunktionsbuch« als Basis des gemeinsamen Planungsprozesses aller Beteiligten. Doberer und Brückner greifen einen Bezugspunkt des Planungsprozesses, das Klassenzimmer, heraus und zeigen dessen Veränderung zur »LernLandSchaft«. Am Beispiel der Sanierung der Beruflichen Schulen Witzenhausen werden die vorgestellten Planungsprämissen buchstäblich ins Bild gesetzt. Jutta Schöler greift das Thema der Inklusion auf und zeigt, auf welche baulichen Merkmale der Schule eine Pädagogik trifft, die mit den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention des Jahres 2009 Ernst machen soll. Eine inklusive Schule, die sich auf die besonderen Bedürfnisse behinderter Menschen einlässt, ist, so Schöler, ein Lernort, an dem sowohl die Einstellungen von Pädagoginnen und Pädagogen proaktiv sind als auch die räumlichen Gegebenheiten für die Aufnahme und Annahme behinderter Menschen umgestellt werden. Schöler erläutert dies an verschiedenen Beispielen: den Wegen im Schulhaus für die Rollstuhlfahrerin, dem Klassenraum für im Sehen oder im Hören eingeschränkte Schüler, der gemeinsamen Toilette für behinderte und nichtbehinderte junge Menschen und der gemeinsamen Nutzung der Schulküche im Rahmen eines lebenspraktischen Unterrichts. Der Beitrag von Florence Verspay und Frank Hausmann kann als ein Beispiel für eine veränderte Sicht der Architektur auf den Schulraum und somit als Quintessenz der im Buch referierten Reformvorschläge gelesen werden. Der Titel des Beitrags »Wie sich Schulen verändern müssen …« kündigt paradigmatisch an, dass der Wandel der Lehr- und Lernkonzepte eine Entsprechung in der schulischen Architektur finden muss. Damit diese Forderung erfüllt werden kann, ist eine enge Zusammenarbeit von Nutzern und für den Bauprozess Verantwortlichen Voraussetzung. Der erste Schritt einer Kooperation besteht aus einer Analyse des Ist-Zustandes der räumlichen Gegebenheiten im Schulalltag. Anhand verschiedener Praxisbeispiele wird sichtbar, wie pädagogische Konzepte in der räumlichen Umsetzung abgebildet werden können. Damit der Entwicklungsprozess optimiert werden kann, plädiert das Verfasserteam für eine »Phase null«, eine Integration aller Beteiligten in die Planung von Anfang an. Gemeinsam erstellte Nutzungsszenarien sollen helfen, räumliche Abhängigkeiten rechtzeitig zu erkennen. Anschließend legen Hausmann und Verspay wesentliche Aspekte dar, die exemplarisch als Prozessgrundlage für eine auf pädagogische Anforderungen ausgerichtete Architektur dienen können. Der Beitrag von Josef Watschinger setzt diese gedankliche Linie fort und verdeutlicht exemplarisch das Ergebnis eines gelungenen Planungsprozesses. Watschinger spricht an, welchen Weg das Land Südtirol beschreitet, um die Lehr- und Lernräume in Einklang zu bringen mit der sich entwickelnden erweiterten Lernkultur, und geht kurz auf die neuen Schulbaurichtlinien ein. Am Beispiel der neuen Grundschule Welsberg wird ein Mut machender Ansatz präsentiert. Abschließend wird der Versuch unternommen, einige Merkmale pädagogisch gelungener Architektur zu formulieren.
Читать дальше