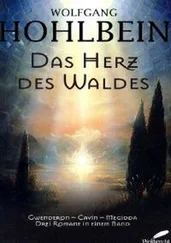Demnach kann man die Mensch-Raum-Beziehung als eine anthropologische Konstante verstehen, die gleichwohl intersubjektiv unterschiedlich zur Geltung kommt, je nachdem, welche Raumkonzepte Menschen entwickeln. Raumdimensionen werden nämlich auf verschiedene Weise wahrgenommen, sodass sie unterschiedliche Qualität erhalten. In der wahrgenommenen Differenzierung der Raumdimensionen teilen sich je eigene Bedeutungsinhalte des Raumes mit. Die Begegnung mit dem Raum ist ein weitgehend unbewusster Erlebnisvorgang, mit dem das Subjekt eine innere Raumordnung bzw. einen ›phänomenalen Raum‹ bildet. Die kognitionspsychologische und neuropsychologische Forschung macht darauf aufmerksam, dass der erfahrene Raum im Gehirn nicht als ›objektiver Raum‹ bzw. nicht mathematisch exakt repräsentiert wird, sondern in einer neuen Qualität erscheint. Raumerfahrung ist unlösbar mit der Erfahrung des eigenen Leibes und mit einer Vielfalt affektiver Tönungen verknüpft. Der Körper fungiert dabei als ein räumliches Referenzsystem, das die Eindrücke der verschiedenen Sinne zu einem eigenen ›subjektiven Raum‹ verdichtet. Die Eindrücke unserer verschiedenen Sinne vom Raum werden nicht etwa separat kodiert im Sinne eines Hörraums, Tastraums oder Sehraums, sondern werden sie vom Hirn ›intermodal‹ gespeichert. Ontogenetisch gesehen, kommt der taktil-kinästhetischen Sinneserfahrung dabei eine besondere Bedeutung zu. Für das kleine Kind ist das Tasten und Sichbewegen im Hör- und Sehraum die wesentliche Basis für die Entwicklung von Raumgefühl und einem sicheren Raumkonzept. In der taktil-kinästhetischen Aktivität des jungen Menschen eröffnet sich ihm ein sensomotorischer Raum. Die Wahrnehmungen von Zeit-Raum-Relationen, von Bewegungsunterschieden und Ereignisfolgen werden zu einem inneren Vorstellungsbild vom Raum verdichtet. Die Körpererfahrungen verschaffen ihm einen Zugang zur Welt (vgl. Liechti, 2000, 226ff.).
Bereits diese wenigen Hinweise deuten an, dass das Lernen unauflöslich an die Erfahrung des Raumes gebunden ist. Durch die Körperwahrnehmungen bildet sich ein Verständnis für die Phänomene und ihre Eigenschaften. Die leibhaftigen Eindrücke werden mental zu Vorstellungen verarbeitet, denen die Bildung von Symbolen wie Sprache oder Zahlen folgt. Vereinfachend gesagt, gelangt der Mensch von der Bewegung (des Greifens) zum Begreifen und zum Begriff. Der Begriff erscheint somit als eine Abstraktion der vielfältigen leibhaften Veränderungen, die das Subjekt in seinen räumlichen Bezügen erfahren hat. Die Räume, in denen wir leben, erziehen und beeinflussen uns weit über die bewussten Wirkungsmechanismen hinaus, Räume bilden und werden gebildet (vgl. Becker/Bilstein/Liebau, 1997).
Diese Überlegungen werfen nicht nur Fragen an ein einseitiges symbolisch-abstraktes Lernen auf, das die Lernroutine unserer Schulen immer noch prägt, sondern sie weisen darauf hin, dass die Bedeutung der räumlichen Gestaltung sowie die Art der Nutzung unserer Schulräume für das Gelingen schulischer Bildung noch oft unterschätzt wird. Wie müssen schulische Lern-Räume beschaffen sein, damit sich Lernen und Bildung ereignen können, die Schule für die Heranwachsenden subjektiv bedeutsam sein und als ein Ort des Lebens eine Bereicherung anstatt eines hingenommenen Zwangs sein kann?
Im erziehungswissenschaftlichen Diskurs werden diese Fragen seit einigen Jahren aufgegriffen. Konnte Jeanette Böhme festhalten, dass »der Raum« bislang keine zentrale Kategorie der erziehungswissenschaftlichen Theoriebildung war und im Diskurs eher »implizit mitgeführt« wurde (Böhme, 2009a, 13), so hat das Raumthema vor allem in der Schulpädagogik neuen Auftrieb bekommen. Es wird von einem »spatial turn«, von einer Wende zum Raumthema gesprochen (Böhme, 2009b). Die Raumvergessenheit insbesondere der Pädagogik scheint ein Ende gefunden zu haben. Inzwischen wird deutlich gesehen, dass der Schulraum kein Behältnis für Schülermassen – ein Container – ist, sondern ein sozial, kulturell, soziologisch und psychologisch hochsensibles Phänomen, das von den Akteuren in der Schule selbst hervorgebracht wird. Georg Breidenstein (2004) hat im Anschluss an die Raumsoziologie von Martina Löw (2001) für dieses Raumverständnis den Begriff des relationalen Raums eingeführt und stellt drei gleichzeitig vorhandene Dimensionen der Strukturierung des Klassenzimmers vor. Diese Dimensionen sind der visuelle, der akustische und der haptische Raum. Umgekehrt gilt aber auch, dass die materiale Raumordnung die sozialen Handlungen der Akteure bestimmt. Räumliche Verhältnisse sind nicht allein das Produkt, sondern auch die Bedingung des Handelns. Dies ist insbesondere dort zu bedenken, wo es um das Gelingen der schulischen Bildung im Sinne neuer didaktisch-pädagogischer Prämissen sowie um die Analyse der Machteinflüsse des Raums auf die Heranwachsenden geht (Rieger-Ladich/Ricken, 2009; Kajetzke, 2010; Böhme/Herrmann, 2011).
Das Interesse am Schulraum ist inzwischen durch zahlreiche Buchpublikationen dokumentiert, und kaum eine pädagogische Fachzeitschrift lässt das Raumthema aus (beispielhaft: PÄD Forum, Heft 6/2009; Engagement, Heft 4/2011; Erziehung & Unterricht, Heft 5, 6/2011), jedoch ist bei Weitem noch nicht geklärt, wie Räume bilden, in welcher Vielfalt und Varianz, mit welcher Intensität und mit welcher Dauer sie das tun. Es ist wohl nicht zu prognostizieren, ob es sich um einen durchschlagenden Trend oder eher um eine vorübergehende Konjunktur handelt, wie Daniel Blömer (2011) sie für die Raumkonzepte der bildungspolitisch angefachten Gesamtschulentwicklung in den 1960er- und 1970er-Jahren vorgestellt hat.
Das (wieder-)erwachte Interesse am Schulraum ist heute allerdings von anderen Kontextbedingungen markiert als vor etwa fünfzig Jahren. Zwar ist das Koordinatensystem des Interesses unübersichtlich, erkennbar ist allerdings, dass die Schulen zunehmend unter Druck geraten sind, ihre ›Gestalt‹ zu verändern. Noch nie in der Geschichte des staatlichen Schulwesens sind die Veränderungen der Schule so rasch und tief greifend bis in die Systemstrukturen erfolgt wie in der Gegenwart. Die entscheidenden Antriebskräfte liegen allerdings weniger in der Pädagogik – auch wenn sie sich das seit der Reformpädagogik gerne so gewünscht hat – als vielmehr in durchgreifenden gesellschaftlichen, bildungspolitischen und vor allem ökonomischen Veränderungen. Mit PISA ist ein internationaler Bildungswettbewerb entfacht worden, der den Schulen im Zuge einer neuen Steuerungsphilosophie des Staates ein permanentes ›Qualitätsmanagement‹ abverlangt. Schulen sollen rundum besser werden! Bildungsstandards, Kerncurricula, Fremd- und Selbstevaluation – um nur einige Stichworte zu nennen – sollen dafür sorgen, dass Europa als Wirtschaftsraum den Anschluss an den globalen Wettbewerb nicht verpasst (kritisch dazu: Schönig/Baltruschat/Klenk, 2010). Der Ausbau des Ganztagsschulbetriebs soll die Erwerbstätigkeit der Frau fördern und die Familie entlasten. Und: Es soll in den Schulen anders gelernt werden – schneller, effektiver, flexibler. Begriffe wie Handlungs- und Kompetenzorientierung sowie selbstverantwortetes Lernen bestimmen die Programmatik der neuen Lern- und Lehrkultur. Innerhalb dieses Szenarios kommt auch dem Schulraum eine neue Bedeutung zu. Die Schulräume sollen den neuen Anforderungen besser als bisher genügen; die Ganztagsschule benötigt nicht mehr nur Räume für das Lernen, sondern auch für Aufenthalt, Mittagessen und Freizeitbeschäftigung. Und dies in einer ungewohnten Qualität. Denn wenn sich der Schule vermehrt die Aufgabe stellt, Schüler und Schülerinnen zu beheimaten, dann muss sich das auch in ihrem Raumprogramm niederschlagen. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hatte insbesondere zur Unterstützung des Ausbaus von Ganztagsschulen ein vier Milliarden Euro teures Förderungsprogramm mit der Bezeichnung »Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung« (IZBB) aufgelegt. Das Programm lief von 2003 bis 2009 und hat mehr als 8200 Schulen finanziell unterstützt. Ein erheblicher Teil der Mittel floss bzw. fließt noch in die Sanierung von Schulbauten. 1In der Praxis ist zu beobachten, dass manche Schule vor der Frage steht, ob die anstehende Sanierung der Schulgebäude wirtschaftlich zu rechtfertigen ist oder ob ein Neubau entstehen soll. In solchen Situationen muss zumeist über die bauliche und damit auch die pädagogische Zukunft der jeweiligen Schule rasch entschieden werden. Jedoch sollte vor aller Planung überlegt werden, welches pädagogische Konzept, welche unterrichtlichen Lehr- und Lernformen gefragt sind und was mit den Heranwachsenden gemeinsam angestrebt wird. Dazu benötigen alle Beteiligten – Architekten, Schulträger, Lehrerkollegium, Eltern und Schüler – einen gemeinsamen Lernprozess, der Zeit verlangt. Auch eine professionelle pädagogische Baubegleitung kann diesen Lernprozess nicht ersetzen, wohl aber optimieren.
Читать дальше