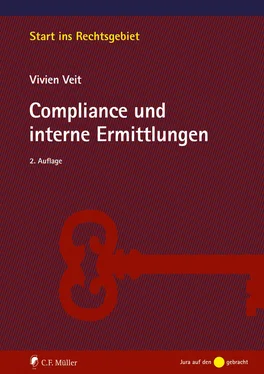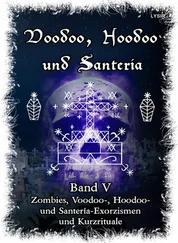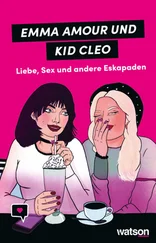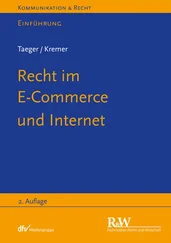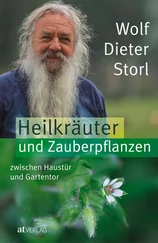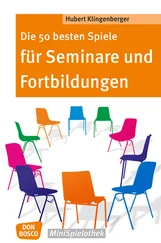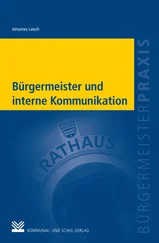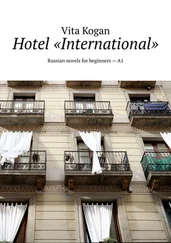Was verbirgt sich hinter „Compliance“? I. Was verbirgt sich hinter „Compliance“? 1 „Compliance“ ist einer der am meisten gebrauchten Begriffe der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit Unternehmensrisiken aller Art. Eine Google-Recherche erzielt rund 643 Mio. Treffer (Stand 3.10.2021). Große und kleine Beratungsunternehmen schreiben sich die „Compliance-Beratung“ auf die Fahnen und auch die Presse nimmt den Begriff in Bezug. Dabei bedeutet „Compliance“ eigentlich nichts anderes als Regeltreue . Welche Regeln eingehalten werden sollen, definiert der Begriff allerdings nicht. Es kann sich demnach um (offizielle) Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, aber auch um unternehmenseigene Regelwerke handeln.[1] 2 Inhaltlich kann letztlich jeder Rechtsbereich (z.B. Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Strafrecht) eine Rolle spielen. Der Begriff der Compliance ist daher so etwas wie ein geflügeltes Wort unserer Zeit geworden, welches nicht selten zweckentfremdet und neuen Bedeutungen zugeführt wird. Im Kern geht es jedoch stets um Haftungsvermeidung .[2] Unternehmen sind angehalten, sich und ihre Mitarbeiter so zu organisieren, dass aus dem Unternehmen heraus keine Rechtsverstöße begangen werden. Geschäftsführung und Mitarbeiter müssen sich also „compliant“ verhalten. Tun sie dies nicht, besteht das Risiko persönlicher wie unternehmerischer Haftung. Dies zu vermeiden ist Aufgabe und Inhalt der allseits hervorgehobenen Compliance-Bemühungen der Unternehmen.
1, 2 I. Was verbirgt sich hinter „Compliance“? 1 „Compliance“ ist einer der am meisten gebrauchten Begriffe der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit Unternehmensrisiken aller Art. Eine Google-Recherche erzielt rund 643 Mio. Treffer (Stand 3.10.2021). Große und kleine Beratungsunternehmen schreiben sich die „Compliance-Beratung“ auf die Fahnen und auch die Presse nimmt den Begriff in Bezug. Dabei bedeutet „Compliance“ eigentlich nichts anderes als Regeltreue . Welche Regeln eingehalten werden sollen, definiert der Begriff allerdings nicht. Es kann sich demnach um (offizielle) Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, aber auch um unternehmenseigene Regelwerke handeln.[1] 2 Inhaltlich kann letztlich jeder Rechtsbereich (z.B. Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Strafrecht) eine Rolle spielen. Der Begriff der Compliance ist daher so etwas wie ein geflügeltes Wort unserer Zeit geworden, welches nicht selten zweckentfremdet und neuen Bedeutungen zugeführt wird. Im Kern geht es jedoch stets um Haftungsvermeidung .[2] Unternehmen sind angehalten, sich und ihre Mitarbeiter so zu organisieren, dass aus dem Unternehmen heraus keine Rechtsverstöße begangen werden. Geschäftsführung und Mitarbeiter müssen sich also „compliant“ verhalten. Tun sie dies nicht, besteht das Risiko persönlicher wie unternehmerischer Haftung. Dies zu vermeiden ist Aufgabe und Inhalt der allseits hervorgehobenen Compliance-Bemühungen der Unternehmen.
II. Compliance in der Unternehmenswirklichkeit 3 – 6
§ 2 Rechtliche Hintergründe
I. Gesellschaftsrecht 7 – 39
1. Zivilrechtliche Haftung vs. Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 7 – 12
2. Haftungsrisiken für den AG-Vorstand 13 – 30
a) Schadensersatz, § 93 AktG 13 – 19
b) Abberufung des Vorstands/eines Vorstandsmitglieds 20, 21
c) Anforderungen an die Sorgfalt des Vorstands in Compliance-Fragen 22 – 30
aa) Die „Neubürger-Entscheidung“ des LG München I 23 – 27
bb) Der (Deutsche) Corporate Governance Kodex 28, 29
cc) Anforderungen ausländischer Rechtsordnungen 30
3. Haftungsrisiken für die Aufsichtsratsmitglieder 31 – 34
4. Haftungsrisiken für den GmbH-Geschäftsführer 35 – 37
5. Haftungsrisiken bei weiteren Gesellschaftsformen 38, 39
II. (Wirtschafts-) Strafrecht 40 – 149
1. Grundsätzliches zum Strafrecht 40 – 45
2. Das Wirtschaftsstrafrecht 46 – 122
a) Zum Begriff des Wirtschaftsstrafrechts 46 – 48
b) Ablauf eines (Wirtschafts-) Strafverfahrens (formelles Strafrecht) 49 – 69
aa) Das Ermittlungsverfahren (§§ 160 ff. StPO) 50 – 59
bb) Das Zwischenverfahren (§§ 199 ff. StPO) 60 – 62
cc) Das Hauptverfahren (§§ 212 ff. StPO) 63 – 67
(1) Grundlagen 63 – 66
(2) Wirtschaftsstrafrechtliche Besonderheiten 67
dd) Rechtsmittelverfahren (§§ 296 ff. StPO) 68
ee) Vollstreckungsverfahren 69
c) Die wichtigsten Straftatbestände des Wirtschaftsstrafrechts 70 – 122
aa) Die Korruptionstatbestände 72 – 102
(1) Grundlagen 72 – 77
(2) Die einzelnen Delikte im Überblick 78 – 102
(a) Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB) 78 – 94
(aa) Normzweck 79
(bb) Täterkreis 80 – 82
(cc) Tathandlungen 83 – 94
(b) Die Amtsträger-(Korruptions-)Delikte 95 – 102
(aa) Bestechlichkeit (§ 332 StGB) und Bestechung (§ 334 StGB) 96 – 99
(bb) Vorteilsannahme (§ 331 StGB) und Vorteilsgewährung (§ 333 StGB) 100 – 102
bb) Der Straftatbestand der Untreue (§ 266 StGB) 103 – 114
(1) Allgemeines zur Untreue 104 – 113
(a) Normzweck und verfassungsrechtliche Bedenken 104, 105
(b) Täterkreis und Tathandlungen 106 – 111
(aa) Der Missbrauchstatbestand 107, 108
(bb) Der Treuebruchtatbestand 109 – 111
(c) Taterfolg: Eintritt eines Vermögensnachteils 112, 113
(2) Die Untreue im Rahmen von Compliance-Fällen 114
cc) Der Straftatbestand des § 23 GeschGehG 115, 116
dd) Der Straftatbestand des § 298 StGB 117 – 121
ee) Geldwäsche 122
3. Konsequenzen strafrechtlichen Verhaltens 123 – 148
a) Geldstrafe 124 – 126
b) Freiheitsstrafe 127 – 129
c) Geldbuße wegen Aufsichtspflichtverletzung (§ 130 OWiG) 130 – 133
d) Unternehmensgeldbuße (§ 30 OWiG) 134 – 136
e) Einziehung 137 – 145
f) Nebenstrafen/sonstige Folgen 146, 147
g) Gesamtübersicht Rechtsfolgen 148
4. Exkurs: das Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft (Verbandssanktionengesetz – VerSanG)149
III. Kartellrecht 150 – 175
1. Sinn und Zweck des Kartellrechts und Überblick über die wichtigsten Verbote 150 – 154
a) Grundgedanke 150 – 152
b) Rechtsquellen und Zuständigkeiten 153, 154
2. Kartellrecht aus Compliance-Sicht 155 – 161
a) Risiken für Unternehmen und handelnde Personen 155 – 160
b) Strafrechtliche Folgen kartellrechtswidriger Absprachen 161
3. Die kartellrechtlichen Verbote im Einzelnen 162 – 174
a) Das Kartellverbot 162 – 169
aa) Grundsatz 162, 163
bb) Ausnahmen vom Kartellverbot 165 – 169
(1) Die Einzelfreistellung 166
(2) Die Gruppenfreistellung 167
(3) Safe Harbours 168
(4) Sonderkonstellationen, insbesondere Arbeitsgemeinschaften 169
b) Das Missbrauchsverbot 170, 171
c) Das Vollzugsverbot (Fusionskontrolle) 172 – 174
4. Abschlussbemerkung: Auswirkungen auf die Compliance 175
2. Teil Das Compliance-Management-System (CMS)
§ 1 Theoretischer Hintergrund
I. Wiederholung: Erforderlichkeit eines CMS 176 – 179
II. Haftungsreduzierende Wirkung des CMS 180, 181
III. Anforderungen an ein modernes CMS 182 – 244
1. Mission Statement/Tone from the top 186 – 192
2. Risikoanalyse 193 – 198
3. Organisation 199 – 221
a) Entwicklung von Kodizes und Richtlinien 199 – 203
b) Entwicklung von Prozessen 204 – 206
c) Bestimmung personeller Verantwortlichkeiten 207 – 221
aa) Delegation von Compliance-Pflichten 207 – 209
bb) Die herausragende Stellung des Compliance-Officers 210 – 221
4. Training und Kontrolle 222 – 235
a) Training, insbesondere Compliance-Schulungen 222 – 232
Читать дальше