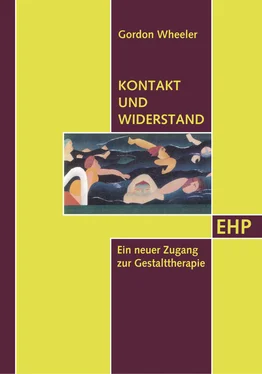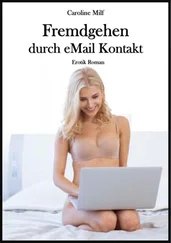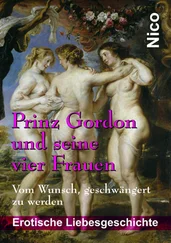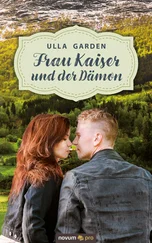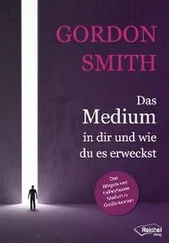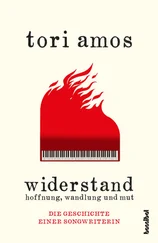Bewusstheit ist geradezu per Definition niemals vollständig; in gewisser Hinsicht ist es das, worum sich das Gestaltmodell dreht. Zunächst einmal hat eine Selektion stattgefunden, wobei mögliche wichtige Elemente oder Merkmale des Feldes ausgelassen oder nicht in den Vordergrund gebracht wurden. Zweitens hat der Prozess oder Akt der Organisation durch die Per son selbst die relativen »Werte« verschiedener Merkmale verändert – auch derjenigen, die bewusst wahrgenommen wurden. Diese »Elemente« zu verändern, indem man die Aufmerksamkeit auf vernachlässigte Bereiche lenkt, neue Informationen zum Tragen bringt, die »Valenz« verschiedener Elemente des Bildes neu einschätzt oder die Beziehungen zueinander verändert, bedeutet, dass man die Bewusstheit, die konfigurale Auflösung selbst verändert und dabei wiederum die Möglichkeit eines veränderten Verhaltens in Anpassung zu dieser veränderten subjektiven Realität eröffnet.
Einiges des oben Gesagten mag selbstverständlich erscheinen, aber trotzdem ist es weit entfernt von den verschiedenen gewaltsamen, ermahnenden oder vorschreibenden Ansätzen, die wahrscheinlich die meisten Anstrengungen für die Einleitung von Veränderungen während unserer gesamten Geschichte kennzeichnen – und damit zweifellos auch weit entfernt von großen Bereichen der psychoanalytischen Praxis, wenn nicht sogar der Theorie während ihrer gesamten historischen Entwicklung (vgl. Bergler 1956, der repräsentative Beispiele für das Konzept der »Interpretation als stumpfes Instrument« bringt, das zumindest in einigen psychoanalytischen Zentren zur Zeit von Goodman und Perls weit verbreitet war). Bei der Erörterung einiger Auslassungen und Verzerrungen im von Goodman und Perls 1951 ausformulierten Modell in den folgenden Kapiteln muss man sich des psychotherapeutischen Klimas, auf das sie dabei reagierten, bewusst sein.
Gleichzeitig trägt dieses »vernünftige« Modell einiges dazu bei, die Psychoanalyse für sich selbst und auch für uns zu erklären. Das heißt, Freuds Methodologie der Psychotherapie gründet sehr stark auf Interpretationen, also auf der Reorganisation der festen Strukturen des Denkens und Fühlens in der Person und der Kontaktaufnahme mit andere Menschen (und keineswegs auf der Assoziationspsychologie, wie Perls später behauptete. Perls missverstand offensichtlich den Begriff »freie Assoziation«, der natürlich im Freudschen Modell überhaupt nicht als frei verstanden wird, sondern als dynamisch, nicht nur assoziativ verbunden mit den fraglichen Problemstrukturen, den »zu rigiden« Gestalten des geistigen Lebens des Patienten). Aber die Freudianer hatten selbst einige Schwierigkeiten, genau zu erklären, wie sich Interpretationen auf das Leben eines Patienten auswirkten. Die Gestaltantwort lautet: Jede Wahrnehmung, jede »Sicht der Dinge«, ist eine Interpretation des Feldes mit verschiedenen, begleitenden Anpassungen (Handlungen), die der subjektiven Logik dieser Interpretation folgen. Die Interpretation des Therapeuten (oder, genauer gesagt, die Neuinterpretation) organisiert das Feld neu – oder »zerstört« (in Gestaltbegriffen) zumindest das bestehende Bild, sofern die Interpretation vom Patienten mitgetragen wird, und macht eine Neuentscheidung und neue daraus folgende Handlungen sowohl möglich als auch notwendig. So können beispielsweise Situationen, die vorher vom Patienten als bedrohlich angesehen wurden, jetzt als möglicherweise neutral oder sogar anziehend eingeschätzt werden, was in den Begriffen Lewins einer Neuorganisation der Valenzen mit offensichtlichen Konsequenzen für die Handlung entspricht. Und dies gilt auch für andere, ähnliche Beispiele, die alle sowohl in der Psychotherapie als auch im täglichen Leben ganz übliche Phänomene darstellen.
Aber das Modell der Veränderung, das wir hier aus dem Wahrnehmungsmodell der Gestalt beziehen, kann noch weiter reichen. Da es zur eigentlichen Natur des wahrnehmenden Organismus gehört zu interpretieren – das heißt Teile zusammenzufügen, Teile im Feld in ein organisiertes Ganzes aufzulösen –, ist die Versorgung mit fertigen Interpretationen durch den Therapeuten (oder andere Lehrer) vielleicht gar nicht nötig bzw. sie könnte sogar kontraproduktiv sein, je nachdem welche Art von Wandel angestrebt wird. Bloße Konzentration der Aufmerksamkeit der Person, besonders auf einige Teile des Feldes, die typischerweise außerhalb der Bewusstheit blieben, erzeugt per Definition eine Neuorganisation des Feldes und zumindest das Potential für entsprechende Verhaltensänderungen der einen oder anderen Art. Der letzte Satz ist bedeutsam, denn es scheint wahrscheinlicher, dass Verhaltensänderung, die auf diese Weise zustande kommt, stärker vom Klienten gesteuert wird als bei einigen anderen, präskriptiveren Methoden; aus der Sichtweise des Therapeuten ist das Veränderungsmodell der Gestalt weniger normativ. Im Gegensatz dazu kann die Steuerung der Person bei einem in direkterer Weise überzeugenden oder handlungsorientierten Ansatz sich erwartungsgemäß mehr auf den Widerstand gegenüber den besonderen gewünschten Veränderungen richten, besonders gegenüber dem Therapeuten oder gegenüber dem gesamten Prozess. Natürlich kann der Therapeut bei einem »Bewusstheitskonzept« die Richtung oder die Thematik des Wandels immer noch auf verschiedene Weise beeinflussen (vor allem, indem er die besonderen unbewussten Gebiete bestimmt oder mitbestimmt, auf die die Aufmerksamkeit gerichtet werden soll). Dennoch können wir erwarten, dass die daraus folgenden Verhaltensreaktionen aber nicht notwendig in größerem Maß als bei den anderen Modellen unvorhersehbar sind.
Dieser Ansatz für das Auslösen von Veränderungen wurde – immer noch ohne Anerkennung seiner theoretischen Wurzeln besonders im Modell von Lewin – etwas unangemessen bekannt als die »paradoxe Theorie der Veränderung« (Beisser 1970). Unlogisch auch, weil es hier wirklich kein Paradox gibt wie zum Beispiel bei der »paradoxen Intervention«, die in der Familientherapie genutzt wird, wobei man darauf hofft, dass die Person das genaue Gegenteil von dem tun wird, was der Therapeut ausdrücklich anordnet. Bei unserem Modell hier ist bei in der Konzentration auf die Bewusstheit selbst kein Paradox als Methode der Handlungsbeeinflussung beteiligt, denn man geht davon aus, dass die Handlung aus der Bewusstheit entspringt und daher am unmittelbarsten durch die Bewusstheit beeinflusst werden kann. Trotzdem sind die Konsequenzen für die psychotherapeutische Praxis offensichtlich und weitreichend. Die Rolle der Bewusstheit per se wird nicht nur erhöht und die der Interpretation entsprechend verringert, sondern der spezielle Prozess, auf den sich die Aufmerksamkeit und Analyse konzentriert, unterscheidet sich von denjenigen, die man mit traditionellen psychotherapeutischen Modellen assoziiert. Wenn es also die Natur des Organismus ist, seine Bedürfnisse dadurch zu befriedigen und zu koordinieren, dass er bedeutungsvolle Konfigurationen, Gestalten im Feld, auflöst, dann erzeugt jede Dysfunktion in diesem Prozess eindeutig andere Dysfunktionen in anderen Lebensprozessen. Der Psychotherapeut richtet seine Aufmerksamkeit also auf die Struktur der Erfahrung (um Goodmans Begriff aus dem Jahr 1951 zu verwenden) als Schlüssel zur Gesundheit und zur Dysfunktion – und damit zur Heilung.
Wieder wird es im allgemeinen Perls zugeschrieben (und er schreibt es sich selbst ebenfalls zu; 1969b), diese Anwendung des Gestaltmodells, diesen Ansatz für den psychotherapeutischen Prozess entwickelt zu haben. Die Quellen stimmen jedoch darin überein (From 1978; Davidove 1985; Glasgow 1971), dass diese Anwendung zumindest zum großen Teil der Beitrag von Paul Goodman war, dessen Arbeit ich im einzelnen im dritten Kapitel untersuchen werde. Perls’ Interessen und seine Bewusstheit waren tatsächlich auf etwas ganz anderes gerichtet. Diesen Interessen, die besonders in dem einzigen längeren theoretischen Text ausgedrückt sind, den Perls zu seinen Lebzeiten geschrieben hat, wenden wir jetzt unsere Aufmerksamkeit zu.
Читать дальше