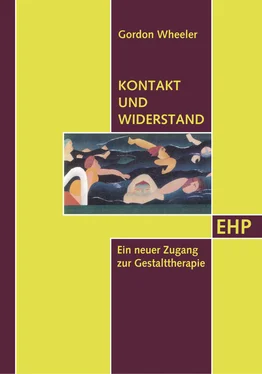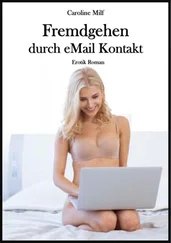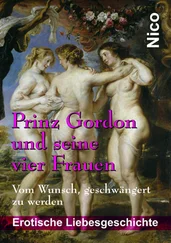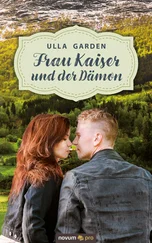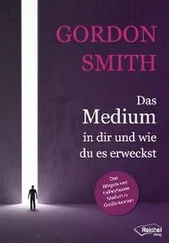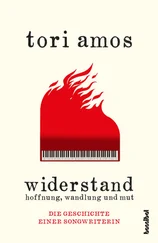Jedes System hat, wie Erikson bemerkte, seine Utopie; in gleicher Weise hat jede Persönlichkeitstheorie ihr Ideal und ihre Kriterien für Gesundheit oder Dysfunktion. Diese Kriterien dienen dazu, einen psychotherapeutischen Ansatz, der auf diesem Modell gründet, abzuleiten. Dieser Ansatz kann immer noch Raum für die Erfindung von Methoden lassen, die der Theorie angemessen sind; aber selbst hierbei ist die Wahl der Methodologie zumindest beträchtlich eingeschränkt durch die theoretischen Annahmen über Gesundheit und Dysfunktion. Die folgenden Kapitel werden zeigen, dass das gestalttherapeutische Goodman/Perls-Modell seine eigene theoretische Grundlage und Entwicklung in unnötiger Weise verkürzte, indem es einige Teile des späteren Gestaltmodells der Persönlichkeit verzerrte und andere ignorierte – mit vorhersehbaren Ergebnissen in Form einiger der charakteristischen Auswüchse, die mit dieser therapeutischen Schule verknüpft werden. Die Anwendungen der Modelle von Lewin und Goldstein werden zusammen mit den späteren Revisionen, die insbesondere im Bereich der Theorie über den Widerstand folgten, als Korrektiv für einige dieser Probleme angeboten.
Ein Gestaltmodell der Veränderung
Schließlich gibt es im Gestaltmodell, besonders in dessen Erweiterungen durch Lewin und Goldstein, eine implizite, wenn auch nicht richtig ausformulierte Theorie der Veränderung und des Auslösens von Veränderung, die gleichermaßen ein Potential in ihrer Anwendung auf Psychotherapie und auf andere veränderungsorientierte Interventionsabsichten birgt. Dies rührt von der Gestalt-Ansicht über das Handeln selbst und über die Beziehung des Handelns zur Kognition und zum Affekt, einem Problem, das die frühe Gestalt-Schule, insbesondere Wertheimer, sehr beschäftigte (siehe die Erörterung in Koffka, 1935, besonders die Kapitel VIII und IX). Das Problem hat, wie Wertheimer es anging, mit der Körper-Geist-Dichotomie zu tun, die einen philosophischen Ursprung hat, der zumindest bis zu Platon zurückreicht. Das heißt entweder »Geist« und »Körper« (oder die materielle Welt) sind irgendwie vom gleichen »Stoff« – oder sie sind es nicht. Wenn sie es nicht sind, wie kommt es dann, dass sie aufeinander »einwirken«, und zwar in beiden Richtungen, wobei der »Geist« scheinbar Entscheidungen fällt, die zu physischen Handlungen führen, und entsprechend die physische Welt einen Einfluss auf geistige Zustände, Haltungen, Gefühle, Entscheidungen usw. hat? Wenn sie andererseits vom gleichen »Stoff« sind, welches ist dann diese gemeinsame oder sich entsprechende Substanz oder Energie? Wo finden wir diese, und welches sind ihre Eigenschaften, vor allem ihre offensichtliche Fähigkeit, so verschiedene Erscheinungsformen wie »Körper« und »Geist« überhaupt anzunehmen? Wegen seiner Versuche, die Gestalt-Eigenschaften in der Natur zu quantifizieren, kam Wertheimer leider ebenso wie andere vor ihm mit diesem Problem nicht sehr weit. Das gilt auch für Köhlers Annahme von einem »Isomorphismus« zwischen »Geist« (und Gehirn) und »Natur«, was letztlich nicht mehr ist als eine erweiterte Fragestellung, da die einfache Behauptung einer strukturellen Parallele zwischen den beiden getrennten Bereichen, die schon für sich genommen fragwürdig ist, deren Interaktion auch nicht erklären könnte (vgl. Koffka 1935; Petermann 1932, Kap. III).
Trotzdem wirft das Gestaltmodell ein brauchbares neues Licht auf das Kognition/Aktion-Problem, ohne die jahrhundertealte Debatte zu lösen, und es beantwortete im Laufe der Zeit einige Fragen, die vom psychodynamischen Modell übrig blieben und die zu beantworten der psychoanalytischen Theorie manche Schwierigkeiten bereitete. Nehmen wir Lewins »Feld«, wobei ein sich bewegendes Subjekt die verschiedenen wahrgenommenen Hindernisse und Möglichkeiten auf seinem Weg zu irgendeinem subjektiven Ziel mit Hilfe einer Gestalt-»Landkarte« in Beziehung setzt und das die bestmögliche Annahme einer optimalen Auflösung der zwei Bereiche – der »inneren« Welt der Bedürfnisse (und Möglichkeiten) und der »äußeren« Welt der Möglichkeiten (und Anforderungen) darstellt. Dieser interaktiven Sichtweise zufolge ist jede Handlung des Subjekts zumindest teilweise eine Reaktion auf wahrgenommene Bedingungen im Feld, die im Licht der eigenen Einschätzung dieser Merkmale in Beziehung zu den eigenen Zielen gesehen wird. Ein Zugang, eine Vermeidung, eine Transaktion, ein Widerstand, ein Versuch der Beeinflussung oder eine Modifikation des Umfeldes – jede einzelne mögliche Handlung ist eine Anpassung des Subjekts in Beziehung zu seinen eigenen wahrgenommenen Bedürfnissen und Zielen und zu der »Landkarte«, die es konstruiert hat und ständig weiter konstruiert. Wenn man diese Landkarte irgendwie verändert, erhält man ganz eindeutig eine entsprechend andere Anpassung, einen anderen Handlungsverlauf seitens des Subjekts. Das heißt, vom Modell her gesehen ist der wirkungsvollste Punkt für Verhaltensbeeinflussung die Karte selbst. Verhalten – sei es durch Zwang oder etwas sanftere Manipulation – zu beeinflussen zu versuchen, würde bedeuten, dass man eine Menge mehr Widerstand auf seiten des Subjekts hervorbringt, das natürlicherweise nicht auf irgendwelche wahrgenommenen Landminen treten oder irgendwelche lohnenswerte Stationen auf dem Wege, die auch auf dieser Landkarte (richtigerweise oder nicht) auftreten, überspringen möchte. Und je bedeutsamer das entsprechende Verhalten ist, desto mehr Widerstand können wir vom Subjekt erwarten. Wir könnten also ganz entsprechend der Kritik Goldsteins an den frühen Arbeiten über Reflex und Wahrnehmung im Labor erwarten, dass ein »rein verhaltensmäßiger« Ansatz, Veränderung auszulösen, positive und nachhaltige Ergebnisse zeigt – da in gewisser Weise im Labor nichts auf dem Spiel steht. Aber unter komplexeren und herausfordernderen, vielleicht sogar bedrohlichen Bedingungen des »realen Lebens« würden diese Konditionierungseffekte wahrscheinlich missachtet werden, wenn man nicht die Risiken, Einsätze und Belohnungen auf der topologischen Karte des Subjekts selbst berücksichtigte, das heißt sein eigenes Verständnis des Feldes, wie es wahrgenommen und eingeschätzt wird und in welchem das konditionierte Verhalten angenommenerweise gezeigt werden sollte. Wenn Goldstein also richtig liegt, dann müsste die Organisation des Verhaltens der Person und ihrer Welt wenigstens in vielen Fällen die Trainingseffekte eines rein behavioristischen Ansatzes überlagern. (Natürlich gibt es so etwas wie einen »rein verhaltenstheoretischen Ansatz« nicht, wie die Gestalttheorie selbst nachweisen kann. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit sicherzugehen, dass die Person im Prozess der »direkten« Beeinflussung durch zufällige Verstärkung nicht auch gleichzeitig ihre eigene »Landkarte« im Licht dieser neuen Erfahrungen neu organisiert. Im Gegenteil, dieser Ansicht nach muss genau dies geschehen.)
Wenn wir die gleiche Angelegenheit in einer nicht an Lewin orientierten Sprache (aber immer noch in Gestaltbegriffen) formulieren, könnten wir sagen: Die Person tendiert per Definition immer zu einem optimalen dynamischen Gleichgewicht im Umfeld (ganz gleich, ob dies Spannungsreduktion oder Spannungsanstieg bedeutet). Das ist nur eine andere Art und Weise zu sagen, dass sie dazu neigt, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Dieses Gleichgewicht, das das »bestmögliche unter vorherrschenden Bedingungen« ist, hängt ab von der dynamischen Beziehung (oder der Wahrnehmung der Person von dieser dynamischen Beziehung) zwischen den eigenen Bedürfnissen und ihrer Auflösung des Feldes durch die Wahrnehmung – das heißt ihrer »Gestalt«. Diese »Gestalt« ist wiederum eine »organisierte Konfiguration der Bewusstheit« (Koffka 1935). Handlung im Feld ist also, wie oben dargestellt, eine Reaktion oder eine Anpassungsleistung zur Korrektur eines Ungleichgewichts zwischen den wahrgenommenen Bedürfnissen und den wahrgenommenen Bedingungen im Feld/der Gestalt/der strukturierten Bewusstheit. Versucht man also, diese Bewusstheit zu verändern, dann verändert man die daraus folgende Handlung, da die Handlung letztlich eine Reaktion auf diese Bewusstheit ist. Der effektivste »Druckpunkt« für die Einleitung von Veränderung in der Psychotherapie oder sonstwo scheint also nicht die Handlung, nicht das betreffende Verhalten selbst, sondern die Bewusstheit zu sein. (Selbst »strukturelle« oder direktive Therapien erkennen diesen entscheidenden Punkt an, da ihre Intention darin besteht, dass das angeleitete neue Verhalten den wahrgenommenen Wert oder die erwarteten Konsequenzen solchen Verhaltens ändern sollte – und das heißt, man ändert den Grund oder die »Landkarte der Bewusstheit«. Offensichtlich wäre eine Verhaltensänderung, die diesen Effekt auf die Organisation oder die »Verkartung« nicht hat, eine einmalige Angelegenheit.
Читать дальше