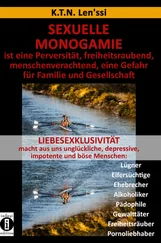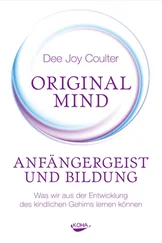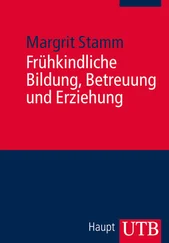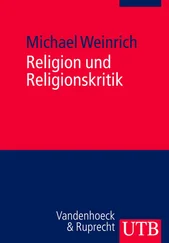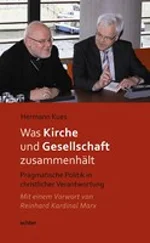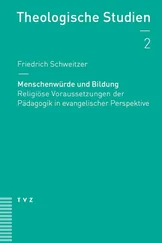In einer Zeitung war kürzlich das Statement zitiert: „Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn“. Das ist in gewisser Weise die Essenz des „religionsfreundlichen Kulturchristentums“. Man kann sicher darüber streiten, wie es zu interpretieren ist. Aber in seiner Breite ist es unzweifelhaft ein Phänomen religiösen Wandels. Und zwar gleich in verschiedener Hinsicht. Denn in dieser Einstellung zu Religion und Religiosität treffen sich sowohl Leute, die eine Vergangenheit als fromme Katholiken haben als auch solche, die eine Vergangenheit als rigorose Aufklärer und Säkularisierer haben. Gewandelt haben sich die einen wie die anderen, wenn auch, wenn man so will, in verschiedene Richtungen. In der neuen religiösen Mitte jedenfalls finden sie anscheinend gleichermaßen ihren Platz.
Eine persönliche Selbstvergewisserungsreligion
Fragen der Religion und des Glaubens werden heute vielfach als etwas so Persönliches betrachtet, dass man eine Unterscheidung zwischen mehr oder weniger zutreffenden Antworten für eigentlich nicht möglich hält. Antworten auf religiöse Fragen können aus dieser Sicht nicht beanspruchen, eine allgemeingültige Wahrheit zum Ausdruck zu bringen; was sie ausdrücken, könnte man eher nennen: eine persönliche Einstellung zum Umgang mit elementaren Daseinsrisiken. Eine solche Einstellung muss sich nicht nach konsensfähigen Kriterien bewahrheiten , sondern braucht sich lediglich im individuellen Einzelfall zu bewähren . Eine gute Religion und ein tragfähiger Glaube zeichnen sich also vor allem dadurch aus, dass sie, wie auch immer, einen Beitrag zur Steigerung der individuellen Lebensqualität leisten. Ein Beispiel aus einem Gespräch mit Claudia, einer 17-jährigen Gymnasiastin aus Bayern:
Frage: Würdest Du sagen, dass Du manchmal betest?
Claudia: Ja, würd’ ich schon sagen!
Frage: Und wie sieht das aus, wenn ich Dich fragen darf?
Claudia: Ich falte nicht meine Hände, oder so, ich denk’, hey komm’, hoffentlich schaffst’ es! Vielleicht steht mir ja doch einer bei, oder so. Aber ich denk mal so. – Das wichtigste ist eigentlich, dass du auf dich selber vertraust, oder? Einfach, dass ich denke, ey, vielleicht hast du Glück, oder so. Vielleicht haut’s hin! Oder manchmal, wenn es irgendwie, so im Moment geht’s mir eigentlich so ganz gut, aber so vor einem Jahr hatte ich mal voll die Krise, da hab ich so an allem gezweifelt, oh Gott, ey: Was bringt dir das alles überhaupt, wenn du hier in der Gesellschaft lebst, und dass du überhaupt, was weiß ich, morgens einkaufen gehst und mittags in die Schule oder umgekehrt, und da, wenn dir irgendwas total wehtut, oder so, dann hast du irgendwas, an das du denken kannst, und dann, würde ich sagen, dann betest du. Oder manchmal, genau, wenn ich abends allein heimlaufe, oder so, ich mach das eigentlich gerne, so allein ein Spaziergang, wenn ich dann irgendwo lang lauf’, und dann denke ich so. – Hey, dann rede ich einfach so mit mir selber oder mit jemandem anderen, ob jemand da ist, oder nicht! Ich denk’ mal, das ist Beten, bei mir. Dann fühlst du dich eigentlich auch nicht allein.
Frage: Glaubst Du, dass irgendwer zuhört, eingreift, antwortet?
Claudia: Das ist gar nicht ausschlaggebend, oder? Kommt halt drauf an, dass du dich selbst gut fühlst. Ich weiß nicht, vielleicht überträgt sich’s ja irgendwo hin, aber ich glaub eher nicht. Es ist mir auch nicht so wichtig, eigentlich. (vgl. Prokopf/Ziebertz 2000, 39)
Claudia zermartert sich nicht das Hirn darüber, ob Gott existiert oder nicht, ob da einer ist, der sie hört, wenn sie betet, oder nicht. Aber sie hat in bestimmten Situationen ein offensichtlich starkes Bedürfnis nach diesem Akt einer externalisierten Selbstreflexion, nach einem „Besprechen des Lebens“ (Bitter 1986, 376f) , das ihr das Gefühl gibt, nicht allein zu sein – und das sie mit einem gewissen religiösen Selbstbewusstsein eben „beten“ nennt.
Auch das könnte man als eine Art „Frömmigkeit ohne Glauben“ (vgl. Kurzke/Wirion 2005) bezeichnen. Jedenfalls geht es Claudia nicht in erster Linie um die Wahrheit eines Glaubens, sondern um die Wirksamkeit eines Tuns – eines Tuns, das in mancher Hinsicht therapeutische Züge trägt, das von Claudia selbst aber in einen religiösen Interpretationszusammenhang hineingestellt wird. Gleichzeitig zeigt sich hier noch einmal eine deutlich andere Einstellung der Religion gegenüber als beim religionsfreundlichen Kulturchristentum. Denn was bei diesem im Vordergrund steht: der Respekt vor den kulturellen Folgen des europäischen Christentums bzw. die Auseinandersetzung mit dem, was Bolz die „objektive Religion“ nennt, spielt bei Claudia möglicherweise gar keine Rolle. Deren Religiositätstypus könnte man eher eine „persönliche Selbstvergewisserungsreligion“ nennen. Gleichwohl wird auch hier etwas Religiöses erkennbar, das jenseits kirchlich gelebten Glaubens lebendig ist. Aus meiner Sicht jedenfalls sind Claudia und all diejenigen, für die sie hier steht, nicht in einem Feld religiöser Ignoranz und Bedürfnislosigkeit anzusiedeln, sondern eben in der vielgestaltigen neuen Mitte intermediärer Religiositätsformate. Ich vermute: Auch Claudia würde auf Nachfrage sagen, sie halte sich für „religiös“ – aber eben nicht für „ziemlich“ oder gar „sehr“ religiös, sondern, wie 40 Prozent der westdeutschen Bevölkerung, für „mittel religiös“. (vgl. Bertelsmann Stiftung 2009, CD 37)
Eine religionspädagogisch interessante Situation
Der Schlüssel zum Verständnis der neuen religiösen Mitte ist meines Erachtens die Situation religiöser Pluralität und der von ihr ausgehende Relativierungsdruck. Die Bedingungen religiöser Pluralität haben das Bewusstsein einer letztlich unüberholbaren Kontingenz religiöser Optionen deutlich vor Augen geführt. Unter diesen schwierigen Umständen tendiert die Mehrheit zu intermediären Religiositätsformaten wie denen des „religionsfreundlichen Kulturchristentums“ oder der „persönlichen Selbstvergewisserungsreligion“. Die intermediären Religiositätsformate insgesamt sind, was den Bestand ihrer Überzeugungen anbelangt, hochgradig unbestimmt und, was den Stil ihrer religiösen Praxis angeht, sehr fluide. (vgl. auch Lüddeckens/Walthert 2010) Ich würde ihnen sogar jene Ausprägungen einer zugegebenermaßen „schwachen“ Religiosität noch zurechnen, deren Vertreterinnen und Vertreter sich mit der vagen Vermutung begnügen: „Da ist etwas“ oder, noch vager, „irgendetwas wird es schon geben“. (vgl. Nassehi 2009, 175) Auch hier zeigt sich ja noch eine gewisse Sensibilität für das, was Theologinnen und Theologen die „religiöse Dimension der Wirklichkeit“ oder das „unsagbare Geheimnis unseres Lebens“ (Karl Rahner) nennen. Diese Sensibilität verbindet sich jedoch offenbar bei immer mehr Menschen mit der Skepsis gegenüber der Möglichkeit, dieses Geheimnis, in welchen Formen auch immer, deutlicher zu artikulieren und zu ihm, wie es die Religionen versuchen, in eine wie auch immer „geregelte Beziehung“ zu treten. (vgl. Englert 2010)
Ein Mann mittleren Alters sagt: Ich „glaube […] noch immer an einen Gott. Nicht dauernd. Manchmal ist das Gefühl für Monate weg, aber dann ist es auf einmal wieder da. Meistens denke ich an ihn, wenn es mir besonders gut geht – oder wenn ich mich sorge. Dann, rede ich ein bisschen mit ihm, vorm Einschlafen meistens, sage: Lass den oder den bitte wieder gesund werden. Ich sage übrigens nie: ‚Wie kannst du zulassen, dass […]‘ Wahrscheinlich bin ich ihm nicht nahe genug, um mich mit ihm zu streiten. Wobei ich auch nicht erwarte, dass sich Gott ins Leben einmischt. Ich glaube, dass er sich raushält. Am ehesten glaube ich noch: Er weiß, was passieren wird“ (Stolz 2009, 16) .
Читать дальше