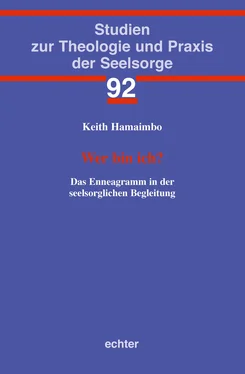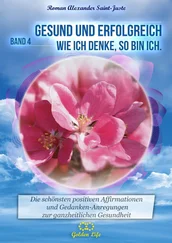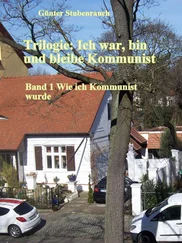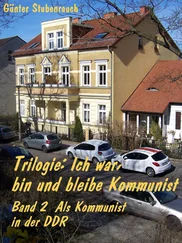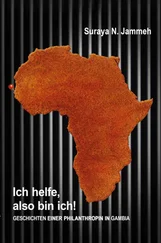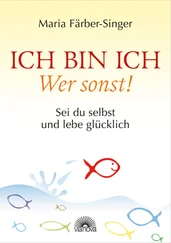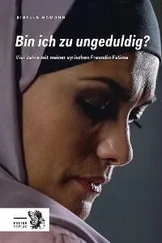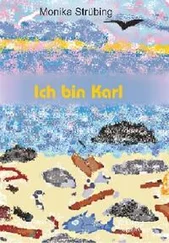3.3.5.2. Subjektsein von Gott her begründet
3.3.6. Aufeinanderbezogenheit der Gottes- und Nächstenbeziehung (Ottmar Fuchs)
3.3.7. Mystagogische Grundhaltung
3.3.7.1 Wertschätzung
3.3.7.2. Echtheit und Selbstkongruenz
3.3.7.3. Empathie
3.3.7.4. Alltäglichkeit
3.3.7.5. Befreiung
3.3.7.6. Universale Solidarität
3.3.8. Alltagsseelsorge
3.3.8.1. Alltagsseelsorge nach Stephanie Klein
3.3.8.2. Alltagsseelsorge nach Eberhard Hauschildt
3.3.8.3. Alltagsseelsorge: Ein Vergleich
3.3.8.4. Seelsorge durch das ‚Volk Gottes’
3.3.9. ‚Arbeit mit jungen Menschen’
3.3.9.1. Ernstnahme und Verständnis für Jugendliche
3.3.9.2. Mystagogische Jugendseelsorge/Jugendpastoral
3.3.10. Umgang mit dem ‚Psycho-Markt’
3.4. Ein Christliches Enneagramm?
3.4.1 „Verankertes“ christliches Enneagramm
3.4.2. Selbsterforschung und die christliche Lehre
3.4.3. Ablehnung des Enneagramms
3.4.4. Kompatibilität mit dem christlichen Glauben
3.4.4.1. Gnade
3.4.4.2. Menschenbild
3.4.4.3. Ergänzung mit schon vorhandenen Praktiken und Methoden
3.4.4.4. Praktische Führung zur Mündigkeit
3.4.4.5. Christliche Rahmen schaffen
3.4.4.6. Christliche Elemente in der Entwicklungsgeschichte des Enneagramms (Tradition)
3.4.4.7. Facettenreiche menschliche und kulturelle Phänomene als Konkretisierung Gottes Liebe zu seiner Schöpfung in ihrer Einzigartigkeit
3.5. Chancen eines christlichen Enneagramms
3.5.1. Neuer Zugang zur Kirche
3.5.2. Psychologie und Spiritualität
3.5.3. Dialogmöglichkeiten
3.5.4. Politische Ökumene
3.5.5. Spirituelle Ökumene
3.5.6. Kommunikationsgewinn auf interpersonaler Ebene
4. Enneagramm in der Praxis: Analyse von vorhandener Enneagramm-Praxis und Entwicklung von Handlungsoptionen
4.1. Erste Begegnung mit dem Enneagramm
4.1.1. Erst-Erfahrungen von Geistlichen
4.1.2. Durch Geistliche oder im Rahmen kirchlicher Arbeit
4.1.3. Durch Literatur und mündliche Weitergabe
4.1.4. Im Rahmen therapeutischer Angebote
4.2. Nach der ersten Begegnung
4.2.1. Nicht weiter am Thema interessiert
4.2.2. Dabei geblieben
4.3. Pastorale Handlungsbereiche
4.3.1. Das Enneagramm und die geistliche Begleitung (I)
4.3.2. Geistliche Begleitung als Alternative zu Gruppenarbeit
4.3.3. Geistliche Begleitung als „Therapie“
4.3.4. Enneagramm in der geistlichen Begleitung
4.3.5. Geistliche Begleiter
4.3.6. Enneagramm als Modell für personenbezogene Begleitung
4.4. Das Enneagramm in der Geistlichen Ausbildung von Priestern und Ordensleuten (II)
4.4.1. Geistliche Ausbildung
4.4.2. Das Enneagramm in geistlichen Gemeinschaften
4.4.3. Self-Esteem (Selbstwertgefühl)
4.4.4. Personal-Growth-Initiative ‘PGI’
4.4.5. Herausforderungen der Verantwortlichen
4.4.6. Villasante Ergebnisse
4.4.7. Weitere Kritikpunkte und Vorschläge
4.4.7.1. Enneagramm als Angriffsmittel
4.4.7.2. Die Wahl von Ennegramm-Lehrern bzw. Trainern
4.4.7.3. Wer darf/muss an Enneagramm-Seminaren teilnehmen?
4.4.7.4. Sich das Gelernte zu Eigen machen
4.5. Das Enneagramm in der Jugendarbeit und Jugendpastoral (III)
4.5.1. Identitätsfindung
4.5.2. Begleitung von Jugendlichen
4.5.3. Das Enneagramm und Jugendliche
4.5.4. Die Notwendigkeit für den Begleiter, sich und die Jugend zu ‚kennen’
4.5.5. Beispiele experimenteller Anwendung des Enneagramms im Rahmen von Jugendarbeit
4.5.5.1. Fall 1
4.5.5.2. Fall 2
4.5.5.3. Fall 3
4.6. Zeitpunkt der Enneagramm-Vermittlung
5. Perspektiven und Grenzen: Beobachtungen und Vorschläge in Bezug auf Gegenwart und Zukunft der Enneagramm-Arbeit
5.1. Rückblick und Zusammenführung
5.2. Möglichkeiten der Enneagramm-Arbeit
5.2.1. Menschenkenntnis in der Seelsorge und Pastoral
5.2.2. Dialogmöglichkeiten durch das Enneagramm
5.2.3. Seelsorgliche Professionalität und Enneagramm-Arbeit
5.2.4. Identifikation und Disidentifikation als Beitrag zu Professionalisierung
5.2.5. Bibel, Enneagramm, Gesellschaft (Menschen)
5.2.6. Anwendung des Enneagramms mit vorhandenen Modellen und Denkschulen
5.3. Grenzen des Enneagramms
5.3.1. Gefahr der Verabsolutierung
5.3.2. Erstarrung statt Veränderung und Umkehr
5.3.3. Die Kraft der (Auto)-Suggestion
5.3.4. Prozessuale Veränderung statt zielgerichteter Pragmatismus
5.3.5. Neigung zu „Alleswissern“ und „Kult-Figuren“
5.3.6. Gefahr der Vereinfachung
5.3.7. Typisierungszwang
5.3.8. Herausforderung des richtigen Umgangs
5.3.9 Kritik der Kritiker
5.4. Professionalität und Training
5.5. Enneagramm-Organisationen
5.5.1. Qualifizierung und Zertifizierung
5.5.2. Leitlinien der Enneagramm-Arbeit
6. Zusammenfassung
Anhang
Quellen- und Literaturverzeichnis
Unter dem Titel ‚Alle Wege der Kirche führen zum Menschen‘ bezeichnet Papst Johannes Paul II. in Artikel 14 der Enzyklika „ Redemptor hominis“ den Menschen als den „erste[n] Weg, den die Kirche bei der Erfüllung ihres Auftrags beschreiten muss“ 1, weil dieser Weg „von Christus selbst vorgezeichnet ist und unabänderlich durch das Geheimnis der Menschwerdung und der Erlösung führt.“ 2Da der Mensch im Zentrum des Handelns der Kirche stehen soll, und zwar aufgrund des Handelns Gottes, hat die Kirche den Auftrag erhalten, in ihrem Handeln ebenfalls den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. „Die Kirche, die aus einem eschatologischen Glauben lebt, betrachtet diese Besorgnis des Menschen um seine Menschlichkeit, um die Zukunft der Menschen auf Erden […] als ein wesentliches Element ihrer Sendung“ 3. Dies wird im Vorwort von „ Gaudium et Spes“ als Leitwort des ganzen Dokuments auf den Punkt gebracht, in dem es heißt: „Der Mensch also, der eine und ganze Mensch, mit Leib und Seele, Herz und Gewissen, Vernunft und Willen steht im Mittelpunkt unserer Ausführungen.“ (GS 3)
In der Bibel wird aus dem Handeln Jesu heraus das In-den-Mittelpunkt-Stellen des Menschen bildlich dargestellt, beispielsweise in der Szene, in der Jesus einen Mann mit einer verdorrten Hand am Sabbat heilt. Er fordert den Mann auf, sich in die Mitte zu stellen, und fragt die Umstehenden, was besser sei: ein Leben zu retten oder zu vernichten (Mk 3,1-3). Von Jesu Tat her geleitet, kann sich Interesse am Menschen auch dadurch ausdrücken, dass es Bemühungen gibt, Menschen besser zu verstehen, und es ihnen gleichzeitig ermöglicht wird, sich selbst besser zu verstehen. Diese Arbeit geht von der Hypothese aus, dass dafür das Enneagramm, als psychologisch-spirituelle Charaktertypologie, eine gute Hilfe sein kann.
Als Ausgangspunkt meines Interesses an diesem Thema ist die Erfahrung bei Enneagramm-Seminaren für junge Männer und Frauen von unterschiedlichen Ordensgemeinschaften 2001/2002 in Sambia zu nennen, die von zwei Ordenspriestern geleitet wurden. Die genannten Ordensmänner führten Enneagramm-Seminare und - Workshops auch für andere Gruppierungen durch, z.B. für Jugendliche und verheiratete Paare. Bei meinen ersten Begegnungen mit dem Enneagramm war ich von der Beobachtung beeindruckt, dass viele Teilnehmer, die von den unterschiedlichsten Lebenshintergründen stammten, einen ganz persönlichen Bezug zu diesem Workshop entwickelten. Noch lange nach dieser speziellen Erfahrung konnte ich auf die Eindrücke zurückblicken und sie mit neuen Erfahrungen verknüpfen: sei es im sambischen Staatsfernsehen, in zahlreichen Enneagramm-Veröffentlichungen oder Enneagramm-Veranstaltungen, die ich in Deutschland miterleben konnte. Die Hinweise für den Einsatz des Enneagramms in unterschiedlichen Rahmen waren hinreichend, um den Impuls und das Interesse für eine tiefgehende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Enneagramm zu geben. Ausgangspunkt dieser Forschung ist die Annahme, dass das Enneagramm dazu beitragen kann, Menschen auf persönlicher Ebene in den Mittelpunkt kirchlichen Handelns zu stellen und/oder ihnen diese Möglichkeit selbst zu geben. Die Arbeit möchte die theologischen Begründungen und Argumentationen aufzeigen, wie ein solches Vorhaben ermöglicht werden kann, und dazu Vorschläge unterbreiten, wie besonders im kirchlichen Rahmen eine christlich kompatible Einsetzung des Enneagramms (weiter-) 4entwickelt werden kann.
Читать дальше