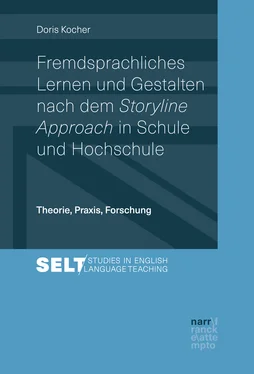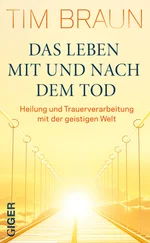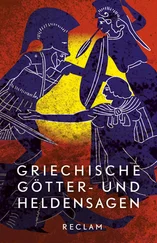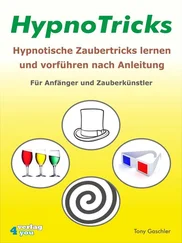3.3.2 Der Soziale Konstruktivismus
In der Psychologie, Soziologie und Kognitionswissenschaft existiert heute eine große Bandbreite an Ansätzen, die sich explizit oder implizit dem konstruktivistischen Paradigma verschreiben und in verschiedenen Anwendungsgebieten zum Einsatz kommen. Gerstenmaier und Mandl (1995) subsumieren die diversen Modelle unter dem Begriff des „Neuen“ Konstruktivismus, der zu Beginn der 1990er Jahre von Spiro, Feltovich, Jacobson und Coulson entwickelt wurde. Spiro u.a. (1992) bezeichnen den „Neuen“ Konstruktivismus als im doppelten Sinne konstruktiv: „a) Bedeutungen werden durch die Verwendung vorausgegangenen Wissens, das hinter momentane Informationen zurückgeht, konstruiert; b) das vorausgegangene Wissen selbst ist konstruiert, nicht einfach aus dem Gedächtnis fallbasiert abgerufen“ (Ebd., 64, Zit. nach Gerstenmaier/Mandl 1995, 870).
Bei dieser insgesamt gemäßigteren Variante des Konstruktivismus handelt es sich um Modellvorstellungen über die Alltagswelt, über abweichendes Verhalten und über verschiedene Sozialbeziehungen, deren gemeinsamer Nenner ihre Konstruktivität ist. Sie stellt weder eine Erkenntnistheorie dar, noch basiert sie auf neurobiologischen Befunden, allerdings beziehen sich einige der Ansätze direkt auf den Radikalen Konstruktivismus, während sich andere eher davon distanzieren. Auch hier existieren wiederum verschiedene „Konstruktivismen“ und noch dazu verschiedene Bezeichnungen für einzelne Ansätze.1
Der Soziale Konstruktivismus – häufig auch als Sozialer Konstruktionismus bezeichnet – gilt als eines der einflussreichsten und etabliertesten Modelle in diesem Bereich. Er steht dem Radikalen Konstruktivismus zwar nahe und geht ebenso davon aus, dass uns die Wirklichkeit nicht objektiv vorliegt, sondern durch Konstruktionsprozesse von uns erst erzeugt wird, allerdings betrachtet er diese Wirklichkeitskonstruktionen nicht als jeweils individuelle Prozesse bzw. Erzeugnisse eines operational geschlossenen kognitiven Systems, sondern als soziale Konstruktionen. Demzufolge wird unser Wissen „immer durch Gesellschaften und soziale Diskursgesellschaften geschaffen“ (Reich 2012, 87), und sämtliche Aussagen über sich selbst und die Welt „sind immer konstruierte Aussagen aus dem Kontext einer Kultur heraus“ (Ebd.). Dieser Aspekt der kulturellen Einbindung wird nach Ansicht der sozialen Konstruktivisten gerade bei Piaget und den radikalen Konstruktivisten zu sehr vernachlässigt (Ebd.). Andererseits sind hier wiederum Parallelen zu Vygotskij und Bruner zu sehen.
Der Soziale Konstruktivismus beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen die Welt (oder besser ihre Wirklichkeit) inklusive sich selbst beschreiben, erklären und begründen und welche Auswirkungen die Gesellschaft auf das Denken, Erleben und Handeln eines Individuums hat. Da der Fokus wieder auf dem denkenden und handelnden Subjekt liegt, ist eine Anknüpfung an den Pragmatismus von Dewey, Mead und James erkennbar (Gerstenmaier/Mandl 1995, 872). Auf Grund dieser – im Vergleich zum Radikalen Konstruktivismus – anderen Schwerpunktlegung und der eindeutig sozial-kulturtheoretischen Auslegung wird der Soziale Konstruktivismus häufig als ein eigenständiger Ansatz betrachtet, auch wenn er einige Gemeinsamkeiten mit dem Radikalen Konstruktivismus aufweist. Er vereint verschiedene Ansätze und stützt sich laut von Ameln (2004) im Wesentlichen auf drei Säulen: Soziologie, postmoderne Philosophie sowie die sozialpsychologischen Beiträge von Kenneth J. Gergen.
3.3.2.1 Einflüsse der Soziologie
Zu den Impulsgebern zählen hier vor allem Berger und Luckmann mit ihrem mittlerweile klassischen Werk Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit (1969) sowie Meads Symbolischer Interaktionismus. Dieser geht der Frage nach, wie Bedeutungen entstehen, und postuliert, dass das Individuum maßgeblich durch die sozialen Bezüge und Interaktionen, in denen es steht, geprägt wird: „Aufgrund dieser elementar sozialen Natur des Menschen konstituiert sich das individuelle Selbst (auch) mit Hilfe sozial geteilter Bedeutungssysteme, z.B. der Sprache. Auf der anderen Seite werden diese sozialen Bedeutungssysteme wiederum durch das Individuum mit hervorgebracht“ (von Ameln 2004, 180). Gesellschaft und Individuum bedingen sich also gegenseitig und können quasi ohne einander nicht existieren.
Berger und Luckmann (1969) vertreten im Gegensatz zum Radikalen Konstruktivismus eine ontologische Position und knüpfen explizit an die Tradition der deutschen Phänomenologie an.1 Ihre zentrale These lautet, dass gesellschaftliches Wissen die Alltagswelt konstruiert und reguliert. Sie bauen auf George Herbert Meads Theorien auf und gehen dabei der Frage nach, wie gesellschaftliche Ordnung entsteht. Sie kommen zu dem Schluss, dass dies (sozial-konstruktivistisch) durch Selbstproduktion erfolgt:
Der Mensch produziert sich selbst, macht seine eigene Natur (...). Dies geschieht durch Prozesse der Externalisierung (Institutionalisierung) und der Internalisierung bereits externalisierter, ‘objektivierter’, in Handlungsroutinen eingebetteter Wirklichkeiten. Soziale Kontrolle, Intersubjektivität und Legitimationen werden von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Sozialisationsprozessen internalisiert (Gerstenmaier/Mandl 1995, 871).
Demnach wird gesellschaftliches Wissen im Rahmen von Sozialisationsprozessen als angeblich objektive Wahrheit gelernt und als subjektive Wirklichkeit internalisiert: „Diese, von Menschen sozial konstruierte Ordnung wird schließlich zu einer Realität sui generis“ (Ebd.).
3.3.2.2 Einflüsse der postmodernen Philosophie
Die postmoderne Philosophie, vertreten beispielsweise durch Jacques Derrida und Michel Foucault, distanziert sich strikt von jeglicher Form der Fortschrittsgläubigkeit sowie der Vorstellung, „dass es eine ultimative Wahrheit gibt und dass die Welt durch einige wenige große Theorien oder Metanarrative verstanden werden kann“ (von Ameln 2004, 181). Bezug nehmend auf Hegels Wort vom „Ende der Geschichte“1 tritt sie vielmehr für die freie Kombination bisheriger Erkenntnismodelle ein.
Derrida betreibt über die Verfahrensweise der Dekonstruktion – radikal kritisch – eine konsequente Infragestellung der abendländischen Metaphysik und richtet seine Kritik insbesondere gegen totalitäre Systeme: „Totalitarismus wird vor allem durch eine normierende Sprache durchgesetzt. Sprache hat eine machterhaltende Funktion, indem sie festlegt, was gut oder schlecht, wahr oder falsch, schön oder hässlich ist“ (Siebert 2005, 26). Deshalb fordert er sprachliche Sensibilisierung und „eine Dekonstruktion allgemein verbindlicher Sätze“ (Ebd.). Der Dekonstruktivismus kann somit als die reflexive Phase des Konstruktivismus betrachtet werden: „Die Wirklichkeitskonstrukte werden wieder verflüssigt, Kategorien wie Geschlecht oder Kultur wieder relativiert, die binären Unterscheidungen wieder differenziert“ (Ebd.).
Michel Foucault, von Marx und Freud beeinflusst, stellt in seinen philosophischen Studien einen Bezug zwischen Wissen und Macht her. Er vertritt die konstruktivistische Position, dass weder human- noch gesellschaftswissenschaftliches Wissen eine Widerspiegelung (Repräsentation) seines Gegenstandes, also des Menschen und der Gesellschaft, darstellt, da „es den Menschen überhaupt nicht unabhängig von diesem Wissen gibt – er ist vielmehr von diesem Wissen konstituiert“ (Collin 2008, 92). Somit ist der Mensch zugleich Objekt und Subjekt verschiedener Wissenschaften, er „ist also zugleich die Instanz, die die Gültigkeitsbedingungen dieser Wissenschaften definiert“ (Ebd., 93). Foucault folgert daraus, dass die Humanwissenschaften als Instrumente der Machtausübung dienen: „Wissen vom Menschen und von der Gesellschaft lässt sich immer als eine Auskristallisierung von bestimmten Haltungen und Absichten ethischer, politischer und administrativer Art betrachten“ (Ebd., 89).
Читать дальше