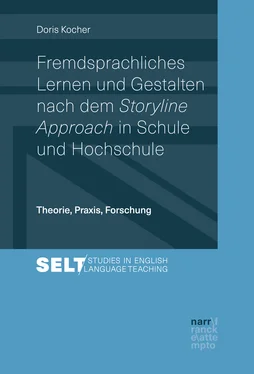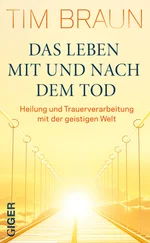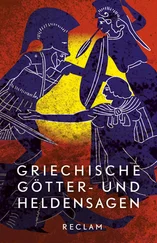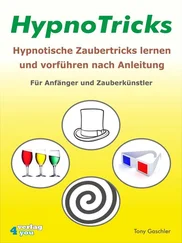Die Grundideen des Radikalen Konstruktivismus sind nicht neu (vgl. Kapitel 3.2). Neu dagegen sind die Begründungen, die mit der oben aufgeführten Kernthese zusammenhängen. Diese lassen sich auf die drei Argumentationslinien aus Gehirnphysiologie, Kognitionswissenschaften und Systemtheorie zurückführen (Gerstenmaier/Mandl 1995), wobei der Neurobiologie eine besondere Rolle zukommt, da durch sie die Grundthesen des Radikalen Konstruktivismus naturwissenschaftlich bzw. empirisch fundiert werden. Nachfolgend sollen nun einzelne einflussreiche Positionen der „Gründerväter“ erörtert werden, um später entsprechende Ableitungen für förderliche Lernumgebungen formulieren zu können.
3.3.1.1 Humberto M. Maturana und Francisco J. Varela
Der chilenische Biologe und Neurokybernetiker Humberto R. Maturana1 und sein Mitarbeiter Francisco J. Varela entwickelten die Autopoiesis-Theorie, die einen wesentlichen Baustein innerhalb des konstruktivistischen Denkgebäudes darstellt. Maturana betrachtet das menschliche Nervensystem als operational geschlossenes System, das von außen zwar Energie (Quantität), jedoch keinerlei Informationen oder Inhalte (Qualität) aufnimmt, und letztendlich selbst entscheidet, ob es sich durch einen äußeren Reiz anregen lässt. Seine Kernaussage lautet, „dass autopoietische Systeme nicht gezielt von außen beeinflussbar sind“ (von Ameln 2004, 188).
Die oben erwähnte strukturelle bzw. soziale Kopplung ist eng an sprachliche Interaktionen gebunden, jedoch ist Sprache in Maturanas Augen „kein System der Kommunikation mit Hilfe abstrakter Symbole, sondern ein System von Orientierungsverhalten zwischen informationell geschlossenen Organismen“ (Ebd., 74). Nach Maturana ist uns die Welt nur über Beobachtung zugänglich, und diese ist stets an Sprache gebunden. Aus diesem Grund ist es uns nicht möglich, von Beobachtung und Sprache unabhängige – also objektive – Aussagen über die äußere Realität zu machen. Sprache wird somit ein rein konnotativer Charakter zugeschrieben, das heißt, Maturana wendet sich von der lange Zeit gängigen Vorstellung ab, dass Sprache ein denotatives Zeichensystem ist und der Übermittlung von Informationen über eine unabhängige Außenwelt dient. Statt einer Informations übertragung findet also eine stets kontextabhängige Informations konstruktion innerhalb der kognitiven Bereiche von autopoietischen Systemen statt. Dies dient „dem Aufbau eines gemeinsamen konsensuellen Bereiches“ (Ebd.). Konsens über die Beschaffenheit der Umwelt entsteht jedoch allein auf der Grundlage von Sozialisationsprozessen, die die Mitglieder einer Gesellschaft durchlaufen, sowie der kulturellen Konventionen einer Gesellschaft (Wolff 1994, 412). Maturana und Varela (1987) stellen den Erkenntnisprozess als Verkettung von Handlung und Erfahrung dar: „Jedes Tun ist Erkennen, und jedes Erkennen ist Tun“ (Ebd., 32).2 Sie sprechen von der „Zirkularität“ (Ebd., 31) zwischen Erfahrung, Handlung und Wissen.
Die radikale Autopoiesis-Theorie fand nicht nur Zuspruch, sondern stieß auch auf heftige Kritik3, die Maturana zum Teil in die Fortentwicklung seiner Theorie aufgenommen hat. Zweifelsohne haben Maturanans Thesen weitreichende Konsequenzen für die systemische Praxis (z.B. die Schule): Dadurch dass Interventionen oder Instruktionen offensichtlich nur eine begrenzte Wirkung haben, verliert die Lehrkraft ihren „privilegierten Status überlegenen Wissens“ (von Ameln 2004, 189) und wird allenfalls zur „perturbierenden“ Expertin und Beobachterin, die zum Lernen und (Selbst-)Beobachten anregt. Eigenverantwortlichkeit, Eigendynamik und Selbstorganisation von Systemen gewinnen dagegen einen wesentlich höheren Stellenwert, als dies im regulären Unterricht bisher berücksichtigt worden ist, und fordern verstärkt autonome und selbstorganisierte Lernformen, wie dies beispielsweise in Storyline -Projekten vorgesehen ist (vgl. Kapitel 2.3.3.5). Wie dies im fremdsprachlichen Klassenzimmer realisiert werden kann, sollen meine Fallstudien untersuchen (vgl. Teil B).
3.3.1.2 Heinz von Foerster
Der Biophysiker und Kognitionswissenschaftler Heinz von Foerster1 suchte bereits in den frühen 1960er Jahren nach Lösungen für das Problem der Selbstorganisation und erkannte offensichtlich sehr früh das Innovationspotenzial der Kybernetik. Er bezieht sich in seiner Arbeit auf Maturanas These der operationalen Geschlossenheit kognitiver Systeme und geht der Frage nach, wie bei geschlossenen neuronalen Prozessen „das Erleben einer stabilen Wirklichkeit“ zustande kommt (von Ameln 2004, 85). Seine These lautet, dass Erkennen durch „Errechnen“2 einer Wirklichkeit entsteht. Durch mehrfache Umformung der These kommt er zu dem Schluss, dass der Prozess des Erkennens eine rekursive, selbstbezügliche neuronale Tätigkeit im Sinne von unbegrenzten Errechnungsprozessen darstellt (von Ameln 2004). Dabei verweist er auch immer wieder auf das in der Wahrnehmungspsychologie klassische Experiment mit dem blinden Fleck: „Stets gilt es, so seine ethische Forderung, die eigenen blinden Flecken zu bedenken, die scheinbar endgültigen Aussagen in einem ernsten Sinn als eigenes Produkt zu begreifen und Gewissheiten in jeder Form und Gestalt – immer auf der Suche nach anderen, nach neuen Denkmöglichkeiten – in Zweifel zu ziehen“ (Pörksen 2001, 20).
Heinz von Foersters Konzepte weisen enge Bezüge zu Selbstorganisationstheorien3 wie Chaostheorie und Synergetik auf und gelten als wichtige Grundlagen der systemischen Praxis. Sein Bild der nicht-trivialen Maschine wird als Leitvorstellung für ein Menschenbild gesehen, „das die Komplexität der menschlichen Psyche würdigt und simplifizierenden, rationalistischen Vorstellungen entgegen tritt“ (von Ameln 2004, 91). Diese Vorstellung hat weitreichende Folgen für die Praxis der Menschenführung:
Eine Führungskraft, die die Organisation und die in ihr arbeitenden Menschen nach dem Bild der trivialen Maschine betrachtet, wird demnach eher nach Vereinheitlichung streben, verbindliche Regeln erlassen und mit Hilfe von Anweisungen und Sanktionen führen, während eine Führungskraft, die sich am Bild der nicht-trivialen Maschine orientiert, eher Unterschiede zulassen, nach Formen der Selbststeuerung streben und die Autonomie des Systems fördern wird (Ebd.).
Auf die Schule bezogen wird somit leicht nachvollziehbar, dass die Ursachen für Disziplin- und Lernstörungen (vgl. Kapitel 1.5) nicht zwangsläufig in den einzelnen Schülerinnen und Schülern zu suchen sind, sondern dass diese zu einem großen Teil auch durch die frontal gesteuerte Unterrichtsführung verursacht werden. In Storyline -Projekten dagegen werden die Lernenden nicht als triviale Maschinen gesehen, sondern als individuelle und wertvolle Persönlichkeiten, die im Austausch mit ihrer Arbeitsgruppe zum Gelingen eines Projekts beitragen: Unterschiede sind ausdrücklich erwünscht, denn sie führen zu kreativen und produktiven Lösungen innerhalb der Lernprozesse. Dies sollen meine Studien in Teil B näher beleuchten.
3.3.1.3 Ernst von Glasersfeld
Der Psychologe, Kybernetiker und Kognitionswissenschaftler Ernst von Glasersfeld1 hat die konstruktivistische Theoriebildung durch seine Philosophiegeschichte des Konstruktivismus, seine Beschäftigung mit Piagets Erkenntnistheorie und insbesondere durch sein Viabilitätskonzept beeinflusst, welches hier kurz erläutert werden soll. Auch von Glasersfeld geht in seinen Studien der Frage nach, wie wir eine stabile und verlässliche Welt erleben, wenn Wahrnehmung und Außenwelt nicht übereinstimmen. Dabei behilft er sich zunächst mit Vicos Standpunkt: „Wenn (...) die Welt, die wir erleben und erkennen, notwendigerweise von uns selber konstruiert wird, dann ist es kaum erstaunlich, daß sie uns relativ stabil erscheint. (...) Das heißt ganz allgemein, die Welt, die wir erleben, ist so und muß so sein, wie sie ist, weil wir sie so gemacht haben“ (von Glasersfeld 2002, 28f.).
Читать дальше