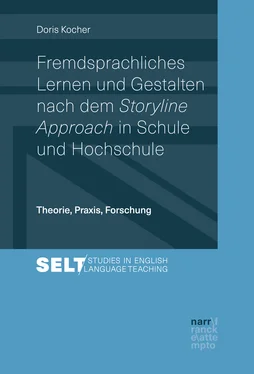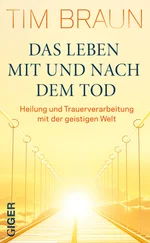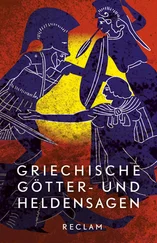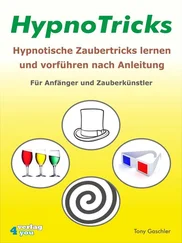Fazit: Das Wissenschaftsideal der postmodernen Philosophie „liegt also nicht im Auffinden der ‘richtigen’ und im Verwerfen der ‘falschen’ Theorie, sondern darin, die Komplexität der Wirklichkeit aus unterschiedlichen Perspektiven mit zahlreichen ko-existierenden, gleichermaßen legitimen Beschreibungen abzubilden“ (von Ameln 2004, 181). Diese Kernaussage wird vom Sozialen Konstruktivismus übernommen.
3.3.2.3 Sozialpsychologische Beiträge von Kenneth J. Gergen
Der amerikanische Sozialpsychologe Kenneth J. Gergen ist ein weiterer wichtiger Vertreter des Sozialen Konstruktivismus.1 In seinen Arbeiten analysiert er die Konstruktion von Sozialbeziehungen und die Prozesse, „in denen Individuen ihre Welt beschreiben und erklären“ (Gerstenmaier/Mandl 1995, 872). Sein Forschungsfokus liegt auf der Sprache, das heißt auf Formen und Inhalten des sozialen Diskurses, und ihrer Bedeutung für die Wirklichkeit des Individuums. Wirklichkeit existiert für ihn „nicht in den Köpfen von Individuen, sondern im kommunalen sprachlichen Diskurs“ (Baecker u.a. 1992, 121). Dabei vertritt Gergen (1985b) die Ansicht, dass sich „die Sprache des Sich-Selbst-Verstehens (...) aus Metaphern, bildlichen Ausdrücken, Sprachfiguren und anderen Konventionen des kommunalen Diskurses“ (Baecker u.a. 1992, 121) entwickelt hat und nicht etwa „aus dem spezifischen Charakter des individuellen Selbst“ (Ebd.). Diese sprachlichen Formen verweisen auf „das kollektive Gedächtnis einer Generation oder eines sozialen Milieus“ (Siebert 2005, 23). Aus diesem Grund hebt Gergen „die pädagogische Bedeutung des Erzählens als eine Form der biografischen Selbstvergewisserung und der sozialen Verständigung“ explizit hervor (Ebd.).
Wirklichkeitskonstruktionen der Individuen und somit auch das Planen und Erleben ganzer Lebensabschnitte erfolgen also im sozialen Diskurs „entlang kommunal hergestellter Denk- und Verhaltensdrehbücher, die im allgemeinen als genuine Ausdrücke unserer ureigensten personalen Identität angesehen werden“ (Baecker u.a. 1992, 123). Diese so genannten Drehbücher, die den narrativen Strukturen in Werken der Literatur, des Theaters oder Films gleichen, geben uns schließlich vor, welche Rollenerwartungen in bestimmten sozialen Situationen an uns gestellt werden. Baecker u.a. (1992) sprechen hier von Sprachskripten, die „nicht nur im Diskurs existieren, sondern unabhängig davon auch eine psychische Realität für den Einzelnen darstellen. Sprachskripte strukturieren das Erleben und sind verhaltensrelevant“ (Ebd., 129). Sprache ordnet und reglementiert unser Denken, Beobachten und Handeln. Unsere Muttersprache, Dialekte, Berufssprachen, Jugendsprache usw. sind also „Ausdruck und Bedingung unserer Wirklichkeitskonstruktion“ (Siebert 2005, 24).
Ziel der sozial-konstruktivistischen Forschung ist nicht nur, die Wirklichkeit zu erklären und zu re konstruieren, sondern sie auch zu de konstruieren, indem offengelegt wird, dass soziale Konstruktionen willkürlich und veränderbar sind. Gleichzeitig sollen im Prozess der Dekonstruktion auch die Verhältnisse hinterfragt werden: „Durch das in Frage stellen der Beziehung zwischen Wort und Welt erscheinen alle Ansprüche auf Wahrheit, die mittels der Sprache vorgebracht werden, als fragwürdig“ (Gergen 2002, 45). Dies gilt nach Gergen (2002) nicht nur für den Alltag, sondern auch für die Wissenschaft, da auch deren Sprache nie neutral ist – worüber ich mir beim Erstellen dieser Arbeit durchaus bewusst bin.
Der Soziale Konstruktivismus betrachtet wissenschaftliche Theorien „als kommunale Mythen (...), als Sprachspiele, die keine objektive Realität abbilden, sondern die von ihnen beschriebene Wirklichkeit erst schaffen“ (von Ameln 2004, 182), da sie stets von unterschiedlichen Interessen, Zielen und Motiven geleitet werden, die bei ihrer Bewertung berücksichtigt werden müssen.2 Auch wenn die geforderte Akzeptanz und Toleranz gegenüber ko-existierender Theorien mehr als wünschenswert ist, darf natürlich nicht übersehen werden, dass damit auch das Problem der Beliebigkeit mit den entsprechenden Folgen für die Gestaltung und Bewertung von Wirklichkeiten in Betracht gezogen werden muss: Der berühmte Slogan von Paul Feyerabend (1976) “ anything goes “ kann so oder so ausgelegt werden ...
Der Soziale Konstruktivismus liefert aufschlussreiche Beiträge für Forschungsrichtungen wie Gender Studies oder Cultural Studies . Darüber hinaus lassen sich bedeutsame Erkenntnisse für die schulische Praxis gewinnen. In Storyline -Projekten beispielsweise übernehmen die Lernenden immer wieder verschiedene Rollen (z.B. Elternteil, Polizist); im Rollenspiel erfahren sie „hautnah“ die sich daraus ergebenden Handlungsperspektiven und Kommunikationsmuster, die sich auch in der verwendeten Sprache inklusive Gestik und Mimik niederschlagen. Durch das spielerische Ausprobieren und Reflektieren neuer (auch unsinniger) Wirklichkeitskonstruktionen trägt die Storyline -Arbeit dazu bei, die diversen Prozesse und Strukturen bewusst zu machen. Dies scheint mir ein besonders wichtiger Aspekt hinsichtlich der anzustrebenden interkulturellen kommunikativen Kompetenz, so dass Storyline -Projekten auch (aber nicht nur) im bilingualen Unterricht eine besondere Bedeutung zukommt. Darüber hinaus erproben und reflektieren die Lernenden im fiktiven Kontext diverse Problemlöseverfahren, was dazu beiträgt, dass sie eine Vielzahl an möglichen Sichtweisen und Handlungen kennenlernen und im günstigen Fall entsprechende Situationen im „richtigen“ Leben gewinnbringend meistern können. Nicht zu unterschätzen ist ferner der Aspekt der Re- und Dekonstruktion mit den entsprechenden Auswirkungen auf das interkulturelle Lernen, das Arbeiten in Gruppen sowie die Medienrezeption: Schülerinnen und Schüler lernen in Storyline -Projekten, die Dinge inklusive der eigenen und fremden „Wahrheiten“ zu hinterfragen und (wenn nötig) auf den Kopf zu stellen sowie Verständnis, Respekt und Toleranz für das Denken und Handeln ihrer Mitmenschen zu entwickeln. Dies ist meines Erachtens ein wichtiger Beitrag zur fächerübergreifenden Erziehungsarbeit im Sinne der Persönlichkeitsbildung in der Schule. Ob diese Ziele in der Fremdsprache tatsächlich realisierbar sind, sollen meine Fallstudien zeigen.
3.3.3 Zusammenschau und Diskussion der Ansätze
In den vorangegangen Kapiteln wurde einige Kernthesen des Radikalen und des Sozialen Konstruktivismus erörtert und zum Teil mit praxisrelevanten bzw. kritischen Kommentaren versehen. Nachfolgend sollen die beiden Ansätze im Sinne einer Zusammenfassung verglichen werden, danach wird sich eine kurze kritische Reflexion der konstruktivistischen Ansätze (als Ganzes betrachtet) anschließen.
3.3.3.1 Radikaler und Sozialer Konstruktivismus: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Was die beiden Ansätze vereint, ist die Tatsache, dass beide die Vorstellung der objektiven Erkenntnis ablehnen und die Wirklichkeit als eine Konstruktion auffassen, die von uns aktiv vollzogen wird. Viele Vertreterinnen und Vertreter des Sozialen Konstruktivismus distanzieren sich jedoch von erkenntnistheoretischen Fragen. Gergen (2002) vertritt beispielsweise die Ansicht, dass es nicht darum geht, zu entscheiden, was real ist und was nicht, da dies ohnehin nicht möglich sei: „Was immer ist, ist einfach. Sobald wir jedoch das, was ist, zu artikulieren versuchen – und festlegen wollen, was tatsächlich und objektiv der Fall ist –, betreten wir eine Welt des Diskurses“ (Ebd., 276). Eine ähnliche Position vertreten Baecker, Borg-Laufs, Duda und Matthies (Baecker u.a. 1992). Dennoch sind hier Parallelen zum Radikalen Konstruktivismus erkennbar, wie die folgenden Zitate verdeutlichen: „Alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt“ (Maturana 1998, 25). Oder: „Wenn immer man denkt oder sagt: es ‘gibt’ eine Sache, es ‘gibt’ eine Welt, und damit mehr meint als nur, es gibt etwas, das ist, wie es ist, dann ist ein Beobachter involviert“ (Luhmann 1990, 62). Auch Singer (2002) spricht bekanntlich von einem „Beobachter im Gehirn“.
Читать дальше