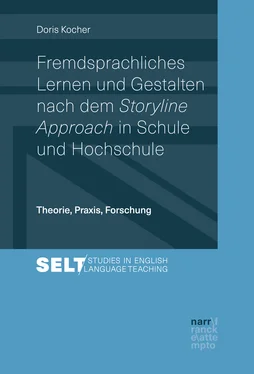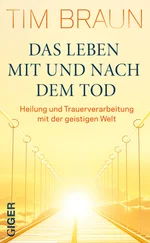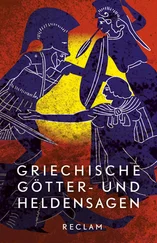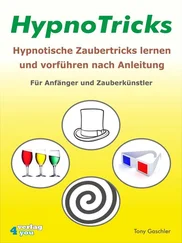3.3 Neuere Varianten und Kernthesen des Konstruktivismus
Man kann nur finden, wonach man sucht, nur das erfahren, wonach man fragt (von Ameln 2004, 163)
In den vorangegangenen Kapiteln wurden einige wichtige Vorläufer und Vordenker des Konstruktivismus aufgeführt, die bezeichnenderweise aus ganz unterschiedlichen Disziplinen stammen. In meinen Ausführungen bleiben ohne Zweifel Lücken; so kann beispielsweise auf die Gestaltpsychologen1 Max Wertheimer, Wolfgang Köhler und Kurt Koffka der „Berliner Schule“, die frühen Gedächtnisexperimente von Bartlett (1932) oder auf die kognitiven Theorien der Wahrnehmung und des Verstehens von Neisser (1967), die alle ebenfalls als „semikonstruktivistische“ Ansätze betrachtet werden (Müller 1996b, 72), nur verwiesen werden.
Während noch vor einigen Jahren auf interdisziplinärer Ebene eine Grundsatzdiskussion um „den“ Konstruktivismus geführt wurde und dieser – auch im Bereich der Fremdsprachendidaktik – entweder abgelehnt oder befürwortet wurde, ist diese (beinahe feindselige) Auseinandersetzung mittlerweile deutlich abgeebbt, was nicht nur damit zu tun hat, dass neue Erkenntnisse aus der Hirnforschung und anderen Forschungsbereichen einen entsprechenden Beitrag geleistet haben, sondern auch, dass zwischenzeitlich zahlreiche Versuche unternommen wurden, Begriffe zu definieren, Positionen zu erörtern sowie die diversen Ansätze zu systematisieren, um weitere Anlässe für Irritationen und Provokationen zu vermeiden.
Im inter- und intradisziplinären Dialog hat sich gezeigt, wie oben bereits angedeutet wurde, dass unter dem Begriff „Konstruktivismus“ ganz unterschiedliche und teilweise konträre Vorstellungen subsumiert werden, die stellenweise nicht der Sache entsprechen. Dabei wurde auch erkannt, dass es „den“ Konstruktivismus nicht gibt, sondern dass stattdessen in den Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften eine bemerkenswerte Bandbreite an unterschiedlichen Ansätzen mit extremen und gemäßigten Positionen existiert, die sich ergänzen, überschneiden oder aber voneinander abgrenzen. So sind in den letzten Jahren neue Varianten entstanden, während etablierte Modelle weiter ausdifferenziert und modifiziert wurden. Zwischenzeitlich gibt es auch zahlreiche konstruktivistische Modelle in der Instruktionspsychologie und der Empirischen Pädagogik2, Entwürfe für einen so genannten Pädagogischen Konstruktivismus3, für eine so genannte Konstruktivistische Didaktik4 oder für eine so genannte Konstruktivistische Fremdsprachendidaktik5 sowie unzählige Konzepte und Methoden mit explizit bzw. implizit konstruktivistischen Positionen.6
Die diversen konstruktivistischen Ansätze beziehen sich auch nicht etwa auf eine gemeinsame theoretische Problemstellung, sondern stimmen – wie bereits angedeutet – in der folgenden erkenntnistheoretischen Grundüberzeugung überein:
1) Das, was wir als unsere Wirklichkeit erleben, ist nicht ein passives Abbild der Realität, sondern Ergebnis einer aktiven Erkenntnisleistung.
2) Da wir über kein außerhalb unserer Erkenntnismöglichkeiten stehendes Instrument verfügen, um die Gültigkeit unserer Erkenntnis zu überprüfen, können wir über die Übereinstimmung zwischen subjektiver Wirklichkeit und objektiver Realität keine gesicherten Aussagen treffen (von Ameln 2004, 3).
Allgemein gesprochen können die diversen Ansätze auf ihren Theoriekontext bezogen jedoch grob in zwei Bereiche aufgeteilt werden (Gerstenmaier/Mandl 1995, 868):
Der Radikale Konstruktivismus als Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie
Der Soziale Konstruktivismus bzw. Soziale Konstruktionismus
Darüber hinaus existieren noch zahlreiche verwandte Positionen, die den beiden Richtungen nahestehen oder sich daraus entwickelt haben.7 In den folgenden Kapiteln werden einige Ansätze des Radikalen und Sozialen Konstruktivismus vorgestellt, da sie eindeutige Bezugspunkte zum Lernen nach dem Storyline Approach aufweisen. Ferner werden einige ihrer jeweiligen Hauptvertreterinnen bzw. -vertreter und deren Kernthesen genannt. Auf Grund der Komplexität der einzelnen Theorien und Modelle kann hier keine ausführliche Darstellung und Diskussion der unterschiedlichen Perspektiven erfolgen.
3.3.1 Der Radikale Konstruktivismus
Der Radikale Konstruktivismus1 – sein Name ist Programm – wird häufig als Prototyp des konstruktivistischen Denkens bezeichnet, zumal er quasi als Sprungbrett und Quelle der Inspiration für eine Vielzahl von weiteren Ansätzen gilt. Da dieser Ansatz für die Gestaltung von Lernumgebungen eine Reihe äußerst relevanter Erkenntnisse vermittelt, die in der Vergangenheit jedoch teilweise missverstanden und somit zum Streitpunkt wurden, möchte ich hier etwas differenzierter vorgehen als bei den sozial-konstruktivistischen Positionen, die später vorgestellt werden (vgl. Kapitel 3.3.2).
Der Radikale Konstruktivismus ist keine eigene Wissenschaftsdisziplin oder in sich geschlossene Erkenntnistheorie, sondern „eine disziplinübergreifende erkenntnistheoretische Plattform, die dem etablierten Paradigma des Realismus (...) entgegen tritt“ (von Ameln 2004, 187) und zum Teil auf den zuvor erwähnten frühen Forschungsarbeiten aufbaut. Dabei bemühen sich die einzelnen Vertreterinnen und Vertreter um eine „Theorie des Wissens“, und nicht etwa um eine „Theorie des Seins“, wie Ernst von Glasersfeld (1992, 34) immer wieder explizit betont. Den radikalen Konstruktivisten geht es um das Verhältnis, in dem Wissen zur Welt und zur Wirklichkeit steht, also um die Frage, „was Wissen ist und woher es kommt“ (von Glasersfeld 1993, 23, Zit. nach Gerstenmaier/Mandl 2000, 4), oder mit den Worten von Paul Watzlawick, der hier für den Begriff „Wirklichkeitsforschung“ (Watzlawick 2002, 10) plädiert: „Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben?“2.
Zu den Begründern des Radikalen Konstruktivismus zählen insbesondere Heinz von Foerster (1911-2002), Ernst von Glasersfeld (1917-2010) sowie Humberto R. Maturana (1928-) und sein Mitarbeiter Francisco J. Varela (1946-2001). Ein weiterer einflussreicher Vertreter ist zweifelsohne Niklas Luhmann (1927-1998). Paul Watzlawick (1977; 2002) war es schließlich, der den Radikalen Konstruktivismus in Deutschland populär gemacht hat. Als weitere wichtige Konstruktivisten im deutschen Raum gelten vor allem die Hirnforscher Gerhard Roth (1997; 2001; 2003a; 2003b; 2006; 2009) und Wolf Singer (2002; 2006) sowie der Philosoph, Literatur- und Medienwissenschaftler Siegfried J. Schmidt (Hrsg.) (1987; 1992a; 1992b), welcher sich später jedoch vom Radikalen Konstruktivismus etwas distanziert hat.3
Siebert (2005) gelingt es, die diversen Forschungsergebnisse und Strömungen zusammenzufassen und mit wenigen Worten eine aussagekräftige Kernthese des Konstruktivismus zu formulieren, die für unseren Kontext zunächst ausreichen soll:
Menschen sind autopoietische, selbstreferenzielle, operational geschlossene Systeme. Die äußere Realität ist uns sensorisch und kognitiv unzugänglich. Wir sind mit der Welt lediglich strukturell gekoppelt, d.h., wir wandeln Impulse von außen in unserem Nervensystem ‘strukturdeterminiert’, d.h. auf der Grundlage biografisch geprägter psycho-physischer kognitiver und emotionaler Strukturen, um. Die so erzeugte Wirklichkeit ist keine Repräsentation, keine Abbildung der Außenwelt, sondern eine funktionale, viable Konstruktion, die von anderen Menschen geteilt wird und die sich biografisch und gattungsgeschichtlich als lebensdienlich erwiesen hat. Menschen als selbst gesteuerte ‘Systeme’ können von der Umwelt nicht determiniert, sondern allenfalls perturbiert, d.h., ‘gestört’ und angeregt werden (Ebd., 11).
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Existenz einer „Realität“ von den Konstruktivisten geleugnet wird, sondern lediglich, dass alles, was wir von einer äußeren Realität wissen, unsere eigenen Konstruktionen sind, die in sozialen Kontexten „als Ko-Konstruktionen“ stattfinden (Terhart 1999, 18). Dieser Aspekt ist in der Vergangenheit oft missverstanden worden.
Читать дальше