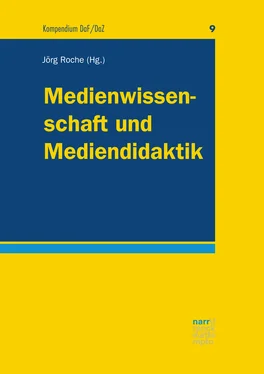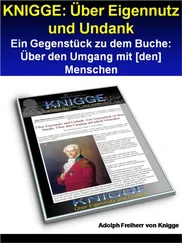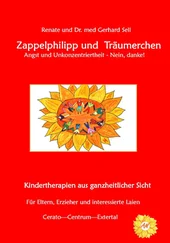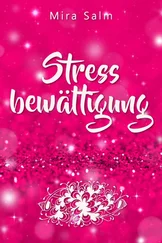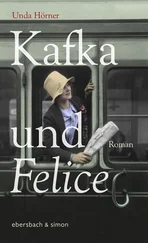Zur kognitiven Ausrichtung
Um zu verstehen, wie die Sprache überhaupt in den Köpfen der Lerner entsteht und sich weiter verändert – und darum geht es in dieser Buchreihe – sind Erkenntnisse aus verschiedenen Nachbardisziplinen der Sprachlehrforschung erforderlich. Die Neurolinguistik kann zum Beispiel darüber Aufschluss geben, welche Gehirnareale wahrend der Sprachverarbeitung aktiviert werden und inwiefern sich die Gehirnaktivität von L1-Sprechern und L2-Sprechern voneinander unterscheidet. Durch die Nutzung bildgebender Verfahren lässt sich die sprachrelevante neuronale Aktivität sichtbar und damit auch greifbarer machen. Was können wir aber daraus für die Praxis lernen? Sollen Lehrer ab jetzt die Gehirnaktivität der Lerner im Klassenraum regelmäßig überprüfen und auf dieser Basis die Unterrichtsinteraktion und die Lernprogression optimieren? Dabei wird schnell klar, dass eine ganze Sprachdidaktik sich nicht allein auf der Basis solcher Erkenntnisse formulieren lässt. Dennoch können die Daten über die neuronale Aktivität bei sprachrelevanten Prozessen unter anderem die Modelle der Sprachverarbeitung und des mehrsprachigen mentalen Lexikons besser begründen, die sonst nur auf der Basis von behavioralen Daten überprüft werden. Ähnlich wie die Neurolinguistik stellt die kognitive Linguistik eine Referenzdisziplin dar, deren Erkenntnisse zwar für die Unterrichtspraxis sehr relevant und wertvoll sind, sich aber unter anderem aufgrund des introspektiven Charakters ihrer Methoden nicht direkt übertragen lassen. Die kognitive Linguistik erklärt nämlich die Sprache und den Spracherwerb so, dass sie mit den Erkenntnissen aus anderen kognitiv ausgerichteten Disziplinen vereinbar sind. So dienen kognitive Prinzipien wie die Metaphorisierung oder die Prototypeneffekte der Beschreibung bestimmter Sprachphänomene. Der Spracherwerb wird seinerseits durch allgemeine Lernmechanismen wie die Analogiebildung oder die Schematisierung erklärt. Die kognitive Linguistik, die Psycholinguistik, die Neurolinguistik, die kognitiv ausgerichteten Kulturwissenschaften sind also Bezugsdisziplinen, die als Grundlage einer kognitiv ausgerichteten Sprachdidaktik fungieren. Sie sollen in den Bänden dieser Reihe soweit zum Tragen kommen, wie das nur möglich ist. Bei jedem Band stehen daher die Prozesse in den Köpfen der Lerner im Mittelpunkt der Betrachtung.
1. Grundlagen des multimedialen Lernens
Die menschliche Kommunikation läuft in den seltensten Fällen rein sprachlich ab. Vielmehr kann man davon ausgehen, dass Kommunikation neben dem Sprachsystem mindestens ein weiteres Kodierungssystem miteinbezieht. In der mündlichen Kommunikation erfüllen Gestik und Mimik eine essenzielle kohärenzstiftende Funktion, indem zum Beispiel räumliche Aspekte mit den Händen verdeutlicht werden. Dabei kommt es auch vor, dass die Gestik aufgrund kulturbedingter Interpretation zu Missverständnissen führt, wie zum Beispiel das Kopfschütteln, das in manchen Kulturen als Zeichen der Zustimmung gilt. Auch in der schriftlichen Kommunikation spielt vor allem die Verwendung von Bildern (Fotos, Graphiken, Symbolen, Smileys etc.) eine besonders wichtige Rolle, wie sich unter anderem in den Bereichen der Werbung, der Presse oder der virtuellen Kommunikation beobachten lässt. Im Kontext der Sprach- und Kulturvermittlung erscheint es daher sinnvoll, neben dem Sprachgebrauch auch den adäquaten Umgang mit Bildern und anderen Elementen nonverbaler Kommunikation zu fördern. In diesem Kapitel wollen wir der Frage nachgehen, welche Besonderheiten die Text- und Bildverarbeitung in der Fremdsprache aufweist. Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen daher die L2-spezifischen Aspekte der Text- und Bildverarbeitung im Kontext der allgemeinen Kommunikation sowie die Gelingensbedingungen für den Einsatz von Text und Bild in Lernmaterialien. Zur Beantwortung dieser Fragen werden zunächst die Theorien des multimedialen Lernens behandelt und daraus wichtige Prinzipien für das Design multimedialer Materialien abgeleitet. Danach wird die Umsetzung dieser Designprinzipien in Lernmaterialien am Beispiel der Grammatikanimationen gezeigt. Anschließend wird Sprachenlernen aus der Perspektive der Multimedialität und der Multimodalität betrachtet.
1.1 Multimediales Lerndesign
Ferran Suñer Muñoz & Jörg Roche
In dieser Lerneinheit wollen wir uns mit den wichtigsten Prinzipien zur Gestaltung multimedialer Materialien beschäftigen. Diese Prinzipien bieten Lehrkräften einen theoretisch fundierten und empirisch gestützten Orientierungsrahmen bei der Erstellung von Materialien, die Bilder und Text miteinander kombinieren. Dabei kann es sich um graphische Übersichten über landeskundliche Sachverhalte, Aufgabensequenzen zu einem Video oder einfach um die eigene PowerPoint-Präsentation für den Unterricht handeln. Diese Lerneinheit geht den Fragen nach, welche Prinzipien sich aus den Theorien des multimedialen Lernens ableiten und wie sie sich auf multimediale Lernmaterialien für das Fremdsprachenlernen anwenden lassen. Zur Beantwortung dieser Fragen soll die Theorie von Mayer (2005a, 2009) vorgestellt werden, die die wichtigsten Erkenntnisse der Vorgängermodelle zu einem integrierten Modell zusammenführt. Danach sollen aus Mayers Modell die wichtigsten Designprinzipien abgeleitet und vor dem Hintergrund der bisherigen empirischen Forschung präsentiert werden. Die Lerneinheit schließt mit der Diskussion einiger Beispiele für eine gelungene Umsetzung der Designprinzipien in Lernmaterialien ab.
Lernziele
In dieser Lerneinheit möchten wir erreichen, dass Sie
erklären können, wie sich die verschiedenen Designprinzipien anhand der Theorien des multimedialen Lernens begründen lassen;
anhand der Designprinzipien multimediale Lernmaterialien im Kontext des Fremdsprachenlernens evaluieren und optimieren können.
1.1.1 Theoretische Grundlagen von Designprinzipien
Viele Designprinzipien wie das Multimediaprinzip, nach dem die Darbietung von Bild und Text zu besseren Lernergebnissen führen soll als die Darbietung von Text alleine, oder das signaling -Prinzip, nach dem wichtige Aspekte des Lernmaterials hervorgehoben werden sollen, klingen fast wie selbstverständlich, sind jedoch aus komplexen Theorien entstanden und in zahlreichen empirischen Studien erforscht worden. In diesem Abschnitt soll zunächst das Modell von Mayer (2005a, 2009) präsentiert werden, das als Grundlage für die Formulierung der Designprinzipien genommen wird. Unter Rückgriff auf die Vorgängermodelle von Baddeley (1986) und Paivio (1990) sowie auf die cognitive load theory von Sweller & Chandler (1991), versucht das Modell von Mayer auf folgende drei Fragen zu antworten:
1 Wie interagieren die verschiedenen Verarbeitungskanäle des Arbeitsgedächtnisses miteinander beim multimedialen Lernen?
2 Welche Rolle spielt die begrenzte Verarbeitungskapazität des Arbeitsgedächtnisses beim multimedialen Lernen?
3 Welche Prozesse sind für sinnvolles und nachhaltiges multimediales Lernen notwendig?
Zu Frage 1: Mit der sogenannten dual channel assumption geht Mayer (2005a) davon aus, dass beim multimedialen Lernen hauptsächlich zwei separate, aber miteinander verknüpfte Verarbeitungskanäle involviert sind. Er differenziert zwischen einem visuell-piktorialen und einem auditiv-sprachlichen Kanal, die jeweils Aspekte der sensorischen Modalität (visuell versus auditiv) und des Präsentationsmodus (piktorial versus sprachlich) miteinander kombinieren. Das heißt also, dass jeder dieser beiden Kanäle auf eine bestimmte sensorische Modalität und Kodierungsart spezialisiert ist.
Zu Frage 2: Ähnlich wie bei der cognitive load theory (Sweller & Chandler 1991) geht Mayer auch von einer limitierten Verarbeitungskapazität des Arbeitsgedächtnisses aus, die allerdings für beide Kanäle unterschiedlich ist (vergleiche limited capacity assumption , Mayer 2005a, 2009). Das heißt also, dass der visuell-piktoriale und der auditiv-sprachliche Kanal jeweils eine eigene Verarbeitungskapazität haben, die unabhängig voneinander zu betrachten sind. Daraus ergibt sich also, dass die Verarbeitung von Bild und Text die beiden Kanäle optimal nutzen sollte, um jeweils Überbelastungen zu vermeiden. Weiterhin merkt Mayer an, dass die limitierte Verarbeitungskapazität der beiden Kanäle sich nicht in Form von einer konkreten Anzahl von Items ausdrückt, da dies stark von Faktoren wie dem Chunking, den individuellen Lernvoraussetzungen, den Übungseffekten sowie der Nutzung bestimmter metakognitiver Strategien abhängt (vergleiche Mayer 2005a: 35f). Letzteres wird nach Mayer als die Kernfunktion der von Baddeley postulierten zentralen Exekutive angesehen.
Читать дальше