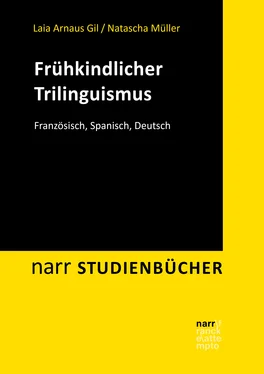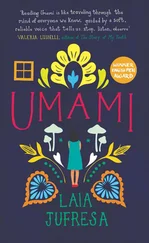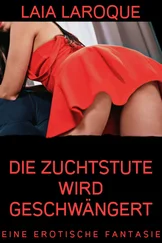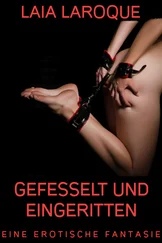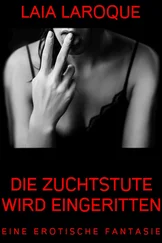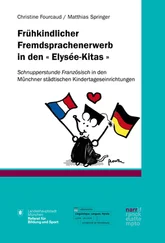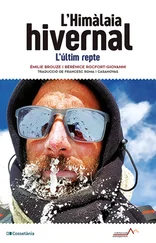Separate Lexika implizieren nicht notwendigerweise separate phonologischephonologisch Systeme. Aus diesem Grund geht MontanariMontanari, Simona (2013) der Frage nach, ob bei Kathryn die phonologischenphonologisch Systeme getrennt vorliegen. Sie kommt auch für diese zu dem Ergebnis, dass eine Trennung von Beginn an beobachtet werden kann (MontanariMontanari, Simona 2013:68).
Zur Ermittlung der sprachspezifischen Wortstellung hat MontanariMontanari, Simona (2013) die Mehrwortäußerungen von Kathryn im Alter von 1;7 bis 2;1 genauer betrachtet. TagalogTagalog ist eine Sprache, in der das Prädikat satzinitial steht. Englisch ist SVO geordnet, das Spanische variiert zwischen SVO und VOS in Abhängigkeit vom Informationsgehalt der einzelnen Konstituenten (vgl. 2.3.2.2)Konstituente. Obwohl die absolute Anzahl an analysierbaren Kombinationen gering ist, kann MontanariMontanari, Simona einen Unterschied zwischen Tagalog und Englisch aufzeigen. Sowohl Kathryn als auch der interagierende Erwachsene verwenden im Tagalog fast ausschließlich Mehrwortäußerungen, bei denen das Prädikat am Anfang steht. Im EnglischenEnglisch dominiert sowohl beim Kind als auch beim Erwachsenen die Abfolge Argument-Prädikat. Im Spanischen finden sich – wie erwartet – sowohl beim Kind als auch beim Erwachsenen beide Abfolgen, Prädikat-Argument und Argument-Prädikat. „These results confirm that Kathryn was displaying different ordering patterns depending on the language in which she was interacting and following input-dependent preferences“ (MontanariMontanari, Simona 2013:69).
MontanariMontanari, Simona (2013) untersucht ferner, inwieweit es Kathryn gelingt, ihre SprachwahlSprachwahl der des Interaktionspartners anzupassen. QuayQuay, Suzanne (2001, 2008), die über einen mit drei Sprachen (JapanischJapanisch, Englisch, Deutsch) aufwachsenden Jungen in Japan und ein mit ChinesischChinesisch, Japanisch und Englisch aufwachsendes Mädchen in Japan berichtet, und ChevalierChevalier, Sarah (2015) zeigen, dass es trilingual aufwachsenden Kindern schwer fällt, die schwache Spracheschwache Sprache zu gebrauchen, wenn diese von ihnen verlangt wird. Die Sprachwahl von Kathryn untersucht MontanariMontanari, Simona im Alter von 1;9-1;11 anhand von Sprachmaterial von insgesamt sechs Stunden, das sie in simultaner Interaktion mit der tagalogsprachigen Mutter, dem spanischsprachigen Vater bzw. der spanischsprachigen Großmutter und einer englischsprachigen Person zeigt. Hierfür wurden Kathryns einsprachige und gemischte Äußerungen analysiert. Bei den gemischten Äußerungen (meistens wurde ein Wort gemischt) wurde anhand von Vokabellisten geprüft, ob Kathryn aufgrund einer lexikalischen Lückelexikalische Lücke ihre Sprachen gemischt hat. In einem weiteren Schritt wurden die Gesprächsstrategien der Erwachsenen als Reaktionen auf Kathryns Mischungen untersucht. Hierbei war von Interesse, ob sich die Interaktionspartner als Reaktion auf die kindliche Mischung monolingual, bilingual oder trilingual verhalten haben. Das generelle Ergebnis ist hier, dass Kathryn in der Tat mehr TagalogTagalog als Englisch bzw. Spanisch mit der tagalogsprachigen Person verwendet; genauso für die anderen beiden Sprachen. Immerhin waren 80 % aller Wortmischungen im EnglischenEnglisch und Tagalog durch das Fehlen eines ÜbersetzungsäquivalentsÜbersetzungsäquivalent bedingt. Im Spanischen betrug die Anzahl nur 60 %, weshalb auch andere Faktoren für die SprachmischungenSprachmischung verantwortlich sein müssen als das Fehlen von Äquivalenten. Während die Erwachsenen SprachmischungenSprachmischung im Tagalog und EnglischenEnglisch eher sanktionierten, verhielten sich die spanischsprachigen Erwachsenen positiv hinsichtlich der SprachmischungenSprachmischung und tolerierten sie nicht nur, sondern förderten sie sogar, indem sie selbst vom Spanischen ins Englische wechselten: „the Spanish-speaking interlocutors repeatedly showed comprehension and appreciation of her English utterances, involuntarily suggesting to her that her mixes were not only being understood but they were appropriate“ (MontanariMontanari, Simona 2013: 71). Abschließend darf mit Hinblick auf die SprachwahlSprachwahl geschlussfolgert werden, dass diese bei Kathryn bereits mit unter zwei Jahren in Abhängigkeit vom Interaktionspartner erfolgt und dass SprachmischungenSprachmischung oft, aber nicht nur Vokabellücken als Grund haben.
Beim Umfeld 2 „Zwei Sprachen zu Hause, eine weitere Sprache im institutionellenInstitution Kontext“ handelt es sich im weiteren Sinne um simultansimultan bilinguale Kinder, die bereits während ihrer Kindheit eine dritte Sprache erwerben. In diesen Studien geht es um den Erwerb einer dritten Sprache im institutionellenInstitution Kontext und die Beantwortung der Forschungsfrage, ob es bilingualen Kindern leichter fällt, eine dritte Sprache zu lernen, als Kindern, die einsprachig in die Institution kommen. Diese Forschungsrichtung ist in den letzten zehn Jahren regelrecht explodiert. Im Gegensatz zu den longitudinallongitudinal (über mehrere Untersuchungszeitpunkte) angelegten Studien des Umfelds 1 werden im Bereich des kindlichen DrittspracherwerbsDrittspracherwerb oft QuerschnittsstudienQuerschnittsstudie angelegt und es wird experimentell gearbeitet (vgl. Kap. 2.1). In den allermeisten Fällen ist die dritte Sprache das Englische. Kenntnisse in mehr als zwei Sprachen haben in den letzten Jahren ebenso die Zweitspracherwerbsforschung (den Erwerb einer Zweitsprache im Erwachsenenalter) beeinflusst. Während in früheren Arbeiten die Tatsache oft unberücksichtigt blieb, dass Lerner neben ihrer Erst- und der (in der Studie untersuchten) Zweitsprache weitere Zweit- bzw. Fremdsprachen (meist das Englische) im institutionellenInstitution Kontext erworben haben und sich Zweitsprachen beim Erwerb gegenseitig beeinflussen, erfährt in neueren Arbeiten durch Ausdrücke wie die erste, zweite, dritte etc. Zweitsprache dieser Umstand besondere Berücksichtigung.
ValenciaValencia, Jose & CenozCenoz, Jasone (1992) betrachten den Erwerb des EnglischenEnglisch im schulischen Kontext im Baskenland. Sie können die Hypothese verifizieren, dass der Bilinguismus einen positiven Effekt auf den Erwerb der dritten Sprache Englisch im schulischen Kontext hat. Der positive Effekt des Bilinguismus wird über die soziale Motivation vermittelt, welche mit Hilfe von vier Kriterien erfasst wird („attitude towards learning, effort, residence in an English-speaking country, and English tuition outside school“ HoffmannHoffmann, Charlotte 2001:8). HoffmannHoffmann, Charlotte (2001:8f.) folgert: „ValenciaValencia, Jose and CenozCenoz, Jasone’s research goes beyond what had previously been done in, for instance, the Canadian context. They develop a structural model with the three latent variables, bilingualism, motivation, and achievement, which shows a causal path linking bilingualism through social motivation with achievement in English“.
Für Kinder, die im Umfeld 3 (vgl. BarnesBarnes, Julia 2006, 2011 zu Studien im Baskenland, HelotHelot, Christine 1988 zu Studien von Familien in Dublin und MurrellMurrell, Martin 1966 zu Studien in Finnland, ab dem Alter von 2;2 des untersuchten Kindes in England) oder gar im Umfeld 4 aufwachsen, besteht ein erheblicher Forschungsbedarf. Studien wie die von ChevalierChevalier, Sarah (2015) sind zwar in der Schweiz entstanden, jedoch im deutschsprachigen bzw. französischsprachigen Teil. Es bleibt unklar, wie die jeweils anderen Sprachen im Umfeld der untersuchten Kinder außerhalb der Familie eine Rolle spielen (vgl. auch ManevaManeva, Blagovesta 2004 zu Kanada, im Besonderen Montreal, und GadlerGadler, Hanspeter & MikešMikeš, Melanie 1986 zu ehemals Jugoslawien). Die meisten Studien wurden in Deutschland (KazzaziKazzazi, Kerstin 2011, BraunBraun, Andreas & ClineCline, Tony 2010, 2014 (hier nicht die Kinder, sondern die Eltern)), England/USA (DavidiakDavidiak, Elena 2010, DewaeleDewaele, Jean-Marc 2000, 2007, EdwardsEdwards, Malcolm & DewaeleDewaele, Jean-Marc 2007, HoffmannHoffmann, Charlotte 1985, Ivir-AshworthIvir-Ashworth, Ksenija Corinna 2011, MontanariMontanari, Simona 2009a,b, 2010, 2013, StavansStavans, Anat 1992, 2001, StavansStavans, Anat & SwisherSwisher, Virginia 2006, WangWang, Xiao-lei 2008), Frankreich (HoffmannHoffmann, Charlotte & WiddicombeWiddicombe, Susan 1999), Israel (FaingoldFaingold, Eduardo 1999, 2000) und Japan (QuayQuay, Suzanne 2001, 2008) durchgeführt. BarnesBarnes, Julia (2011) untersucht die Qualität des InputsInput im EnglischenEnglisch eines trilingualen Kindes (BaskischBaskisch durch den Vater und die Umgebung, Spanisch durch die Umgebung und durch den Babysitter, Englisch durch die Mutter, FamilienspracheFamiliensprache ist das Englische). Die Aufnahmen finden alle zwei Wochen für eine Stunde (Videoaufnahmen) über einen Zeitraum von 18 Monaten, 1;11-3;6, in natürlicher Umgebung statt. In BarnesBarnes, Julia (2011) werden Sprachaufnahmen zwischen 2;9,22 (Jahr;Monat,Tag) und 3;4,7 ausgewählt. Die Hauptfragestellung ist, ob das Englische des trilingualen Kindes den englischen Input widerspiegelt, und ob dieser Input ausreicht, um die Sozialisierung des Kindes in dieser Sprache zu erreichen (BarnesBarnes, Julia 2011:46). Der Erwerb grammatischer Eigenschaften steht nicht im Vordergrund.
Читать дальше