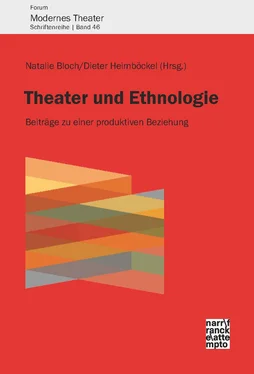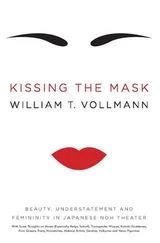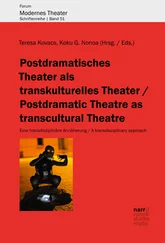Aber der wichtigste Ertrag dieser Entwicklung dürfte die Erfahrung jener sich in jeder vermeintlich ‚einsprachigen‘ Sprache (d.h. in jeder sich als eine einheitliche Nationalsprache präsentierenden Sprache) unverfügbar machenden bloßenSprachlichkeit sein, die sich nicht semantisch auflösen lässt und weder in Übersetzungsprozessen noch in irgendwelchen Erklärungsprozessen innerhalb einerSprache zu ‚klären‘ ist: die „Fremdsprache des bloßen Sprechens“, so Werner Hamacher in dem Aufsatz „Kontraduktionen“, ist wie die Sprache eines „inneren Ausland[s] […], in dem keine politische und keine nationalsprachliche Autorität gilt“.7 Diese Sprachlichkeit ist kein idiomatischer Kern, sondern eher der niemals zu verrechnende Rest, der übrigbleibt, wenn linguistische und hermeneutische Kategorien und Operationen an ihre Grenzen stoßen – ein Eigentümliches, das paradoxerweise keinem Sprecher und keiner spezifischen Sprache als identifizierbare Eigenschaft oder idiomatische Substanz gehört, da es sich – um Novalis’ berühmtes Diktum zu zitieren – „nur um sich selbst kümmert“ und die Absichten und Strategien des wollenden und (gut) meinenden Subjekts sowie der sprachpolitischen Grenzziehungen unterläuft.8 Es könnte am ehesten noch mit Hilfe von Walter Benjamins Begriff ‚Mitteilbarkeit‘ erhellt werden, mit dem ebenfalls auf ein performatives Mitteilen gezielt wird, das nichts Spezifisches mitteilt oder meint bzw. keinen kommunikativen Inhalt, sondern nur unmittelbar die Sprache als Medium vermittelt (oder dazu einlädt, sie miteinander zu teilen). Die Analogie bringt auch die messianische Tendenz von Benjamins Werk ins Spiel. Deren profanere Bedeutung liegt nicht zuletzt in einem impliziten Versprechen, dass die Bereitschaft, sich dem Anderen zu eröffnen, ohne ihn unbedingt verstehen zu wollen oder von ihm verstanden werden zu wollen – Letzteres wäre noch einmal der gute Wille des Verstehens, der den/die Anderen der Bestimmung einer wollenden Subjektivität unterwirft –, zu einer Begegnung im ‚unmittelbaren‘ Medium der Sprache führen kann.9 Sind wir damit vom ursprünglichen Schwerpunkt ‚Theater und Ethnologie‘ ins (zu) weite Feld des Philologischen, Literarischen und (Sprach-)Philosophischen abgedriftet, d.h. in ein Feld, von dem das Theater im zeitgenössischen Sinne, als performative oder aufführungsorientierte künstlerische Praxis, sich vor allem seit der sogenannten postdramatischen Wende hat emanzipieren müssen? Wohl kaum, denn das prekäre Moment des Durchquerens von Sprachlichkeit oder Mitteilbarkeit bzw. ‚Unmittelbarkeit‘ eines Verstehens, das zwar versprochen bleibt, aber keine sichere Auskunft – weder Gelingen noch Scheitern – versprechen kann, betrifft ebenfalls einen wesentlichen Aspekt und eine Möglichkeit des interkulturellen Theaters. Es handelt sich um die Aufgabe, sprachlich bedingte Verstehens- und Verständigungsprozesse samt Missverständnissen durchzuspielen und einen Raum der Begegnung jenseits eines vom ‚guten Willen des Verstehens‘ bestimmten Diskurses zu eröffnen. Der von ethnologischen, anthropologischen und soziologischen Impulsen ausgelöste performative turnin den Kulturwissenschaften und dessen Fruchtbarkeit für theaterwissenschaftliche Theoriebildung und Aufführungsanalyse mögen die sprachphilosophische oder -pragmatische Performativität am Anfang überblendet haben; aktuelle Theatertheorien und Analysemodelle bedienen sich mittlerweile jedoch längst eines hybriden Performativitätskonzepts, in dem sich linguistisch-rhetorische und aufführungsanalytische Ansätze ergänzen.10 Das gilt besonders für solche Performances, in denen die Beziehungen zwischen Sprechakten und deren Verkörperungen hervortreten, Sprechakte also als Handlungen oder Ereignisse oder „unselbstverständliche“ Vorgänge aufgeführt werden, welche die vermeintlich evidente, quasi-natürliche semiotische Beziehung zwischen Sprechendem und Sprache, Körper und Wort in Frage stellen.11 Eine besondere, für das Thema des interkulturellen Theaters als ‚Theater der Anderen‘ sehr relevante Zuspitzung dieser Sprach-Ereignishaftigkeit liegt dann vor, wenn die Fremd- oder Anderssprachigkeit selber reflektiert, die mit ihr verbundene Problematik der Sprach- und/als Kulturzugehörigkeit thematisiert und die Kommunikations- und Verständigungsproblematik mit dem Publikum geteilt und als Moment der Aufführung mitinszeniert wird. Die Inszenierung des Sich-Verständigens als eines performativen Ereignisses ist nur die theatralisierte Vorführung bzw. performancevon auch im Realen sich in bestimmten dramatisch-theatralischen Rahmen und nach einschlägigen (Spiel-)Regeln vollziehenden Sprechakten. Sie ermöglicht es allerdings, einen ‚schrägen‘ Blick auf die Performativität des täglichen Verstehens zu werfen und dessen Nicht-Evidenz zu reflektieren. Edit Kaldor Die Beziehungen zwischen Performativität in dem oben skizzierten, komplexen Sinne und einem (inter-)kulturellen Verstehen sollen im Folgenden am Beispiel der ungarisch-belgischen Theatermacherin Edit Kaldor dargelegt werden.1 Edit Kaldor wurde 1968 in Budapest geboren und emigrierte als Kind mit ihrer Mutter in die Vereinigten Staaten, nachdem sie zuerst ein halbes Jahr in einem österreichischen Flüchtlingslager verbracht hatte. Sie studierte an der Columbia Universität in New York, am University College in London und am DasArts in Amsterdam und arbeitete mehrere Jahre als Dramaturgin und Videokünstlerin für und mit Peter Halasz (Squat theater/Love theater New York), bevor sie mit eigenen Theaterarbeiten bekannt wurde. Ihr Leben und Werk spielen sich zurzeit zwischen Brüssel und Amsterdam ab. In ihren manchmal multimedialen und interdisziplinären Theaterproduktionen, die sehr oft die Grenzen zwischen Fiktivem und Faktischem abtasten und mit dem Genre des Dokumentartheaters spielen, ist immer wieder die Problematik der Kommunikation und des Verstehens zentral, wobei Kaldor selbstverständlich hin und wieder aus ihrer autobiographischen Erfahrung als politischer Flüchtling und Immigrantin schöpft. Und zu dieser Erfahrung gehört nicht zuletzt die Anders- und Fremdsprachigkeit, mit der sie in den verschiedenen kulturellen und sprachlichen Kontexten, in denen sich ihr Leben und ihre Bildung vollzogen haben, konfrontiert worden ist. Leitmotivisch kehrt in Interviews ihre komplizierte Beziehung zur (Mutter-)Sprache zurück; diese wird nicht nur auf die Tatsache zurückgeführt, dass sie so oft in ihrem Leben den sprachlich-kulturellen Kontext gewechselt habe, sondern ganz besonders auch darauf, dass sie, da sie mit dreizehn schon die Heimat verlassen habe, sich in keiner Sprache, auch nicht in der Muttersprache, zuhause oder sicher fühle und keine der von ihr benutzten Sprachen wirklich beherrsche.2 Das nicht-evidente Verhältnis zwischen Sprechen, Kommunizieren und Verstehen sowie die damit (d.h. mit Sprache(n), Fremdwörtern usw.) verknüpften und daraus resultierenden affektiven Aspekte bilden einen roten Faden in Edit Kaldors Theaterproduktionen. Mit ‚nicht-evident‘ ist freilich nicht nur das negative Moment der Kritik rational fundierter Kommunikations- oder aber ‚pfingstlicher‘ Verständigungsideale gemeint; Kaldors Theater lotet vor allem den Raum nicht unbedingt auf rigiden Erkenntnisidealen basierender Verständigungsmöglichkeiten zwischen sturer Skepsis und allzu hoch angesetzten Erwartungen aus. Sie hat sich gewissermaßen zu einer Expertin in den hermeneutischen Möglichkeiten eines Nicht-so-richtig-Verstehens entwickelt. Ihre theatralischen Narrative übersteigen allerdings die sozial-politische Thematik der Emigration und inszenieren Kommunikations- und Verständigungsformen, -modi und -medien – Internet und soziale Medien sind öfters Motive in ihren Produktionen oder werden als reale Mittel (und nicht bloß als Requisiten) eingesetzt – um ethische und existentielle Fragestellungen und Erfahrungen wie Isolation, Unverständnis, Identitätskrisen, die Suche nach tragfähigen Lebens- und Beziehungsformen usw. anzuschneiden.3 Die Aufführungsformen, in denen solche Themen dargestellt werden, lassen sich am besten als theatralisierte künstlerische Forschungs- und Bildungsprozesse begreifen, in denen nicht nur interkulturelle, sondern auch intrakulturelle Fremdheits- oder Differenzerfahrungen erprobt werden und Evidentes durch Verunsicherungsstrategien ‚verfremdet‘ wird. Kaldor untersucht sehr gerne die komplexen Beziehungen zwischen Theater/Kunst und Wissen bzw. zwischen Wissen und Macht, sie führt Experimente vor und aus, die aber selten zu eindeutigen Erkenntnissen führen, sondern vielmehr die trügerischen Fallstricke und Aporien des Verstehen-Wollens des Anderen ‚exponieren‘. Das bedeutet allerdings, dass das Publikum fast immer in ihre Inszenierungen eingebunden wird, freilich nicht bloß in der Rolle des ‚teilnehmenden Beobachters‘, der frei zwischen den Positionen des Teilnehmers und Beobachters schalten und letzten Endes den übergeordneten Standort des Erkenntnissubjekts zurückgewinnen kann. Kaldors Produktionen sind sehr oft darauf angelegt, die Zuschauer zu Komplizen einer scheinbar voyeuristischen Konfiguration zu machen, in der sie sich am Ende selber als Objekte, allenfalls als unwissende oder, durch die Konfrontation mit den (oft sehr materiellen, physischen) Grenzen des Erkennens bzw. Erfahrens, nur beschränkt oder bruchstückhaft wissende Subjekte wiederfinden. Am radikalsten geschah dies in Woe(2013), in dem vier Teenager das Publikum indirekt und schrittweise in das Tabu der Kindesmisshandlung, des Missbrauchs und der Vernachlässigung einführten. Die von der Traumaforschung schon ausgiebig erforschte (Un-)Erzählbarkeit des Traumas4 wurde hier zum Ausgangspunkt eines quasi-wissenschaftlichen und therapeutischen Experiments, das weniger auf die (unmögliche) Enthüllung des Traumas als vielmehr auf die (Un-)Möglichkeitsbedingungen und Grenzen des Nachempfindens von physischem und psychischem Leid eines Jugendlichen durch Erwachsene zielte; deren Einbildungskraft und Erinnerungsvermögen wurden durch experimentelle Übungen und psychotechnische Spiele auf solche Weise stimuliert, dass wenigstens eine Art mentale Regression zustande kam, die den Zuschauer idealiter bis an die Grenzen der eigenen Jugendzeit und der damaligen Existenz- und Welterfahrung führte, freilich auch mit den Möglichkeiten und Grenzen der Erzählbarkeit eigener großer oder kleiner Traumata konfrontierte. Die Selbstverständlichkeit, mit der man sich gerne und besten Willens dem Anderen und Fremden zuwendet, um ihn (sie) an den eigenen vertrauten Lebensformen zu messen, wird in Kaldors Vorstellungen auf eine solche Weise pervertiert, dass man sich ‚selbst‘ bzw. das eigene Leben am Ende dermaßen als bizarre und prekäre Kontingenz empfindet, dass sich jeder klare Begriff des Eigenen und des Fremden, des Normalen und der Ausnahme als obsolet herausstellt. Wissenschaftliche und hermeneutische Überlegenheit verwandelt sich allmählich in Verlegenheit, die aber nicht unbedingt zu einer radikalen Skepsis hinsichtlich Verstehens- und Verständigungsmöglichkeiten zu führen braucht. Die Illusionen über ein repräsentierbares Wissen um eigene oder andere bzw. fremde Lebenserfahrungen und -formen sollen durch eine differenziertere Haltung ersetzt werden, die – so ließe sich Kaldors Anliegen (oder besser: ihr Glauben) mit Derrida umschreiben – sich in den Bruch wagt, der einem genuinen Sichannähern und Begegnen und einem Verstehen des Anderen wesentlich vorangeht: der Bruch des Bezugs, der auch der Bruch alsBezug ist.5 Dieser Bruch als Bezug lässt sich begrifflich kaum denken/sagen, er braucht vielleicht ein ästhetisches Dispositiv, eines wie das Theater von Kaldor, in dem Beziehungs- und Beobachtungsdramaturgien erprobt werden, die die übliche performative Beziehung zwischen Wissen und Macht bzw. Willen zum Verstehen unterbrechen und dadurch eine andere Beziehung wenigstens als Möglichkeit erahnen lassen. Diese andere Beziehung scheint eher auf Zulassen und Sich-ereignen-Lassen, d.h. auch auf Vertrauen, Gelegenheit und Chance abzuzielen als auf die Performanz eines gelungenen Verstehen-Wollens und Vorstellens des Anderen bzw. Fremden. C’est du Chinois C’est du Chinoisist eine der erfolgreichsten internationalen Produktionen von Edit Kaldor. Sie war in vielen europäischen Städten, von Göteborg bis Lissabon, von Graz bis Rotterdam und schließlich auch in New York zu sehen. Die Vorstellung dreht sich – grob gesagt – um eine chinesische, aus Shanghai nach Europa (bzw. dem jeweiligen Ort der Vorstellung) emigrierte Familie, die in der ‚fremden‘ Gesellschaft damit Fuß zu fassen versucht, dass sie (dem von der Immigrationsbehörde geforderten Projekt bzw. Business-Plan entsprechend) interaktive Intensivkurse in Mandarin mittels eines selbst entworfenen didaktischen Konzepts anbieten will. Das Publikum, das mit der beruhigenden Mitteilung „language no problem“ in die Vorstellung gelockt wurde, sieht sich zunächst mit einer entgegengesetzten Situation konfrontiert: die SchauspielerInnen sprechen nurchinesisch und das kommt der Mehrzahl der Zuschauer eben chinesisch (oder spanisch) vor; aber bald zeigt sich, dass die Vorstellung das scheinbar trügerische Versprechen „language no problem“ in der Vorstellung performativ beweisen will, indem diese den wenigstens minimalen Erwerb der Fremdsprache zum eigentlichen Gegenstand der performanceerhebt, oder einen solchen Erwerb zur Bedingung eines gelungenen (verständlichen) Theaterabends macht. Das Publikum sieht sich sofort in die (Haupt-)Rolle der aktiven Teilnehmer einer Sprachstunde versetzt, die im Hinblick auf den (aufgeschobenen) Genuss eines künstlerischen Theaterstücks zunächst die zum Verständnis des Folgenden notwendigen Vokabeln zu pauken hat. In einem Fernsehinterview für CRTV – den Sender für die chinesische Gemeinschaft in den Niederlanden und für alle dort an der chinesischen Kultur interessierten Bürger – reagierte Kaldor zunächst gespielt störrisch auf den enthusiastischen Interviewer, der sofort wissen wollte, worüber das Stück handle und was denn die Geschichte sei („What is the play about? What’s the story?“)1 Das, so Kaldor zögernd, seien zwei verschiedene Fragen. Die undifferenzierte Fragestellung machte sie nicht nur deshalb ein wenig stutzig, weil die Frage nach der aufgeführten Geschichte eine andere war als die nach dem Spiel als ästhetisch-theatralischer Aufführung, und Letztere noch nicht identisch war mit der Frage, was in der Aufführung auf dem Spiel steh („What is it about?“); ihr Zögern ging auch darauf zurück, dass diese Differenzierungen sich noch einmal in der Vorstellung selber wiederholen, freilich umgekehrt, denn was da vorgeführt oder gespielt wird – eine chinesische Familie, die uns mit anfänglich ansteckender und für Europäer auch wohl ein wenig irritierender Begeisterung mit einer gar nicht langweiligen, zunächst sogar lustigen Stunde Mandarin aufwartet – steht ein wenig quer zu der latenten Geschichte, in der es weniger zu lachen gibt, obwohl die große Tragik ausbleibt. Das alles macht es nicht so leicht, das ‚was‘ vom ‚wie‘ zu trennen und zu sagen, was hier nun eigentlich gespielt wird und wo der Hund begraben liegt. Kaldor versucht das im Interview zu erklären, indem sie schließlich doch etwas über die Geschichte enthüllt. Die chinesische Familie, die eigentlich schon eine Variante der neu zusammengesetzten Familie ist (Mutter, verheirateter Sohn und Teenager-Sohn, Schwiegertochter und Schwiegervater) bieten dem Publikum eine Stunde Sprachkurs Mandarin für Anfänger an, sie führen wenigstens eine solche Sprachlektion auf, wobei das Publikum in die Rolle der Schüler, letzten Endes aber auch in die Rolle der Kunden einer geschäftlichen Transaktion (die auch einen ästhetischen ‚Konsum‘ zeitigen soll) gezwungen wird. Am Ende wird die DVD zum Zweck des Selbststudiums (und einer performanten Verwirklichung des Businessplans) verkauft. Die Chinesen sind aus einer gewissen Perspektive die uns wohl am meisten vertrauten Fremden und Anderen in der globalisierten Welt; und auch wenn die ‚Relevanz‘ des Chinesischen wohl kaum erklärt werden muss (der Werbespruch der Vorstellung ist nicht zufällig „ein wichtiger Schritt in die Zukunft“), so geht es Kaldor gar nicht um das Chinesische, es hätte genauso gut Ungarisch oder eine andere Sprache sein können. Oder, so könnte man selber ergänzen, Griechisch ( that’s greek to me), Latein ( dat is Latijn voor mij), Spanisch ( das kommt mir Spanisch vor), double-dutch oder, noch eine französische Variante, c’est de l’hébreu. Das Unverständliche, das Andere spricht viele Fremdsprachen und ist wanderlustig, nomadisch und deshalb auch kontextabhängig. Nicht-Verstehen ist nicht nur zwischen, sondern auch in vielen Sprachen zuhause. Ist das etwa ein indirektes Bekenntnis zum Kulturrelativismus? Kann man sich, ungeachtet der Fremdsprache, mit der man sich verständigen muss oder mit der man konfrontiert wird, verstehen? Wird von Kaldor etwa suggeriert, es gebe ein universelles Verstehen jenseits des partikularen Verstehens, eben weil wir doch alle Menschen sind? Kaldor suggeriert vielmehr, dass ihre eigenen Erfahrungen als Immigrantin, die in diese Vorstellung eingeflossen sind, zu einer verschärften Aufmerksamkeit für das Nicht-Verstehen im Verstehen sowie für das Verstehen im Nicht-Verstehen geführt haben, zu dem sich listig verschiebenden Bruch, der die Beziehung zum fremden Anderen nicht nur kompliziert, sondern überhaupt erst ermöglicht. Und dann gibt es noch etwas anderes: Die Vorstellung ist natürlich nicht nur die Aufführung einer Stunde Mandarin für Anfänger; sie erzählt oder besser, zeigt, auf einer anderen Ebene auch das kleine Drama der aus Shanghai ausgewanderten Familie, die, wie gesagt, eine aus zwei ungleichen Teilfamilien zusammengestückelte ist: eine Mutter, die unbedingt will, dass es ihr ältester Sohn im westlichen Kapitalismus schafft, der Sohn, der unter diesem Druck hin und wieder zerbricht und in Trunk- und Spielsucht flüchtet, auch weil er seiner jungen, etwas weniger disziplinierten Frau und den Reibungen zwischen Mutter und Schwiegertochter nicht gewachsen ist: Und wo bleibt der Nachwuchs, das ersehnte Enkelkind? Der Schwiegervater neigt zum Faulenzen, vor allem leidet er an Heimweh; er trauert einer Karriere als (wohl nicht sehr erfolgreicher) Schauspieler nach, wie man aus einem Foto, das er dem Publikum zeigt, schließen kann (auch wenn das Foto nicht ihn selber, sondern einen amerikanischen Schauspieler zeigt, damit wir wenigstens von dem uns vertrauten auf das weniger bekannte Fremde schließen können). Er musiziert, rezitiert und singt ein Lied aus einer chinesischen Oper (in dem es angeblich um niederstürzenden Regen geht – oder sind es Tränen?); und der Teenager-Sohn ist eben ein Teenager, die ganze Sache hängt ihm allmählich zum Hals heraus. Das alles bleibt relativ unterschwellig, unausgesprochen, und führt kaum zum Eklat. Man spürt es, sieht es manchmal auch, aber man muss sich schon bemühen; nur wer sich die chinesischen Vokabeln gut gemerkt hat, wird vielleicht etwas von dem psychischen Konfliktszenario unter dem überspannt-lustigen theatralischen Prätext mitbekommen. Wird auf der ersten Ebene nur die Illusion geweckt, dass Kommunikation darin besteht, die richtigen Wörter mit den richtigen Dingen zu verknüpfen, so wird zwischen den Zeilen und Gesten dieses ganz naiven und manchmal komischen Worte-und-Dinge-Theaters, in dem fast gänzlich auf Expressivität, Psychologisierung oder schon irgendwie kodifizierte Körpersprache zum Ausdruck dieser ‚unterschwelligen‘ Realität verzichtet wird, etwas anderes mitkonjugiert, das die Performativität des Sprachkurses als einer vermeintlich effizienten und gelungenen Form interkulturellen Austauschs im Innern unterbricht oder es wenigstens daran ‚hapern‘ lässt. Die geschäftliche Performanz, performancein der Sprache des neoliberalen Globalismus – Vermittlung von Sprachkompetenz und eine geschäftliche Transaktion, die sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer „einen wichtigen Schritt in die Zukunft“ bedeuten könnte –, bleibt scheinbar aufrechterhalten; die Performativität, die sich auf der Ebene der kulturellen Selbstdarstellung und des interkulturellen Austausches vollzieht, artikuliert jedoch eine andere ambivalentere Erfahrung, die auf angestauten Frust und Unverständnis hinweist. Trotzdem gibt es keinen Eklat, keine dramatische Wendung, keine Katastrophe und Peripetie. Aber man ahnt trotzdem, dass aus dem Businessplan nichts wird. Edit Kaldor, deren Gespür für das, was sich in, mittels oder durch Sprache vollzieht oder eben nicht vollzieht, sehr groß ist, nicht zuletzt deshalb, weil sie – wie sie selber sagt, keine Sprache richtig oder ganz beherrscht (d.h. keine Sprache so fließend spricht, dass sie nicht über die Wörter und Ausdrücke, die sie verwendet, und über die Spannung zwischen Sagenwollen und Sagen andauernd nachdenken muss) –, fängt ihre eigentliche Antwort auf die Frage des Interviewers nach der storyoder the play– whatis it about– damit an, dass sie über die chinesische Familie sagt, es handle sich um eine „family who like many of us is trying to survive by inventing some sort of identity for themselves, some business to make a living and, as it happens to be, in this case by giving Mandarine lessons and making a DVD with Mandarine lessons.“2 Damit trifft sie den Nerv der (kulturellen) Performativitätsproblematik. Denn nicht nur spielt sie auf die Verschiebung von einem essentialistischen zu einem performativen Identitätskonzept an, auf die Tatsache, dass die ‚chinesische Familie‘, die vor allem aus der Sicht der Gastkultur, aus unserer Sicht also, eine Art Homogenität aufzuweisen scheint, sich selbst als typische chinesische Familie und Träger einer vermeintlich in der Sprache (aber was für einer?)3 aufbewahrten kulturellen Identität erst in dieser heiklen Situation, in der sie sich jetzt befindet, „as it happens to be“, darstellen, ja sogar produzieren und performativ hervorbringen, schließlich auch verdingen soll.4 Gerade die Floskel „as it happens to be“ markiert aber auch die Kontingenz der Situation, die ein weitverbreitetes Missverständnis über Performativität klärt: als ob irgendeine biologisch und ontologisch verwurzelte Essenz durch eine frei gewählte und neu konstruierte Identität zu ersetzen wäre; und als ob es ein freies Subjekt gäbe, das diesem performativen Dispositiv voranginge und sich für diese oder jene Rolle, dieses oder jenes Szenario entscheiden würde. Hier hingegen wird ganz deutlich gemacht, dass die Familie sich in einer Situation befindet bzw. sich mit einer Situation abfinden muss, einer nicht-vertrauten Situation, in der sie zu einem Spiel greift, das ihr die materielle Möglichkeit einer Existenz in der ihr fremden Kultur sichern soll und das als ein durchaus ambigues Disziplinierungsspiel präsentiert wird. Stellt die Rollenverteilung zwischen der lehrenden chinesischen Familie und dem lernenden Publikum doch die Pervertierung der eigentlichen Machtverhältnisse dar: Der didaktische Drill samt komischer Trillerpfeife ruft die Ambivalenz von Lust und Unlust im quasi-schulischen Disziplinierungsapparat bestimmter Einbürgerungskurse samt obligatem Sprachkurs auf, die in diesem Fall eher das Los der Lehrenden als das der Studierenden ist, denn das Publikum kann das Spiel ruhig genießen und lässt sich gerne unterhalten durch das, was die lehrende Familie, in einem anderen Sinn freilich, unterhalten soll – Brecht lässt grüßen. Dennoch hat auch diese Umkehrung der Rollen einen Haken. Was jetzt als Spaß für das westliche Publikum präsentiert wird – das chorische Nachsprechen von fremden Vokabeln nach dem anfangs skurrilen, allmählich aber irritierenden Signal der Trillerpfeife –, erscheint auf einmal in einem anderen Licht, wenn man es als warnende Antizipation einer uns bevorstehenden, sich rasch nähernden Realität versteht, als lustig-drohendes Zukunftsbild, in dem das alte Europa und die westliche Welt als ganze ihre führende Rolle und damit auch das Recht, als normierender Maßstab und Bildungsideal für das Eigene und das Fremde, für Autonomie und Individualität zu fungieren, verloren haben werden. Als Edith Kaldors CRTV-Interviewer die Vorstellung „a teaching play“ nennt, wird er noch einmal von ihr zurechtgewiesen; sie betrachte ihre Vorstellung doch eher als „a theatre performance“ – und der chinesische Schauspieler, der ihr zur Seite steht, fügt selber halb ironisch, halb stolz „art“ – „Kunst!“ – hinzu. Es ist klar, dass sich C’est du Chinoisim Spannungsfeld dieser verschiedenen Diskurse situiert. Natürlich ist die Vorstellung eine zugleich fiktive und reale Lehrstunde und für alle Beteiligten eine Art Lehrstück, in dem nicht nur oder nicht an erster Stelle chinesische Vokabeln gepaukt werden, sondern auch hermeneutisches, diskursives und performatives Grundwissen vermittelt oder einfach geprobt wird. Und zu diesem Wissen gehören eben auch die Erfahrung des Nicht-Verstehens, des Bruchs, der nicht-so-recht gelingenden Performativität einer Identitätskonstruktion in einem anderen als dem vertrauten Kontext sowie die komplizierte Vermittlung bzw. Rezeption dieser an sich schon sehr brüchigen Identität. Es wäre lächerlich zu behaupten, die Vorstellung vermittle uns einen adäquaten Begriff einer authentischen chinesischen Familie, aber sie trennt auch nicht einfach die banale, nach außen gekehrte kommunikative Seite – die anfangs sehr lustige Sprachstunde – von einem im Dunkeln bleibenden privaten Kern. Vielmehr inszeniert die Vorstellung, wie schon gesagt, as it happens to be, den unvermeidlich unbeholfenen Versuch einiger Menschen aus Shanghai in dem unvertrauten Kontext, der die europäische Kultur für sie immerhin bedeutet, zunächst eine Gemeinschaft zu bilden, die als Familie fungieren kann. Dabei handelt es sich um Menschen, die einerseits chinesische Werte und Gewohnheiten aufrechtzuerhalten versuchen, die aber andererseits diese prekäre, alles andere denn homogene Identität auch als identifizierbare Ware verdingen müssen, um überhaupt in diesem fremden Kontext überleben zu können und die Arbeit an der Identität bzw. der mehr oder weniger gemeinsamen Existenz zu ermöglichen. Wir verstehen einiges, vor allem das, was sich im schlichten Wort und Ding-Bereich situiert, und weil wir uns Mühe gegeben haben uns etwas zu merken, sind wir imstande, einiges zu ahnen von dem, was sich auch sprachlich den beschreibenden Sprechakten entzieht (wir vermuten, dass beleidigt, geflucht, geträumt wird); und wir ahnen auch etwas von dem Schmerz und dem Frust der Missverständnisse und der Konflikte, des Unverständnisses zwischen Generationen, zwischen Männern und Frauen, von Lust und Unlust, Verlangen und Angst, alles was zwischen den Zeilen gesagt und nicht ausgesprochen wird – wir brauchen es nicht wirklich zu verstehen, vielleicht irren wir uns auch manchmal. Vielleicht treffen wir ohne unser Wissen ins Schwarze. Fast wie in unserem eigenen, vertrauten Lebenskontext. Als Vorstellung, Performance, führt C’est du ChinoisSprache als Spiel der einfachen Kommunikation, der Verständigung und der Repräsentation auf; sie deckt aber auch den diskursiven und performativen Rahmen auf, das Disziplinierungsmodell, durch das Repräsentation und Kommunikation produziert und erlaubt werden und das hier auch ziemlich unumwunden mit einem umfassenden globalen, wirtschaftlichen Zweck verbunden wird. Die Vorstellung lässt spüren, wie dieses oberflächliche referentielle Sprachspiel zwar nicht genügt, um die komplexere Realität dieser Leute und ihre dramatischen Versuche „to invent some sort of identity for themselves“ sowie die daraus resultierenden Konflikte adäquat zu fassen; aber sie gibt die Sprache als unzulängliches Medium auch nicht auf, um ein Verstehen jenseits der Sprache und ohne die mühselige Arbeit des sprachlichen Verstehens zu befürworten. Gerade die Lücken in der Kommunikation, die Risiken des Missverstehens und Nicht-Wissens, die Erfahrung von fremder Sprachlichkeit, deren performatives Potential außerhalb des bloßen Bezeichnens und Benennens man ahnt, ohne es wirklich ganz nachvollziehen zu können – das alles wird so ins Spiel gebracht, dass es gerade zur Möglichkeitsbedingung der Arbeit des Verstehens wird, oder wenigstens: zur Möglichkeitsbedingung des Spiels des Verstehens, der ‚performance‘ selber, Grund von Lust und Unlust, Aufregung und Langeweile für das Publikum, das dadurch noch einmal an die Grenzen des eigenen Willens zum Verstehen erinnert wird. Das Theater des unwissenden Lehrmeisters Dass Kaldor die Bezeichnung „learning play“ für C’est du Chinoiszurückweist und auf dem neutraleren Begriff „theatre performance“ beharrt, bedeutet keineswegs eine Flucht ins Unverbindliche (wie der Ausruf „it’s art!“ des chinesischen Schauspielers suggerieren könnte). Obwohl sie wohl mit Recht ihrem Werk den ausdrücklich politischen und didaktischen Charakter eines ‚Lehrstücks‘ abspricht, hat Kaldor doch eine Dramaturgie entwickelt, die sowohl die (Laien-)Darsteller als auch das Publikum in Situationen einbezieht, die als hermeneutische Experimente und Fallstudien zu betrachten sind. Wie schon oben erwähnt, geht es ihr weniger um objektiven Erkenntnisgewinn, und schon gar nicht um die Vermittlung eines (ihres) Wissens, sondern um die von allen zu teilende Erfahrung, dass Wissen keine Sammlung von Erkenntnissen sei, sondern das Produkt einer bestimmten Konstellation von Positionen, die mit sowohl institutionalisierten als auch völlig historisch-kontingenten Machtverhältnissen und Kontexten zusammenhängen. Ihre Versuche, diese Erfahrung als Künstlerin zu reflektieren bzw. zu teilen und doch wieder für ein praktisches Wissen (oder eine ‚Haltung‘) fruchtbar zu machen, rückt ihre Dramaturgie in die Nähe von Jacques Rancières pädagogisch-philosophischer Allegorie des (historischen) ‚unwissenden Lehrmeisters‘.1 Rancière entfaltet in einem recht komplexen und mehrschichtigen Diskurs die Geschichte des ab 1818 an der Löwener Universität französische Literatur lehrenden Dozenten Jacques Jacotot, der die alte pädagogische Logik der Erklärung von einer anderen, eigentlich erst emanzipatorischen, absetzt. Die alte Logik, die er als eine Politik der Verdummung bezeichnet, bestünde, so Jacotot (und Rancière), in einer strukturellen und nicht aufzuhebenden Differenz und Inkongruenz zwischen dem Lehrer als einer institutionell gesetzten, bestätigten Instanz des Wissens und den unwissenden Studierenden; deren Unwissen wird durch einen Abstand vom Wissen des Lehrers getrennt, den sie schon aus strukturellen Gründen nie einholen können, weil der Lehrmeister kraft seiner Position die Grenzziehung zwischen Wissen und Nicht-Wissen, den Abstand also zwischen ihm und den Lernenden, zu bewahren hat, um Letztere immer einen Schritt weitermachen zu lassen, entsprechend einem von ihm, dem Lehrer, festgelegten (oder vermittelten) Verfahren und im Hinblick auf ein von ihm festgelegtes (oder vermitteltes) Ziel. Nicht nur weiß der Lehrmeister grundsätzlich mehr als die Schüler, er weiß auch um deren Nicht-Wissen und lenkt den Prozess, der zu dessen (freilich nicht endender) Aufhebung führen soll. Die von Jacotot durchgeführte Reform versucht diese verdummende und Ungleichheit fortsetzende pädagogische Dramaturgie umzuwerfen, freilich nicht durch das Aufheben oder Tilgen der Differenz zwischen Wissen und Nicht-Wissen, sondern dadurch, dass diese Differenz nicht mehr zwischen Lehrer und Lernenden situiert wird; beide sind Partner in einer gemeinsamen Auseinandersetzung mit einem Dritten ( le tiers), sie sind mit ihrem jeweils eigenen Wissen und Nicht-Wissen beteiligt an einem Prozess der ständigen Beobachtung, des Vergleichens, der Übersetzung, des Weiter- und Anders-Erzählens dieses Dritten. In dieser geteilten Aufmerksamkeit für etwas anderes begegnet man sich. Die Fiktion der Klasse, des Schulraums, kreiert den immerhin geschlossenen Freiraum für diese Aufmerksamkeit. Der unwissende Lehrmeister ist freilich nicht der sprichwörtliche Türöffner, der facilitatorder modernen Wissens- und Leistungsgesellschaft, sondern er steht, so Rancière, an der Tür, bewacht sie, damit nichts von der geteilten Aufmerksamkeit für das Dritte ablenke. In dem Sinne behält er (oder sie) auf eine bestimmte Weise eine Überlegenheit, die sich aber nicht länger auf die Ebene des Wissens bezieht, sondern sich auf die des Willens verlagert hat. Rancière hat in einem späteren Aufsatz, „Le spectateur émancipé“, diese Analyse zum Anlass einer Kritik des Theaters und ganz besonders der Beziehung zwischen Publikum und Aufführung gemacht.2 So wie er der Aufklärung eine Fortsetzung der alten verdummenden Pädagogie vorgeworfen hat, so wirft er den großen Theaterreformern des 20. Jahrhunderts, Artaud und Brecht voran, eine ähnliche Verdummung vor. Er sieht – mit Recht oder zu Unrecht – in beiden Programmen den entweder ausgesprochenen oder impliziten Wunsch, das Theater als Spektakel aufzuheben, d.h. das Theatralische oder Mediale des Theaters als Mittel zum Zweck in einen Prozess zu überführen und aufzulösen, um das Theater, das Medium, mit der romantischen, auch von Rousseau vertretenen Idee einer nicht-repräsentierenden, sondern sich unmittelbar als erlebend, denkend und handelnd präsentierenden Gemeinschaft konvergieren zu lassen. Rancière plädiert dafür, die Distanz des Theaters zum Realen und damit auch dessen Autonomie aufrechtzuerhalten und als Form und Bedingung eines fruchtbaren Dissens und eines Austausches zu betrachten. Die Theatervorstellung ( performance), so Rancière, sei nicht die Übermittlung des Wissens oder des Atems vom Künstler zum Zuschauer. Sie ist jene dritte Sache, die niemandem zugehört, über deren Bedeutung niemand verfügt und, die sich zwischen ihnen hält und jede identische Übertragung, jede Identität von Ursache und Wirkung unterbindet.3 Die Analogie zwischen Rancières Analyse und den Möglichkeitsbedingungen eines interkulturellen Theaters im Allgemeinen sowie dem Einsatz von Kaldors Werk (und im Besonderen C’est du Chinois) lässt sich unschwer ahnen. Was steht hier auf dem Spiel: eine Annäherung zwischen dem Fremden und dem Eigenen, dem Anderen und dem Selbst? Geht es hier um die Verringerung einer Kluft oder Distanz, die doch nicht restlos zu überbrücken ist? Anstelle dieses verdummenden und frustrierenden Aufschubs einer unerreichbaren, fiktiven Konvergenz von Nicht-Wissen des/vom Anderen zum Wissen sowie von falscher, entstellender Repräsentation zu einer angeblich gelungenen Ko-Präsenz tritt aus Rancières Perspektive die Sicherung eines gemeinsamen, zugleich virtuellen und faktischen Zwischenraums, den es zwar zu durchmessen gilt, nicht jedoch im Sinne eines Überbrückens der Distanz zwischen uns hier und dem Fremden dort, sondern verstanden als ein gemeinsames, geteiltes Durchqueren und Fortschreiten im gleichen Raum, ein Fortschreiten von dem, was man schon weiß oder zu wissen meint, zu dem, was man noch nicht weiß, sowohl über die eigenen performativen Selbstdarstellungsversuche als auch über die der anderen. Rancière begreift dieses Fortschreiten nicht als einen von einer kognitiven Teleologie gesteuerten Progress. Er spricht vielmehr von einem nach allen Richtungen offenen Prozess des Übersetzens und des Erzählens in einem diskursiven und performativen Raum, in dem die Distanz kein Übel ist, sondern die normale Bedingung der Kommunikation. Die hier gemeinte Distanz ist also grundverschieden von der institutionalisierten Kluft zwischen Lehrer und Schüler. Edit Kaldor setzt in C’est du Chinoisihre Erfahrung als nicht-wissende Lehrmeisterin ein, ihre Expertise als eine Person, die sich durch Übersetzen, Vergleichen und Erzählen einen Weg durch diese Dimension der Distanz zu bahnen versucht, und die zu verringern sie gar nicht beabsichtigt, im Gegenteil; ihr „teaching play“ ist vor allem a „theatre performance“, ein durchaus autonomes Medium, das die von sämtlichen Beteiligten (Theatermacherin, Schauspieler, Publikum usw.) verfolgten Zielen und Aufgaben zwar ermöglicht, ohne jedoch mit solchen Intentionen zusammenzufallen. Sie steht gewissermaßen an der Tür des fiktiven Klassenzimmers und zwingt uns, auf spielerische Weise unsere Aufmerksamkeit einem Dritten zu schenken. Das Dritte ist auf der ersten oberflächlichen Ebene die Fremdsprache bzw. der Sprachkurs (der für beide Parteien, Zuschauer und Schauspieler, eine je eigene Aufgabe darstellt), auf einer anderen Ebene dürfte es aber die mit den Schauspielern geteilte Aufgabe sein, „to invent some identity for ourselves“, das tägliche performative und diskursive Theater, in dem wir uns alle zusammen befinden und in dem wir uns vergleichend und übersetzend vorantasten, „as it happens to be“. Ob es uns nun chinesisch, spanisch, griechisch, lateinisch, polnisch oder double dutch vorkommt, das Dritte, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben, lässt sich nicht mehr auf die Opposition vom Eigenen und Fremden zurückführen, geschweige denn auf die linguistische Distribution von Fremd- und Muttersprache(n). Das ‚Dritte‘ ( le tiers) dürfte doch vor allem das Theater selbst sein, Kaldors „theatre performance“, wie sie mit Nachdruck sagt. Denn die gemeinsame Beschäftigung und Aufmerksamkeit der Schauspieler und des Publikums gelten letzten Endes dem ästhetisch-performativen Spiel selber, für das „language no problem“ ist, obwohl/weil es gerade um sie geht. Damit ist nicht diese oder jene (Fremd-)Sprache gemeint, die wir (und sie, die ‚anderen‘) können oder nicht können, sodass diese (fehlerhaften) Kenntnisse uns die praktische Kommunikation erleichtern (oder eben erschweren) könnten. Gemeint ist vielmehr jene Sprachlichkeit, die uns alle sowohl trennt als auch verbindet, weil sie jenseits der mehr oder weniger anekdotischen Sprachstunde und der sowohl kommunikativen als auch ökonomischen Zweckmäßigkeit des Sprachkurses den Raum einer Unmittelbarkeit der Mitteilung eröffnet; eines Mit-Teilens also im Medium der Sprache(n), dem Begreifen im emphatischen Sinne weniger bedeutet als das Versprechen einer Begegnung in einer Dimension, die weder die des vermeintlich Eigenen noch die des ebenso vermeintlich Fremden ist (sie gehört keinem). Der Bruch, über den man sich vergleichend und übersetzend nähert, mag dazu führen, dass man dort nicht nur einen anderen, sondern auch sichals einen anderen wiederfindet. Damit wäre tatsächlich „ein wichtiger Schritt in die Zukunft“ getan. ‚Zigeuner‘ als Maske des Fremden Marginalisiertes Leben zwischen dem Realen und dem Fiktiven Lorenz Aggermann (Gießen) In den nachfolgenden Zeilen wird der Vorschlag gemacht, ‚Zigeuner‘ als Maske und Figuration des Fremden zu verstehen und darüber den problematischen Umgang der Mehrheitsgesellschaft mit den Angehörigen der größten europäischen Minderheit zu reflektieren. Die Überlegungen orientieren sich an den jüngsten literaturwissenschaftlichen Thesen zur Erfindung der ‚Zigeuner‘ und adaptieren deren Befunde durch den Einbezug eines theaterwissenschaftlichen Standpunktes. Sie fragen nach der spezifischen Aufführung dieser Maske und markieren abschließend am Beispiel einer Performance (Constanza Macras, DorkyPark: open for everything) die Schwierigkeiten, dieser Figuration zu entkommen. I. Die Erfindung der ‚Zigeuner‘ Im 15. Jahrhundert, knapp bevor sich das europäische Subjekt soweit stabilisiert und emanzipiert hatte, dass es seine Vertreter ausschicken konnte, um neue Länder und Kontinente zu erschließen, wird es selbst heimgesucht und in seiner Identität befragt. Dass man mit dem Fremden und Ungearteten rechnen muss, ist zwar durchaus im Bewusstsein verankert, sein Ort war aber bis dato das Grenzland respektive die unbekannte, unentdeckte Ferne, seine Gestalt mehr oder weniger fabelhaft: Hic sunt dracones. Nun aber erscheint das Fremde nicht nur unvermittelt im eigenen Hoheits- und Wissensgebiet, es zeitigt zudem unverkennbar die Gestalt des Menschen. Rom-Völker und weitere Fahrende tauchen vor den Toren der Städte auf und ziehen infolge durch ganz Europa, wie die Chroniken zahlreicher mittelalterlicher Städte belegen. 1420 kommt es zu einer ersten Konfrontation in Brüssel, 1427 folgt Paris, 1428 werden sie in Nijmegen gesichtet, 1444 stehen sie vor den Toren Bolognas, Forlis und Lwows, für 1447 ist ihr Erscheinen in Barcelona und für 1457 in Mailand belegt.1 Da sie nicht in kriegerischer Absicht kommen und nicht mit Gewalt Einlass in die Städte begehren, erwecken diese vagabundierenden Fremden vor allem Verwunderung, der durch zweierlei Deutungsmuster begegnet wird: Entweder werden die Fremden in Analogie zu der aus Ägypten flüchtenden heiligen Familie gesetzt und verehrt oder aber sie werden aufgrund ihrer Fremdheit und Freiheit als Seher und Späher gedeutet.2 Das Interesse der städtischen Gesellschaften und ihrer Chronisten richtet sich vor allem auf die Art und Weise ihrer Repräsentation, auf ihre seltsame Kleidung, ihr befremdliches Verhalten. In ihren Einträgen wird weniger eine Andersheit reflektiert, denn eine Differenz konstruiert, die primär über Äußerlichkeiten zu Tage tritt, da sich weder Schrift noch Religion als Unterscheidungsmerkmale beiziehen lassen. Die ersten Chronisten bleiben in ihrem Urteil über diese Fremden indes neutral bis vage positiv. Sie betonen die von König Sigismund in einem Schutzbrief gewährten Sonderrechte der „Secanos“3 und vermessen das „gens ciganorum“4 vor der bekannten mittelalterlichen Ständeordnung und Hierarchie. Dieser entsprechen und entziehen sich die Fremden zugleich: Einerseits gibt es auch unter ihnen Fürsten und Grafen, Ritter und Fußvolk, andererseits wird ihr Umherschweifen mit dem Abfall vom Glauben und ihrem freizügigen Verhalten begründet. Der Blick in diese frühen Dokumente spiegelt somit ein ambivalentes Bild dieser Fremden respektive ihrer Einschätzung durch die Chronisten wider, was sich unter anderem damit erklären lässt, dass weder eine eindeutige geo- noch eine ethnographische Verortung und Identifikation dieser Fremden gelingt. Sie bleiben rätselhaft. Vielleicht sind sie Späher und Kundschafter des osmanischen Reiches, vielleicht Pilger aus Ägypten, die gezwungen sind, Buße zu tun – Mutmaßungen, die sich weder erhärten noch ausräumen lassen. Während sich in den folgenden hundert Jahren durch mündliche Überlieferung die Zeugnisse über das Auftauchen dieser Fremden verdichten und sich das Wissen über ihre Eigenschaften, ihre Wesensart und ihr Verhalten konkretisiert, so verlieren sich die wenigen Anhaltspunkte zu ihrer Verortung vollends. Die Fremden gelten nun als ein „Auswurf aller Nationen“, „‚erfahren‘ in allen Sprachen“, der „ringsumher in allen Provinzen“ Männer und Frauen in seine Gemeinschaft aufnimmt.5 „Damit setzt sich“, so Reimar Gronemeyer, der diese Quellen bereits in den 1980er Jahren zusammengetragen, übersetzt und kommentiert hat, „ein weitaus aggressiverer Ton gegenüber den Zigeunern durch, die nicht mehr als Fremde gesehen, sondern zu Kriminellen gestempelt werden.“6 Nicht verort- und klassifizierbar zu sein erweist sich als eine markante Dysfunktionalität im Austausch mit den spätmittelalterlichen Gesellschaften Europas, deren Subjekte sich mehr und mehr über geographische Spezifika ihres Lebensraums und sprachliche Eigenheiten ihrer Region zu definieren beginnen und deren Gemeinschaft sich mehr und mehr auf topologische Parameter gründet,7 – deren Begriff vom Menschen sich also zunehmend „nach dem Volk und nicht nach dem Individuum“ richtet.8 Diese Dysfunktionalität wird für beide Seiten zum Ausgangspunkt für die fiktionale Konstruktion einer spezifischen Andersheit, die sich strategisch verwerten lässt und der diese Fremden von nun an nicht mehr entkommen werden, auch dann nicht, als im 19. Jahrhundert durch sprachwissenschaftliche Forschungen erste belastbare Hinweise zur ethnographischen Herkunft dieser, mittlerweile seit Jahrhunderten in Europa lebenden Menschen auftauchen. In dem Prozess, den die Begegnung mit den Rom-Völkern in Gang setzt, treten die konkreten, realen Individuen und ihre Bedürfnisse rasch in den Hintergrund. Folgt man den aktuellen Studien, dann dient das Interesse an ihnen vor allem dem Zweck, eine Negativ-Folie für das Eigene herzustellen, wobei den realen Menschen eine imaginäre Fremdheit übergestülpt wurde, „die nach Gutdünken plastisch modelliert werden“9 und dem europäischen Subjekt in Form eines „entwirklichte[n] und entzeitlichte[n] Kollektiv[s]“ gegenüber gestellt werden konnte.10 Die Menschen, die den Spiel- und Handlungsraum der europäischen Bürger betreten, werden in der Begegnung zu einer Projektionsfläche, die primär der Selbstkonstitution eines urbanen, abendländischen Subjektes dient. Klaus-Michael Bogdal spricht daher auch von der Erfindung der ‚Zigeuner‘: Die Erfindung der ‚Zigeuner‘ durch große Erzählungen […] stellt von Beginn an die Kehrseite der Selbsterschaffung des europäischen Kultursubjekts dar, das sich als Träger weltzivilisatorischen Fortschritts versteht. Zugleich ist sie die radikale Reinigung des Selbstbildes von dem, was es vermeintlich bedroht.11 Deutlich wird dieser Sachverhalt unter anderem in der Benennung dieser Fremden als ‚Zigeuner‘ – einer Fremdbezeichnung, deren Herkunft nach wie vor ungeklärt ist und die sich aus dem mittelalterlichen cingarioder gens ciganorumableitet.12 Diese Etymologie führt die Bezeichnung auf das bulgarische aciganezurück,13 das über das Ungarische ins Deutsche migriert sein soll und das wiederum mit dem griechischen athinganoiin Verbindung gebracht wird, dem Namen für eine gnostische Sekte.14 Weitere Mutmaßungen bringen diese Fremdbezeichnung mit dem arabischen samerki(Blechschmied) oder dem persischen zang(Blech, Eisen) in Verbindung. Darüber hinaus gibt es zudem jene Bezeichnungen, die auf Landstriche verweisen wie Bohémiens, Ägypter/Gypsies oder Tataren.15 In frühen Quellen findet sich zudem häufig der Begriff Heiden als Synonym zur Beschreibung dieser Fremden, und im 18. Jahrhundert erfährt die Bezeichnung ‚Zigeuner‘ als polizeilicher Ordnungsbegriff eine weitere Resemantisierung.16 Bei der Suche nach einem adäquaten Namen durchkreuzen einander etymologische Mutmaßungen und gesellschaftspolitische Markierungen. An die Stelle der neugierigen Erforschung und Erkundung der Rom-Völker und ihrer Angehörigen tritt das Bestreben, die Fremden als eine homogene Gruppe zusammenzufassen, ihre bio- als auch ethnographischen Unterschiede zu nivellieren und eine Projektionsfläche herzustellen, die für Semantisierungen jeglicher Art herangezogen werden kann.17 Die Bezeichnung der Fremden als ‚Zigeuner‘ ist somit weniger eine Definition, sondern nachgerade das Gegenteil davon. Aus diesem Grund soll ‚Zigeuner‘ im Folgenden als Maske und noch spezifischer, als Figuration des Fremden verstanden werden.18 Die Ausbildung einer Figuration, die Maskierung des Fremden ist indes nicht nur ein literarisches und fiktionales Verfahren, das sich auf schriftliche Quellen und Diskurse stützt, sondern ein originär theatrales, dessen Mechanismen und Rahmenbedingungen erst in einer Aufführung so recht zum Tragen kommen. Dies erlaubt, die diskursanalytischen Befunde durch aufführungsanalytische Überlegungen zu erweitern und mit anderen Masken des Fremden und deren Aufführungen zu vergleichen. Ein weiterer Vorteil dieses methodischen Transfers liegt darin, dass durch die Prämisse der Ritual- und Performancetheorie auch der darunter liegende Körper einen Eigenwert – als widerständiger Träger und virtuoser Performer – zugestanden bekommt und in den Mittelpunkt der Analyse rückt. Die Begegnung und Auseinandersetzung mit den Rom-Völkern wird hierdurch nicht nur als ein Dialog über In- und Exklusion verstanden, sondern als eine triadische Verhandlung von Identitäten, wodurch die Differenz zwischen der Figuration, den Angehörigen der Rom-Völker und den urbanen, zentraleuropäischen Subjekten – zwischen Maske, Performer und Rezipient – herausgearbeitet werden kann. Eine derartige methodische Volte erlaubt auch, an jene postkolonialen Theorien anzuschließen, die der Essentialisierung von Eigen und Fremd eine Praxis der Hybridisierung gegenüberstellen, ohne indes diese grundlegende Unterscheidung vollends aufzugeben. Und sie betont den Stellenwert des Theaters und allgemeiner der Kunst, die eben jenen Raum der Hybridität paradigmatisch herzustellen vermögen: „Wer sich in ihm aufhält, der überschreitet die Fremdheit in Richtung einer Alterität, in der die kulturelle Differenz zugleich transzendiert wird.“19 II. Alterität als Maske Dass das Fremde ein zentraler Bestandteil der eigenen Kultur, ja ein notwendiger Widerpart des jeweiligen Subjekt-Denkens sein muss, ist mehrfach als grundlegender anthropologischer Mechanismus analysiert worden: „Das Selbe läßt sich nur fassen und bestimmen im Verhältnis zum Anderen, zur Vielfalt der anderen. Wenn das Selbe in sich verschlossen bleibt, ist kein Denken möglich. Und hinzuzufügen ist: auch keine Zivilisation“1, konstatiert Jean-Pierre Vernant, der vornehmlich die Religion und Gesellschaft der griechischen Antike analysiert hat. Doch auch François Jullien, dessen Interesse vor allem der chinesischen Philosophie und Ästhetik gilt, betont die Wichtigkeit eines fremden Anderen, zu dem sich die eigene Kultur in einem Abstand befindet. Ohne diese Prämisse müsste von einer ersten, gemeinsamen, ubiquitären Kultur ausgegangen werden, „von der die verschiedenen Kulturen dieser Welt, im Plural, bloße Variationen wären.“2 Nicht nur für Jullien führte dies letztlich zu einer unzulässigen und unbrauchbaren Essentialisierung des Kulturbegriffs. Alterität ist indes nicht nur für die Definition und das Wissen um eine Gesellschaft von Nöten, sondern eröffnet dem Subjekt auf basaler Ebene die Reflexion seinesgleichen: „Mit dem anderen, dem Fremden leben,“ so Julia Kristeva, ebenfalls eine Wanderin zwischen den Kulturen, die bereits vor einiger Zeit vor dem Verschwinden des Fremden warnte, „konfrontiert uns mit der Frage, ob es möglich ist, ein anderer zu sein.“ Erst diese Frage erlaubt jedwege Selbstreflexion, was genaugenommen heißt, „sich als ein anderer zu sich selbst zu denken.“3 Jede Gesellschaft, die ihre Identität sichern und erhalten, aber auch jedes Subjekt, das als seiner selbst bewusst gelten will, muss das Fremde anerkennen und verhandeln können. Da es indes weder bestimmte Regeln zur Ableitung eines Sinnes noch ein bekanntes Schema für Handlungs- respektive Interaktionsformen mit dem Fremden gibt,4 stellt sich die Frage, wie sich mit dem Fremden umgehen lässt. Die Anthropologie bringt hierbei die Maske ins Spiel – genaugenommen definiert sie die Maske und den dazugehörigen Ritus geradewegs als jenen Vorgang, vermittels welchen das Fremde konkretisiert wird. „Die Maske ist die Hypothese einer Existenzform des Anderen“5, schreibt Richard Weihe, und ihre leere Form, so lässt sich weiter folgern, provoziert nachgerade eine imaginäre Besetzung. Die Maske gehört nach derzeitigem Kenntnisstand wohl zu den ältesten Techniken, die der Konstitution einer menschlichen Gesellschaft, einer Kultur, zuarbeiteten, indem sie deren Grenze erkennbar macht. Sie ist ein „notwendiges anthropologisches Dispositiv“6, dessen Mechanismus sich verkürzt wie folgt umreißen lässt: Die Maske verfremdet. Zugleich bietet sie aufgrund ihrer Fiktionalität die Möglichkeit, das Irreale, Fremde und Unbekannte auf einen realen Körper zu applizieren und in die Lebenswelt einzuspeisen. Indem das Fremde konkret figuriert wird und qua Aufführung ein Verhalten gegenüber und mit dieser Maske eingeübt wird, lässt sich durch das Fremde lernen und ein Wissen um das Eigene als auch das Andere generieren. Somit sorgt sie zugleich für die Begrenzung wie die Entgrenzung des menschlichen Subjekts und führt zu einem Prozess der Differenzierung, der gemeinhin in einer Gesellschaft mündet. Jean-Pierre Vernant nennt Gorgo, Artemis und Dionysos und die damit einhergehenden Riten als Beispiel für antike Masken, die der Konturierung des Eigenen und der Abgrenzung einer Zivilisation gegenüber dem Wilden, Unbekannten dienen. Seine Überlegungen lassen sich aber auch ohne weiteres auf jüngere Zeitalter und ihre Gesellschaften übertragen: Teufel, Hexen, aber auch Hellequin mit seinem wilden Heer fungieren ebenso wie Schäfer und andere fabelhafte Bewohner Arkadiens als Masken,7 wobei eine jede für einen spezifischen Typus der Alterität steht. Die Fremdheit, die hierbei in einer ganz bestimmten Form, einem spezifischen Ritual zur Aufführung gelangt, ist ebenso wenig eine universale Chiffre wie die Kultur und Gesellschaft, in welche das Fremde integriert wird. Die gänzlich unterschiedlichen, orts- und zeitgebundenen Rituale, aber auch die Masken, die sich im Hinblick auf ihre Gestalt wie auf ihre Aufführung deutlich voneinander unterscheiden, legen hiervon beredtes Zeugnis ab. Jede Gesellschaft hat ihr eigenes Fremdes, das figuriert werden muss. Hinter all diesen Masken verbirgt sich gleichsam etwas, das unbekannt ist, das sich nur schlecht qua Logos, in Schrift und Sprache, und ebenso wenig auf anderen bildlichen oder akustischen Trägern äußern kann, schlicht, weil es kein Vokabular oder anderweitige Vorlagen für seine Repräsentation gibt. Peggy Phelan hat den Terminus „unmarkiert“ für derartige Phänomene vorgeschlagen,8 einen Terminus, welcher der Maske in ihrer Auffälligkeit nur vordergründig widerspricht, sondern vielmehr ihre negative, bergende Form und ihre Gebundenheit an eine Aufführung in den Fokus rückt. Das, was unbekannt hinter der Oberfläche ruht, erhält nur über die Maske und ihre Aufführung Kontur.9 Erst darüber kann sich das Unmarkierte und Unbekannte einen Wert verschaffen. Die Masken des Fremden erweisen sich ganz in Phelans Sinne als ein Negativ, welches im Rahmen einer Aufführung entwickelt werden muss. Die unterschiedlichen Figurationen des Fremden gehen auf jeweils ältere, und fallweise nicht europäische Kulturen zurück und erweisen sich solchermaßen stets als Migranten in eine jüngere Kultur. Die rund um sie entwickelten Riten eröffnen eine Möglichkeit, das Andere in die Gesellschaft zu integrieren. Die daran teilhabenden Subjekte wechseln – so die These Vernants, die in Bezug auf jüngere Gesellschaften ein wenig zu adaptieren ist – unter festgelegten Voraussetzungen und für eine bestimmte Zeit auf die Seite des Anderen und werden erst nach dieser Fremderfahrung zu vollwertigen Mitgliedern in der Gesellschaft.10 Das Andere erscheint unter diesen Prämissen nicht nur eine genuin ästhetische, sondern vor allem eine genuin theatrale und performative Kategorie zu sein, die nicht zuletzt die Funktion der Gemeinschaftsstiftung übernimmt, wie insbesondere an den Dionysien, an den mittelalterlichen Fastnachts- und Karnevalsspielen und selbst noch am Beispiel barocker Maskeraden verfolgt werden kann. Die Quellen, die uns über das Auftauchen der Rom-Völker in Europa informieren, zeigen deutlich, wie diese relativ fremden Menschen der Rom-Völker zum Ausgangspunkt für die diskursive Herstellung einer neuen Maske der radikalen Alterität werden,11 die, besonders langlebig und nachhaltig, bis zum heutigen Tage wirksam ist. Auch wenn in den Schriften die Bemühungen um eine Historisierung, Genealogisierung und geographische Verortung dieser Menschen aufscheinen, so arbeiten die Texte über die Rom-Völker primär der Herstellung einer Maske zu, die recht besehen nichts mit den durch Europa ziehenden Menschen und ihrer Lebensrealität zu tun hat. Das Schrifttum, ab dem 16. Jahrhundert auch die Literatur, ist verstärkt an der Ausbildung dieser Maske und ihrer Verfestigung beteiligt, wie die Studien von Bogdal (2011), Patrut (2014) und von Hagen (2009) eindrücklich belegen, weshalb hier nur kursorisch auf jene Werke verwiesen wird, welche die schriftliche Arbeit an dieser Figuration konkret an eine Aufführung binden: 1559 verfasst Hans Sachs Ein faßnachtspil mit sechs personen, und wirdt genandt die fünff armen wanderer, das einen frühen Beleg für das Auftreten dieser Maske im deutschen Sprachraum liefert. Bereits etwas früher, 1521, schreibt und inszeniert der Spanier Gil Vicentes das Maskenspiel Auto das Ciganas, und vermutlich um 1613 entsteht aus der Feder von Ben Jonson eine Masque of gypsies. Im selben Jahr wird auch Cervantes’ Erzählung La Gitanillazum ersten Mal publiziert – jene Vorlage, welche die Figuration der Zigeuner(in) wohl am meisten beeinflusst hat, da die hierin angelegten, fiktionalen Zuschreibungen von zahlreichen Dichtern aufgegriffen und verbreitet wurden.12 Am französischen Hof ist es bis tief in das 17. Jahrhundert hinein üblich, sich bei festlichen Anlässen ‚à la mode de Tsigane‘ zu kleiden, eine Praxis, die durchaus auch an den deutschen Höfen zu finden ist, so beispielsweise in Dresden, wo für 1678 im Rahmen eines Festes auch eine Frauen-Zimmer-Zigeuner-Maskeradebelegt ist.13 Die Figuration ‚Zigeuner‘ erfreut sich indes bis zum heutigen Tage einer großen Beliebtheit, wofür unter anderem der Musiker Eugene Hütz Beispiel zu geben vermag, der sich unter dem Pseudonym Gogol Bordello als Gypsie-Punk inszeniert und gleich einem Wanderlust King– so der Titel seines erfolgreichsten Songs (Side one dummy records 2007) – um den Globus tourt, oder sein weibliches Pendant Lady Gaga, welches ebenfalls den Topos des vagabundierenden ‚Zigeuners‘ beschwört ( Gypsy, Artpop 2013). Und auch die primär mit Erotisierung einhergehenden Aufführungen der weiblichen Ausprägung dieser Figuration in den popkulturellen Performances von Jennifer Lopez ( Ain’t it funny,Sony music 2001), Shakira ( I’m a gipsy, Epic records 2009) oder Hillary Duff ( Gipsy woman, Hollywood records 2007) belegen die Aktualität und Attraktivität dieser Maske. Doch der Umgang mit dieser Figuration unterscheidet sich maßgeblich von den älteren, von Vernant erwähnten Masken, liegt ihnen das Fremde doch in Menschenform zu Grunde. Zudem taucht die Maske in einer Zeit auf, in welcher es durch die Verbreitung des Buchdrucks zu einer markanten Aufwertung des schriftlichen Diskurses kommt, welcher die zentraleuropäischen Subjekte ebenfalls rejustiert und weitere Differenzierungen in ihre Gesellschaften (beispielsweise zwischen Schriftkundigen, Lesefähigen und Analphabeten) einbringt. Daraus erklärt sich wohl die zentrale Rolle, die das Schrifttum in der Aufführung dieser Maske übernimmt. Qua Narration und Inszenierung werden ‚Zigeuner‘ mythisiert und dringen in das kollektive Imaginäre einer Gesellschaft vor. Über die Aufführung und Rezeption werden die mythologischen und imaginären Zuschreibungen letztlich in einen Bezug zu den realen Angehörigen der verschiedenen Rom-Völker gesetzt, die infolge allesamt zu ‚Zigeunern‘ werden und diesem diskursiven Prozess nur wenig entgegenzusetzen haben, da ihre Kultur maßgeblich auf oraler Überlieferung basiert. Als Beleg für diesen Mechanismus mag Christoph Besolds Thesaurus practicusvon 1629 gelten, der in dem Lemma ‚Zigeuner‘ zahlreiche Charakteristika aus Cervantes’ La Gitanillaübernimmt und als Fakten präsentiert, ohne auszuweisen oder gar nur zu reflektieren, dass es sich bei letzterem um einen fiktionalen Text handelt – ein Verfahren, das sich auch in Zedlers Universal Lexikonund anderen enzyklopädischen Nachschlagewerken wiederfindet.14 Aber auch die im Herbst 2013 durch zahlreiche europäische Zeitungen und Nachrichtenportale geisternde Meldung von der Aufdeckung einer Kindesentführung durch Roma in Athen lässt sich als eindrücklicher Beleg für die Transformation einer literarischen Fiktion in ein (vermeintlich) realpolitisches Faktum werten, schreiben diese Nachrichten doch einen Topos fort, der durch die Comedia ilamada medora(1567) von Lope de Rueda in die Welt gesetzt wurde. Die spezifische Aufführung dieser Maske und ihre Arretierung als Figuration wirkt somit weniger integrierend denn exkludierend, da unter die Maske nicht nur ein, sondern gleich zwei Körper gezwungen werden. Einerseits handelt es sich um jene Personen, die durch die Maske ihre eigenen kulturellen Grenzen überschreiten, sich „zu einer Vielfalt von Facetten auffächern“15 wollen, um über sich hinauszugelangen. Andererseits spannt sie die Angehörigen der Rom-Völker in ihre Form, die nun, um in die urbane, europäische Gesellschaft eintreten und auf deren Spielfeld agieren zu können, das Gegenbild des europäischen Subjekts ausfüllen und aufführen müssen: Wilde, ohne Schrift, ohne Vernunft und Religion, ohne Heimstatt, ohne Biographie, denen im Gegenzug aber eine besondere Affektivität, Musikalität, Kriminalität, aber auch die Gabe der Prophetie zugeschrieben wird. So konkretisiert und stabilisiert sich eine nachgerade fatale Figuration, für die eine reale Bevölkerungsgruppe Europas einstehen, als Träger fungieren muss und die Klaus-Michael Bogdal in ihrer verstörenden Paradoxie wie folgt zusammenfasst: „Die Damen des Hofes spielen Zigeunerinnen, während Romfrauen an der Landesgrenze am ‚nächsten Schnell- oder anderen Galgen aufgehenket‘ werden.“16 Daran hat sich bis zum heutigen Tag wenig geändert, weshalb es nach wie vor wesentlich ist, auf den Unterschied zwischen ‚Zigeuner‘ und den verschiedenen spezifischen Bezeichnungen der unterschiedlichen Rom-Gruppen und ihrer Individuen hinzuweisen: ‚Zigeuner‘ sind eine kollektiv imaginierte und inszenierte Maske, die in einem markanten Gegensatz zu den Angehörigen der Lovara, Kalderasch, Roma, Sinti, Jenischen, Ashkali, Manoush oder Kalé stehen. Nicht nur die Angehörigen der europäischen Mehrheitsbevölkerung, sondern auch die Angehörigen eben genannter marginalisierter Völker spielen diese Figuration im gesellschaftspolitischen Diskurs aus – zum Zweck der Marginalisierung und Diskriminierung einerseits, aus Gründen der Koexistenz mit der vorherrschenden ökonomischen und gesellschaftlichen Ordnung andererseits. Diese Maske tritt nun nicht mehr in einem legitimierten, unwiederholbaren Ritual auf, sondern findet Eingang in das vermeintlich zweckfreie ästhetische Spiel. Festivitäten und Maskeraden, Theater und Opern, und in späteren Zeiten auch Filme und Pop-Videos bieten dieser Maske eine Bühne, sorgen für ihre Aufführung und tragen zu ihrer Verbreitung und Verfestigung bei. Das ästhetische Spiel verliert im Falle dieser Figuration seine Harmlosigkeit, zeigt es doch, dass die Kunst und ihre Aufführungen, in welchen sich die zentralen anthropologischen Prozesse von Fiktionalisierung und Inszenierung konkretisieren, maßgeblich zur Ausbildung einer gesellschaftspolitischen Realität beitragen und der Marginalisierung und Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen zuarbeiten. Die darstellende Kunst, die der Maske zahlreiche und medial diverse Möglichkeiten zur Inszenierung eröffnet, hat in diesem Fall eine nachhaltige realpolitische Wirksamkeit. Ihr Spiel bleibt nicht auf einen ästhetischen Raum beschränkt. Die bislang gut 600 Jahre währende Existenz dieser Figuration hat bislang keine sehr positiven Auswirkungen auf die Individuen der Rom-Völker gehabt. Ihr Leben wurde und wird dadurch auf jenen dystopischen Raum beschränkt, der aus der Überlagerung von Fiktivem und Realem hervorgeht. Besonders deutlich wird das beispielsweise in der heute noch gängigen Vorstellung von den Rom-Völkern als fahrendem und nomadisierendem Volk. Durch die notwendige wirtschaftliche Anbindung an die Mehrheitsbevölkerung lebt der Großteil der Rom-Völker schon seit Jahrhunderten in bestimmten Regionen, lokal verankert. Ihr Mobilitätsradius war und ist entsprechend gering. Die wenigen verbliebenen Fahrenden wurden spätestens im 20. Jahrhundert durch den Realsozialismus und den Eisernen Vorhang zur Sesshaftigkeit gezwungen, aber auch in Westeuropa kam es durch politische Initiativen verstärkt zur ihrer Integration und Verstetigung. Migration wurde vornehmlich in der Folge von Konflikten notwendig, zuletzt während der Balkan-Kriege, bei welchen die Angehörigen der Rom-Völker zu den ersten Vertrieben gehörten. Dennoch hält sich die Vorstellung von den vagabundierenden Fremden hartnäckig im kollektiven Gedächtnis, bildet ein wesentliches Merkmal des Daseins als ‚Zigeuner‘. Am Beispiel der Figuration ‚Zigeuner‘ lässt sich zeigen, wie sich Ästhetik und Politik fallweise überlagern. Zu fragen bleibt letztlich: Bietet die Kunst eine Möglichkeit, diesem Dilemma zu entkommen und einer Lösung zuzuarbeiten? Prolongiert nicht ein jeder neuer Diskurs, jede Inszenierung, Verfilmung und weitere Formen der Aufführung die realen Effekte der stigmatisierenden Fremdbeschreibung? Oder lässt sich in Performance und etwas allgemeiner, im Rahmen der Kunst tatsächlich eine kritische Haltung zu dieser Figuration entwickeln? Bietet die Reinszenierung und Resignifizierung dieser Maske ein emanzipatorisches Potenzial für die darunter subsummierten Subjekte,17 oder wird hierdurch deren Status als „Unmarkierte“ einzig und alleine perpetuiert? An die These, dass das Fremde nur als Figuration mit den Mitteln der Repräsentation konkretisiert werden kann, knüpft sich indes auch das Wissen, dass jedwede Figuration nie holistisch sein kann, weil ihre Repräsentation nie totalisierend gelingen kann. Diese Überlegung räumt der darstellenden Kunst durchaus das Potential ein, das zugrunde liegende Problem, wenn schon nicht zu lösen, so doch wenigstens zu transformieren. Darauf setzen offensichtlich auch zahlreiche Initiativen, die aus der Decade of Roma-Inclusion 2005–2015(so der Name des EU-Programms zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Angehörigen der Rom-Völker) hervorgegangen sind und sich in Publikationen und anderweitigen künstlerischen Formaten niederschlagen. Will die Kunst, die der Ausbildung dieser Figuration zugearbeitet hat, ihre realen Effekte indes subvertieren, dann müsste sie auf ebenjenen Spalt fokussieren, der zwischen der Figuration und der realen Person liegt, ihn selbst zum Ausgangspunkt für ein Spiel nehmen, ihn produktiv wenden.18 Das abschließende Beispiel vermag indes eher eine pessimistische Einschätzung zu geben. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше