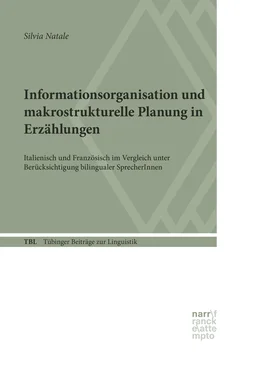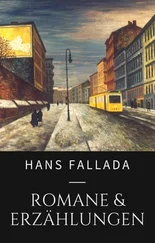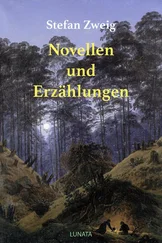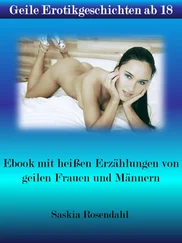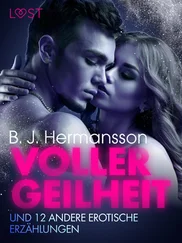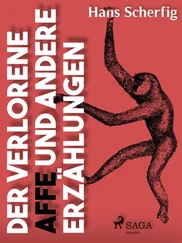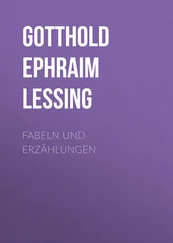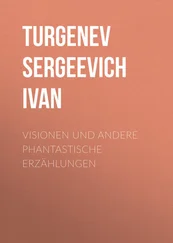2.3. Zur Struktur von Erzählungen
Erzählungen lassen sich in verschiedene Komponenten aufteilen, deren Organisation hierarchisch strukturiert ist. Von der Organisation der Komponenten lassen sich bestimmte narrative Strukturen ableiten, die für die Erzählung typisch sind. Die Struktur von Erzählungen wird hier aufgrund dreier Grundlagen skizziert:
1 Gesamtstruktur von Erzählungen
2 Strukturierende Elemente innerhalb der Erzählung
3 Struktur der Erzählung als Ergebnis einer Textplanung
In Bezug auf die Gesamtstrukturvon Erzählungen hat sich im Bereich der textlinguistischen Fragestellungen der Ansatz des narrativen Schemas (narrative schema) von Labov & Waletzky etabliert (vgl. den Band von Bamberg 1997, der sich mit der Nachhaltigkeit dieses Ansatzes in der Forschung auseinandersetzt). Die grundlegende Studie von Labov & Waletzky (1967) verdeutlicht einerseits, dass mündliche Erzählungen, wie oben ausgeführt, temporal aufgebaut sind, da sie durch die Verknüpfung von Ereignissen eine temporale Sequenz bilden (vgl. I shot and killed him ). Andererseits werden funktionale Einheiten bestimmt, aus denen sich Ereignisse zusammensetzen. Für mündliche Erzählungen stellen Labov und Waletzky fest , dass ihre Komponenten häufig in einer bestimmten Anordnung organisiert werden.
Abstract (abstract)
Orientierung (orientation)
Komplikation (complication)
Evaluation (evaluation)
Auflösung (resolution)
Coda (coda)
Im Abstract, das nicht zwingend vorhanden ist, wird ein Gesamtüberblick über den Inhalt der Erzählung angegeben. In der Phase der Orientierungwerden Angaben zu Personen, Ort, Zeit und Handlungssituation gemacht, die an der dargestellten Ereignissequenz beteiligt sind ( Komplikation). Die Komplikation enthält folglich einen Verweis auf eine Ereigniskette, die schliesslich in der Evaluationreflektiert wird. In der Evaluation sind Kommentare oder expressive Ausdrücke in Bezug auf die Komplikation enthalten. Auf die Evaluation folgt die Auflösung, in welcher der Ausgang der Komplikation geschildert wird. In der Codawird die Sprecherperspektive wieder auf den Zeitpunkt der Gegenwart gelenkt und schlägt den Bogen zum Abstract zurück.
Um mündliche Erzählungen zu strukturieren, können grammatische, lexikalische und intonatorische Mittel ausgeschöpft werden (Gülich 2004). Über grammatikalische Markierungen am Verb kann in Bezug auf dargestellte Ereignisse verdeutlicht werden, welche Ereignisse als Hintergrundhandlungen bzw. als Vordergrundhandlungen zu verstehen sind (vgl. das Inzidenzschema bzw. aspektuelle Oppositionen zwischen passé simple und imparfait im Französischen, vgl. hierzu Pollak 1988 und insbesondere Weinreich 1964).
Zu den lexikalischenMitteln gehören beispielsweise die sogenannten Gliederungssignale, die als universales Merkmal der gesprochenen Sprache eine ordnende Funktion innerhalb des Erzählungsaufbaus haben. Durch diese Form der Gesprächswörter werden innerhalb des Textes Markierungen geschaffen, die den Anfang einer Erzählung, ihren Abschluss oder Exkurse in Bezug auf das Hauptthema signalisieren (vgl. Gülich 1970, Quasthoff 1979, Berretta 1984, Bazzanella 1994). Für die Festlegung von Relevanz und für die Hervorhebung von bestimmten Komponenten innerhalb einer mündlichen Erzählung können u.a. intonatorische Verfahren genutzt werden (vgl. Gülich 2004).
Weitere Ansätze für die Beschreibung der Struktur von Erzählungen beziehen eine Planungskomponenteein. Van Dijk, der in diesem Sinne eine Vorreiterrolle einnimmt, setzt für Texte und somit auch für Erzählungen eine Planung voraus, die für den Sprecher semantisch fundiert, aber noch nicht linear ist. Danach besteht jeder Text aus einer Makrostruktur, die hierarchisch aufgebaut ist und sich aus Mikrostrukturen zusammensetzt. Makrostrukturen bilden zum einen den semantischen Rahmeneines Textes (van Dijk, 1972, Kintsch & van Dijk, 1978) und umfassen Propositionen, die das »Informationsskelett« des Textes bilden. Ferner konstituieren schematische Makrostrukturendie formale Struktur eines Textes (Bierwisch, 1965; van Dijk, 1995). Jeder Text stellt für van Dijk das Produkt von angewandten »Makroregeln« dar, nach denen die Konstituenten eines Textes zu einem übergeordnetem Ganzen verbunden werden. Ein Text beruht in diesem Sinne auf einer »vom Sprecher programmierten noch nicht linearen, semantisch basierten Struktur (…), die dann durch Transformationen schrittweise in eine Textoberflächenstruktur überführt wird« (Vater 2001: 67).
Nach diesem einleitenden Kapitel, in dem Erzählungen definiert und im Hinblick auf ihre Struktur beschrieben wurden, werden in den folgenden Abschnitten die Funktionen aufgezeigt, die Erzählungen innehaben.
2.4. Zur Funktion von Erzählungen
Im obigen Abschnitt wurde bereits angedeutet, dass der interdisziplinäre Zugang zu Erzählungen ihre Funktion im Sinne einer identitäts- und kohärenzstiftendenTätigkeit sieht. Erzählungen werden von der Tatsache gekennzeichnet, dass sie von einem dominanten Erzähler wiedergegeben werden (Gülich & Hausendorf 2000), der deutlich macht, wie er in einem interaktiven Engagement die Beschaffenheit seiner referentiellen Welt zum Ausdruck bringt. So schreibt Bamberg:
The way the referential world is put together points to how tellers »want to be understood,« how they index their sense of self. (Bamberg 2009: 140)
Erzählen ist somit jene Diskursform, die »die Sinnbildungsoperation des Thematisierens (Erlebens) ist« (Gumbrecht 1980: 409). Durch das Erzählen wird der erlebten Welt ein Sinn verliehen, der in einer kohärenten Struktur1 resultiert. Die kohärente Struktur ist nicht zuletzt das Ergebnis einer Verknüpfung von Ereignissen (»temporal junction« nach Labov und Waletzky 1967: 20). Diese Verknüpfung stellt eine grundlegende sowie eine ordnende Eigenschaft von Erzählungen dar. Die identitätsstiftende Funktion von Erzählungen wird besonders aus der Perspektive der Psychologie untersucht. Die Kompetenz des Erzählens, die vom Kindesalter an erworben wird, dient zum einen dem Aufbau der eigenen Identität, zum anderen zeigt die sogenannte narrative Identität auf, welche Verbindungen zur Gesellschaft bestehen:
The stories we construct to make sense of our lives are fundamentally about our struggle to reconcile who we imagine we were, are, and might be in our heads and bodies with who we were, are and might be in the social contexts of family, community, the workplace, ethnicity, religion gender, social class, and culture (…) The self comes to terms with society through narrative identity. (McAdams 2008: 243).
Gumbrecht plädiert daher für einen anthropologisch fundierten Narrations-Begriff. Durch das Erzählen komme ein sinnbildender Prozesszustande, da
subjektive Bewusstseinsabläufe die Ergebnisse subjektiver Erfahrungsprozesse und subjektive Motive in den intersubjektiven Raum der Kommunikation holen. (Gumbrecht 1980: 408–409)
Innerhalb dieser sinnbildenden Funktion kommt das oben erwähnte Charakteristikum zum Tragen, dass Erzählungen von menschlichen oder menschenähnlichen Charakteren getragen werden. Es werden Identitäten von Handlungsträgern aufgebaut, die willentlich Aktionen ausführen und Ereignisse verursachen. Die Entwicklung von Intentionalität, die sowohl den Handlungsträgern als auch den Erzählenden zugrunde liegt, liefert die notwendige mentale Voraussetzung für das Produzieren und Verstehen von Erzählungen (McAdams 2008). Diese kognitiven Prozesse werden im folgenden Abschnitt beleuchtet.
Читать дальше