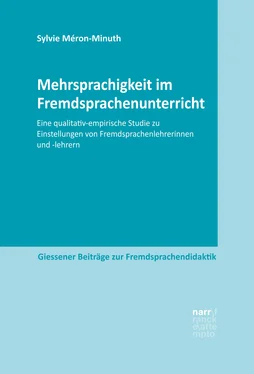Sylvie Méron-Minuth - Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht
Здесь есть возможность читать онлайн «Sylvie Méron-Minuth - Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
2.6.3 Interkomprehensionsforschung
Die Didaktik der Interkomprehension repräsentiert ein recht junges, innovatives Forschungs- und Praxisfeld, das in der Debatte der (Fremd-)sprachendidaktik um die Förderung der Mehrsprachigkeit in Europa zu Beginn der 1990er Jahre aufgetaucht ist (vgl. Doyé 2005; Ollivier & Strasser 2013). Dieses Forschungsfeld entwickelte sich im europäischen Rahmen (man findet auch das Konzept der Eurokomprehension vor; vgl. Meißner 2004), um das bildungspolitische Ziel der europäischen Union zu erreichen. Das Konzept der Interkomprehension geht auf seinen Urheber, den französischen Linguisten Jules Ronjat zurück, der 1913 dieses Konzept (Französisch: intercompréhension ) in seinem Buch zur Syntax der provenzalischen Dialekte « Essai de syntaxe des parlers provençaux modernes » erstmals verwendete. Ronjat begründet den Begriff in der Annahme, dass Sprecher verschiedener provenzalischer Varietäten sich gegenseitig ausgezeichnet verstehen würden, und somit der Eindruck gewonnen werden könnte, dass es um dieselbe Sprache ginge, die lediglich anders ausgesprochen würde. Nach der erstmaligen Prägung des Begriffs der Interkomprehension durch Ronjat wurde das Grundprinzip immer weiter verfeinert und später einige Projekte zur Förderung der europäischen Mehrsprachigkeit durchgeführt, wie per exemplum im skandinavischen Raum (vgl. nähere Ausführungen dazu in: Ollivier & Strasser 2013: 11–15).
Die Interkomprehensionsdidaktik stößt auch in Deutschland seit über zwei Jahrzehnten auf ein reges Interesse, welches sich in zahlreichen Projekten und Publikationen niederschlägt (vgl. z.B. Klein & Stegmann 2000; Schöpp 2008; Bär 2004, 2009; Meißner 2004, 2005, 2008; Mordellet-Roggenbuck 2015; Prokopowicz 2017). Dennoch hat sie nur in wenigen Bundesländern Eingang in Curricula und Lehrpläne gefunden und wird demzufolge auch nur zögernd in die Unterrichtspraxis einbezogen (Ollivier & Strasser 2013). Interkomprehension ist eine Kommunikationsmethode, die einen neuen Ansatz für das Sprachenlernen darstellt. Allerdings zeigt dieser Begriff in der Fülle der existierenden Definitionen, dass er weitgehend diffus und vielschichtig zu betrachten ist, und nicht immer eine allgemeingültige, einheitliche Definition durch die Forscherinnen und Forscher erfährt (vgl. z.B. Klein 2000, 2004; Klein & Reissner 2002; Meißner 2000, 2004, 2007; Ollivier & Strasser 2013: 9f.).
Klein und Reissner (2002) verstehen unter Interkomprehension die Fähigkeit, in einer Gruppe von Sprachen, die einen gemeinsamen Ursprung haben, kommunizieren zu können (Klein & Reissner 2002: 19).
Für Doyé (2005) bedeutet Interkomprehension, dass zwei Sprecherinnen und Sprecher verschiedener Erstsprachen miteinander kommunizieren und unter Verwendung ihrer jeweiligen Sprache interagieren und sich verstehen können, so wie er dies mit folgendem Zitat zu veranschaulichen trachtet:
« L’intercompréhension est une forme de communication dans laquelle chaque personne s’exprime dans sa propre langue et comprend celle de l’autre. » (Doyé 2005: 7)
Die Vorteile dieser Positionierung liegen darin, dass Doyé die gesprochene und geschriebene Sprache miteinschließt und die aktive Nutzung der Zielsprache ausschließt. Hierbei gibt es zwei Aspekte; Ersterer ist die Performanzebene, die sich auf die Aktivität zweier Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen bezieht, die kommunizieren, indem sie ihre eigene Sprache sprechen und die des jeweiligen Anderen verstehen. Der zweite Aspekt ist die Kompetenzebene, die sich auf die Fähigkeit bezieht, eine andere Sprache zu verstehen, ohne sie gelernt zu haben (vgl. Doyé 2005: 7; Übersetzung durch die Verfasserin).
Meißner (2009) und gleichermaßen Meißner, Tesch und Vázquez (2011) erfassen hingegen Interkomprehension als:
„[…] die Fähigkeit und den Vorgang, eine sprachliche Varietät oder eine Sprache zu verstehen, ohne sie in zielsprachlicher Umgebung auf natürliche Weise erworben oder mittels Fremdsprachenunterricht erlernt zu haben.“ (Meißner; Tesch & Vázquez 2011: 81)
Mit dieser Auffassung sehen Meißner, Tesch und Vázquez die Interkomprehension somit als rezeptive Kompetenz, bei welcher das Verstehen von Sprachen für den Kommunikationspartner, die er entweder gar nicht oder jedenfalls nicht produktiv gelernt hat, im Vordergrund steht. Marcus Bär et alii (2005: 84), die die Interkomprehension ebenfalls als die Befähigung auffassen, „[…] eine fremde Sprache lesend oder hörend zu verstehen, ohne sie formale erlernt zu haben“, fügen hinzu, dass es sich um Sprachvarietäten innerhalb derselben Sprachfamilie handelt:
„Nicht nur Varietäten (Dialekte, Soziolekte) einer und derselben Sprache […] füreinander interkomprehensiv, sondern weitgehend auch nah miteinander verwandte Sprachen.“ (Bär; Gerdes; Meißner & Ring 2005: 84)
Die Interkomprehension stellt somit eine Methode zum Erwerb rezeptiver Kompetenzen in allen romanischen, germanischen und slawischen Sprachen dar, auf denen anschließend aufgebaut werden kann. Sie geht von der Beobachtung von Verstehenspotenzialen zwischen Kommunikationspartnerinnen und -partnern der drei genannten großen europäischen Sprachgruppen aus (vgl. Meißner 2004; Doyé 2008; Reissner 2007 und 2011).
Klein und Stegmann (2000) heben drei essenzielle Zielsetzungen für die Interkomprehension hervor:
1 Es ist die Methode, um eine wirkliche Sprachendiversifizierung im Schul- und Bildungssystem Europas realistisch möglich zu machen.
2 Es ist die Methode, um Sprachenkompetenzdiversifizierung zu erreichen und den Erwerb breitgestreuter rezeptiver Kompetenzen als besonders europarelevant aufzuwerten.
3 Es ist die Methode, um kleinen und Minderheitensprachen Europas erstmalig ein Minimum an Präsenz im gesamten europäischen Schulsystem einräumen zu können. (Klein & Stegmann 2000: 9; Hervorhebungen im Text)
2.6.4 Der EuroComRom-Ansatz und seine Umsetzung
Das von der Europäischen Union geförderte Forschungsprojekt EuroCom steht im engen Verhältnis zur Mehrsprachigkeitsdidaktik und stützt sich auf Forschungen zur europäischen Interkomprehension. Das Projekt, das 1998 in Hagen von der Forschergruppe EuroCom gegründet wurde, nimmt sich die sprachenpolitischen Bestrebungen der europäischen Union von 1995 zum Vorbild und hat dabei die Intention, eine rezeptive Mehrsprachigkeit, vorerst für die romanischen, später für die slawischen und die germanischen Sprachen auszubilden (vgl. Klein 2002: 29).
Die Romanisten Horst G. Klein und Tilbert D. Stegmann der Universität Frankfurt am Main entwickelten in der Folge den Ansatz EuroComRom, der es ermöglicht, in allen romanischen Sprachen simultan rezeptive Kompetenzen bzw. Teilkompetenzen in einer oder mehreren verwandten Fremdsprachen zu erlangen und somit langfristig mit Hilfe der Interkomprehension1 einen produktiven Umgang mit Fremdsprachen zu schaffen. Primäres Ziel der Forschergruppe EuroComRom ist es, einen qualitativen Sprung bei der Förderung europäischer Mehrsprachigkeit zu erreichen. Hierbei soll den Lernenden eine rezeptive Kompetenz innerhalb einer Sprachfamilie durch interlinguale Lese- und Hörkompetenz vermittelt werden, die als Einstieg in das Lernen einer neuen Sprache2 nutzbar gemacht werden kann. Dem Lernenden wird somit verdeutlicht, dass er durch die Kenntnis seiner Muttersprache und lediglich einer Brückensprache bereits eine unerwartete Vielzahl von Kenntnissen mitbringt, um beispielsweise Nachrichten- oder noch Fachtexte in allen typologisch verwandten, aber noch nicht erlernten Sprachen in kürzester Zeit verstehen zu können. Weitere, über das Lese- und Hörverstehen hinausgehende Kompetenzen lassen sich daraus höchst lernökonomisch und nach eigenem Bedarf beschleunigt entwickeln (vgl. Klein 2006).
Darin sieht sich dieses methodische Vorgehen als komplementär zum konventionellen schulischen Sprachen- und Sprachenlernangebot (vgl. Klein & Stegmann 1999: 11). Denn im Vergleich zum traditionellen Fremdsprachenunterricht aktiviert EuroComRom vorhandene, ungenutzte Kompetenzen der Lernenden. Darin liegt der große Unterschied beim Erlernen neuer Sprachen zum konventionellen Fremdsprachenunterricht. Der Lernende wird sprachlich nicht als völlig „unbeschriebenes Blatt“ angesehen, sondern es wird damit begonnen, ihm zu verdeutlichen, was er aus einem einfachen Gebrauchstext in der neuen Sprache schon alles entziffern kann. Strategien zur Erleichterung und Beschleunigung der Anfangsphase von Sprachlernprozessen werden erarbeitet und somit ein früher Übergang zu Nachbarsprachen ermöglicht. Während im konventionellen Anfangsunterricht Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit verbessert werden und darauf geachtet wird, dass die Lernenden möglichst alles korrekt wiedergeben, so verfolgt EuroComRom das Ziel, jede annäherungsweise richtige Erschließungsleistung zu verstärken, und somit das Erlernen anderer Sprachen in einem neuen Kontext zu erfahren. Fehler werden bei dieser Methode neu bewertet. Durch Versuch und Irrtum gelangt der Lerner zu einer neuen Stufe der eigenen Reflexion über Sprachlernprozesse. Damit kann einer Entmutigung auf Seiten der Lernenden entgegengewirkt werden. EuroComRom setzt realistische sprachliche Nahziele und vermeidet einen illusionären Perfektionismus. Vielmehr soll ein Mehr an Teilkompetenzen in vielen Sprachen erreicht werden (vgl. Klein & Stegmann 2000: 13). Zudem wird dem Lernenden aufgezeigt, dass Sprachenlernen machbar ist, wo eine Sprachverwandtschaft besteht. Dies lässt sich innerhalb der Sprachfamilien sehr gut verdeutlichen. Sprecherinnen und Sprecher einer europäischen Sprache besitzen bereits ein sehr breit gefächertes Wissen über die meisten anderen europäischen Sprachen. EuroComRom will aufzeigen, dass Nachbarsprachen keine Fremdsprachen darstellen. Lernende sollen das linguistische Wissen, das sie bereits besitzen, nicht ungenutzt lassen und durch Analogieschlüsse und Nutzung der Logik des Kontextes Unbekanntes erschließen. Hierzu vermittelt EuroComRom transferierbare Erschließungsstrategien und bedient sich der „Sieben Siebe“. Dabei handelt es sich um von Klein und Stegmann (1999) entwickelte linguistische Transferbasen, nach denen der Lerner aus fremdsprachlichen Texten alle verständlichen Elemente (Lexeme und Satzstrukturen) zur Dekodierung herausfiltert und sieben Mal auf Bekanntes hin durchsiebt (vgl. Klein & Stegmann 2000: 13). Das erste Sieb umfasst den internationalen Wortschatz, der in zahlreichen europäischen Sprachen aufgrund der gemeinsamen lateinischen Basis ähnlich ist. Dass der internationale Wortschatz als erstes Sieb steht, ist darauf zurückzuführen, dass er in einem fremdsprachigen Text am einfachsten zu dekodieren ist. Das zweite Sieb schließt den panromanischen Wortschatz ein, demzufolge Lexeme, die in allen romanischen Sprachen auftreten und die ihnen gemeinsam sind. Sofern der Lerner Kenntnisse einer romanischen Sprache aufweist, ist er in der Lage, diesen Gewinn für andere Sprachen heranzuziehen und Wortschatz zu entschlüsseln. Das dritte Sieb untersucht die Lautentsprechungen und ist für die Dekodierung förderlich, da viele häufig auftretende Lexeme vordergründig nicht lexikalisch verwandt zu sein scheinen, dadurch dass sie im Laufe der Sprachgeschichte Modifizierungen durchlaufen haben. Demnach filtert das dritte Sieb Lautentsprechungsformeln, damit der Lerner die Gemeinsamkeiten deutlich erkennt. Das dritte Sieb steht inhaltlich in enger Verbindung mit dem vierten Sieb, den Graphien und Aussprachen, da häufig gleiche Laute unterschiedlich geschrieben und gesprochen werden. Des Öfteren begegnet der Lerner Schwierigkeiten beim Dechiffrieren von Wörtern aufgrund einer divergenten Schreibweise, beziehungsweise einer unterschiedlichen Aussprache. Aus diesem Grund muss er den Zusammenhang zwischen Graphie und Aussprache erfassen, um Wortverwandtschaften aufdecken zu können. Das fünfte Sieb bezieht sich auf die panromanische Syntax. Es existieren neun in allen romanischen Sprachen vorherrschende Kernsatztypen, deren Kenntnis vor allem bei einer komplexen Syntax dienlich ist. Durch das Wissen um die syntaktischen Strukturen kann rasch konstatiert werden, ob ein Wort ein Verb, ein Adjektiv oder noch ein Substantiv ist. Das sechste Sieb ergründet die morphosyntaktischen Elemente wie grammatische Phänomene, z.B. Steigerungsformen, Artikel oder Pluralmarkierungen. Dabei handelt es sich vor allem um Konvergenzen innerhalb der lebenden romanischen Sprachen, die das Lateinische nicht aufweist. Das siebte und letzte Sieb filtert schließlich Präfixe und Suffixe. Diese befähigen den Lerner, den Sinn zusammengesetzter Wörter durch Isolierung vom Wortstamm zu entschlüsseln (vgl. Klein & Stegmann 2000: 13ff.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.