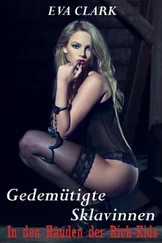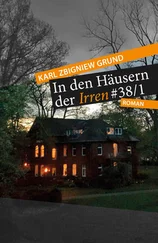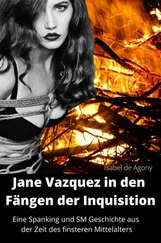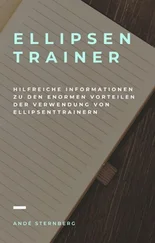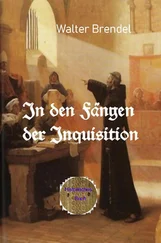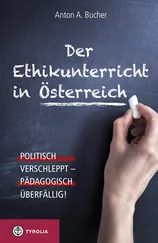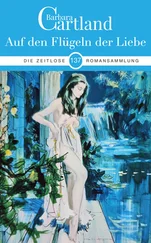Luhmann, Niklas (2008). Die Moral der Gesellschaft. Frankfurt a.M: Suhrkamp.
Luke, Brian (1995). Taming ourselves or going feral? Toward a nonpatriarchal metaethic of animal liberation. In: Adams, Carol J./Donovan, Josephine (Eds.) Animals & Women. Feminist Theoretical Explorations. Durham: Duke University Press, 290–319.
Rorty, Richard (1989). Kontingenz, Ironie und Solidarität. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Was bedeutet Ethik ‚in‘ den Wissenschaften? Möglichkeiten zur Auflösung einer räumlichen Metapher
Philipp Richter
Die „Ethik in den Wissenschaften“ ist seit mindestens 1985 Programm an der Universität Tübingen. In einem Gesprächskreis ging es von Anfang an darum, in interdisziplinärer Konstellation „ethische Fragen zu besprechen, die sich in und mit Bezug auf die Wissenschaften stellen“ (Potthast/Ammicht Quinn 2015: 9). 1990 wurde das „Zentrum für Ethik in den Wissenschaften“ gegründet, das im vergangenen Jahr sein 25jähriges Jubiläum feierte. Mit Gründung des Zentrums erfolgte zudem die Einrichtung der Lehrstühle „Ethik in den Biowissenschaften“ und „Ethik in der Medizin“ (ebd.). Darüber hinaus wurden von 1991–2001 im Rahmen des Graduiertenkollegs „Ethik in den Wissenschaften“ zahlreiche weitere Projekte im Feld der anwendungsbezogenen Ethik durchgeführt. Wichtige Impulse für Lehre und Forschung in der anwendungsbezogenen Ethik gehen von den Mitarbeitenden des Ethikzentrums aus, wie die zahlreichen Projekte und Publikationen zeigen; nicht zuletzt ist das die Entwicklung eines Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudiums für die Universitäten in Baden-Württemberg (siehe Maring 2005). Das Programm einer „Ethik in den Wissenschaften“ hat sich also institutionell etabliert.
Doch warum enthält das Programm gerade diese womöglich etwas sperrige Formulierung? Weshalb lautet der Titel nicht vielmehr „Angewandte Ethik“ bzw. „Anwendungsbezogene Ethik“, „Wissenschaftsethik“, „Ethische Fragen der Einzelwissenschaften“ oder „Ethik der wissenschaftlich-technischen Zivilisation“? Nein – diese Vorschläge scheinen nicht zu treffen, was hier eigentlich gemeint ist. Vielmehr ist die Verwendung der Präposition „in“ entscheidend.1 Ihre metaphorische Verwendung hat sich im Topos „Ethik in den Wissenschaften“ verdichtet, der dabei verschiedene Bedeutungsdimensionen vereint. Um die Auflösungsmöglichkeiten der Metapher, also um eine Klärung des Programms und das Aufdecken seiner begrifflichen Spannungen soll es im Folgenden gehen. Damit will ich weitere Perspektiven für die methodologische Reflexion des ethischen Nachdenkens unter „Anwendungsbedingungen“ eröffnen. Denn bekanntlich sind die Bezeichnung, der Begriff, die Methode und Zielsetzung einer „Angewandten Ethik“ in der Diskussion heftig umstritten (Überblick in: Richter 2015; siehe Gehring 2015: 27–32; Hubig 2015: 193–205; Kaminsky 2005; Wolf 1994: 187f.), obwohl freilich in der Forschungspraxis unter diesem Titel methodisch überzeugende und erkenntnisreiche Projekte durchgeführt werden. Aber nicht jede Aktivität, die Anspruch macht, „Ethik“ zu sein, ist ohne weiteres als solche zu bezeichnen. Hier müssten methodische Standards gesichert und auch die Leistung und Grenzen des Faches „philosophische Ethik“ klarer benannt werden. Wie z.B. lässt sich das philosophisch fundierte Nachdenken über moralische Urteile und gelebte Normen und Werte, also das ethische Reflektieren im engeren Sinne, in der Praxis von anderen Formen des Nachdenkens unterscheiden? Das Titelwort „Ethik“ steht jenseits des selbstzweckhaft betriebenen akademischen Faches – also auch als Ethik „in“ den Wissenschaften – häufig unter dem Verdacht der unbegründeten Moralisierung und Bevormundung, der politischen Akzeptanzbeschaffung oder des „Etikettenschwindels“ zur Verschleierung eigentlich strategischer Interessen (siehe Dietrich 2007: 111f.; Gehring 2015: 37–39; Poscher 2013: 437f.).
Zur Klärung der Frage, was „Ethik in den Wissenschaften“ als eine Ethik unter „Anwendungsbedingungen“ ausmacht, ist es hilfreich, die Metaphorik des Topos genauer zu betrachten, um diese dann exemplarisch mit programmatischen Texten des Ethikzentrums, die hierzu konzeptuelle Überlegungen anstellen, in ein Verhältnis zu setzen. Das Ethikprogramm des IZEW wird vor allem mit Metaphern des Räumlichen gefasst (vgl. IZEW 2010: 4f.; siehe Hasenclever 1992: 28; Mieth 2007: 39ff.; Engels 2005: 146):
Bei der Forschungsarbeit treten „in“ den Wissenschaften auf Werte und Normen bezogene Fragen auf, die rechtlich oder moralisch nicht eindeutig geregelt sind und daher mit den Mitteln der Ethik geklärt werden müssen. Diese Fragen sollen „in“ den betroffenen Disziplinen und nicht „neben“ diesen bearbeitet werden. Erforderlich sei demnach nicht eine Ethik, die „nach“ oder „zu den Wissenschaften“, sondern „in den Wissenschaften selbst“ stattfindet.
Außer den eher räumlichen Metaphern „in“, „neben“ und „zu“ kommt mit „nach“ auch eine zeitliche Metapher vor. Wie Werner Köster2 im Wörterbuch der philosophischen Metaphern ausführt, kann „Raum“ als „Meta-Metapher“ bezeichnet werden, die ein „ganzes Feld von topischen Begriffen […] strukturiert“ und somit grundsätzliche Unterscheidungs-Möglichkeiten für jeden Bereich des Denkbaren erlaubt. Hierzu gehören Begriffe wie z.B. innen oder außen, peripher oder zentral, höher oder tiefer sowie Ebene, Stufe, Schwelle und viele mehr (siehe Köster 2007: 278). Weiter zählt hierzu insbesondere die räumliche Metapher der „Grenze“, die mit Blick auf den wissenschaftlichen Erkenntnisvorgang mit dem Erfordernis der Gedankenklärung, der methodischen Sicherung und Wiederholbarkeit von Erkenntnis als „Definieren“, also als Einführen von begrifflichen Unterscheidungen, besonders relevant ist (siehe Zill 2007: 144f.). Nun könne, so wird oben in der Paraphrase ausgeführt, anwendungsbezogene Ethik einerseits „in den Wissenschaften selbst“, also im „begrenzten Bereich“ einer Wissenschaft, betrieben oder andererseits fälschlicherweise neben diesem Bereich, nach diesem oder zu diesem hin praktiziert werden. Freilich funktioniert hier „Bereich“ wiederum nur im übertragenen Sinne, da die Wissenschaften nicht an bestimmte Orte gebunden sind und auch nicht als materielle „Container“, die etwas enthielten, aufgefasst werden können. Intuitiv kann jedoch wohl jeder mit dieser „verräumlichten“ Redeweise etwas anfangen, so dass „Ethik in den Wissenschaften“ bereits als etablierter Topos gelten kann, der sich zur Argumentation, Plausibilisierung und Illustration eignet und dessen Metaphorik „eine besondere Kraft zu überzeugen zukommt“ (Brenneis 2014: 89f.). Ich folge hier Andreas Brenneis, der Metaphern über das Moment des unüblichen Sprachgebrauchs charakterisiert: „Metaphern resultieren daraus, dass sprachliche Mittel in ungefügter Weise miteinander verwendet werden, dass Worte aufeinander bezogen werden ohne dies von sich aus anzubieten […]. Mindestens zwei der Bestandteile eines Satzes erzeugen zusammen eine unerhörte Beziehung, die einen Leser und sein Verständnis irritieren, verunsichern, beeindrucken oder begeistern kann“ (siehe ebd.). Metaphern können, wenn ihre Verwendung – wie es vielleicht bei der Rede von „Ethik in den Wissenschaften“ der Fall ist – nicht mehr überrascht, zu Topoi werden (Brenneis 2014: 93), also zu Gemeinplätzen, die sich als Gesichtspunkte zur Findung von überzeugenden Argumentationen, Begründungen und Beweisen eignen (siehe Hubig 1990: 140f.). Die begriffliche Undeutlichkeit eines Topos, also ein stark metaphorisches Moment, kann hier relativ zum Ziel des Argumentierens vorteilhaft oder nachteilig sein. Auch lassen sich wohl nicht alle Metaphern oder als Topoi verwendete Metaphern, insbesondere die auf das Denken bezogenen, in eine direkte Redeweise überführen. Es ist jedoch sicherlich ertragreich, den im Topos verborgenen begrifflichen Konzepten nachzuspüren und diese explizit zu machen – nicht um den Topos unbrauchbar zu machen (weil womöglich zweifelhaft, unklar, manipulativ etc.), sondern um das entsprechende Forschungs- und Lehrprogramm besser zu verstehen.
Читать дальше