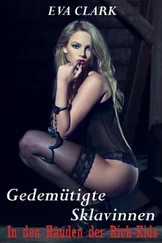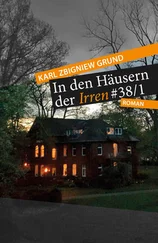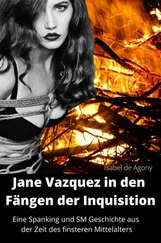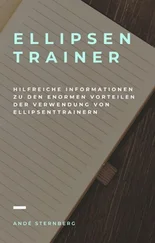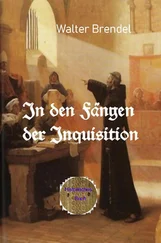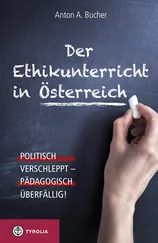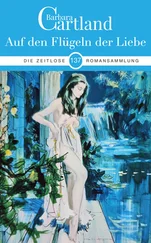1 ...7 8 9 11 12 13 ...29 Brendel, Elke (2011). Art. Wissenschaft. In: Kolmer, Petra/Wildfeuer, Armin G. (Hrsg.) Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Bd. 3. Freiburg i. Br.: Alber. 2588–2601.
Brenneis, Andreas (2014). Zur topologischen Ordnung von Metaphern. Ein methodologischer Zugang. In: Journal Phänomenologie 41/2014, 89–98.
Dietrich, Julia (2007). Grundzüge einer Ethik der Ethik. In: Berendes, Jochen (Hrsg.) Autonomie durch Verantwortung: Impulse für die Ethik in den Wissenschaften. Paderborn: Mentis, 111–146.
Düwell, Marcus (1996). Zur Arbeit des Zentrums für „Ethik in den Wissenschaften“ an der Universität Tübingen. In: Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaft 37/1996, 220–231.
Düwell, Marcus (2001). Angewandte Ethik. Skizze eines wissenschaftlichen Profils. In: Holderegger, Adrian/Wils, Jean-Pierre (Hrsg.) Interdisziplinäre Ethik. Freiburg i. Br.: Herder, 165–184.
Düwell, Marcus (2015). Ethik als Reflexion auf unser praktisches Selbstverständnis – Reflexionen zur „Ethik in den Wissenschaften“ anlässlich des Jubiläums des Tübinger Ethikzentrums. In: Ammicht Quinn, Regina/Potthast, Thomas (Hrsg.) Ethik in den Wissenschaften. 1 Konzept, 25 Jahre, 50 Perspektiven. (IZEW Materialien, Bd. 10). Tübingen: IZEW, 69–75.
Engels, Eve-Marie (2004). Ethik in den Wissenschaften – Das Programm des Interfakultären Zentrums für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen. In: Bund Freiheit der Wissenschaft (Hrsg.) Freiheit und Verantwortung in Forschung, Lehre und Studium. Die ethische Dimension der Wissenschaft. Berlin, 11–40.
Engels, Eve-Marie (2005). Ethik in den Biowissenschaften. In: Maring, Matthias (Hrsg.) Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium 2. Ein Projektbuch. Münster: LIT Verlag, 135–166.
Gehring, Petra (2015). Ethik und Politik, Ethik als Politik, Ethikpolitik. In: Gamm, Gerhard/Hetzel, Andreas (Hrsg.) Wozu Ethik? Bielefeld: transcript, 19–39.
Goergen, Klaus (2015). Ethik für alle? Plädoyer für ein Pflichtfach Philosophie/Ethik, in: Schmidt, Donat/Dietrich, Julia (Hrsg.) Moralische Urteilsbildung. In: ZDPE 2/2015, 91–98.
Hasenclever, Andreas (1992). Das Tübinger Zentrum für Ethik in den Wissenschaften: Das Pfeifen der Moral im Wald der Wissenschaften? In: Ethik und Unterricht 4/1992, 27–30.
Hubig, Christoph (1990). Analogie und Ähnlichkeit. Probleme einer theoretischen Begründung vergleichenden Denkens. In: Jüttemann, Gerd (Hrsg.) Komparative Kasuistik. Heidelberg: Asanger, 133–142.
Hubig, Christoph (2015). Die Kunst des Möglichen: Macht der Technik, Bd. III. Bielefeld: trancript.
IZEW (2010). Was heißt Ethik in den Wissenschaften? Ziele und Aufgabe des IZEW. In: Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (Hrsg.) 20 Jahre IZEW. 1990–2010, Jubiläumsmagazin, Tübingen: IZEW, 4f.
Kaminsky, Carmen (2005). Moral für die Politik. Eine konzeptionelle Grundlage der angewandten Ethik. Paderborn: Mentis.
Kambartel, Friedrich (2004). Art. Wissenschaften. In: Mittelstrass, Jürgen (Hrsg.) Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Bd. 4. Stuttgart/Weimar: Metzler, 719–721.
Köster, Werner (2007). Art. Raum. In: Konersmann, Ralf (Hrsg.) Wörterbuch der philosophischen Metaphern. Darmstadt: WBG, 278–296.
Mack, Günther (1989). Ethik in den Naturwissenschaften in der Spannung zwischen Utopie und Realität. In: Wils, Jean-Pierre/Mieth, Dietmar (Hrsg.). Ethik ohne Chance? Erkundungen im technologischen Zeitalter. Tübingen: Attempto, 21–44.
Maring, Matthias (Hrsg.) (2005). Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium 2. Ein Projektbuch. Münster: LIT Verlag.
Mieth, Dietmar (1990). Bericht vom Symposium. In: Steigleder, Klaus/Mieth, Dietmar (Hrsg.) Ethik in den Wissenschaften. Ariadnefaden im technischen Labyrinth? Tübingen: Attempto, 321–329.
Mieth, Dietmar (2001). Organisierte Ethik in den Lebenswissenschaften. In: Medizinische Genetik 13/2001, 299–302.
Mieth, Dietmar (2007). Fortschritt mit Verantwortung: Ein Essay mit einem Blick auf das Konzept einer ‚Ethik in den Wissenschaften‘. In: Berendes, Jochen (Hrsg.) Autonomie durch Verantwortung: Impulse für die Ethik in den Wissenschaften. Paderborn: Mentis, 21–43.
Mildenberger, Georg (2007). Ethik in den Wissenschaften – Ethik in den Fächern. In: Ammicht Quinn, Regina et al. (Hrsg.) Wertloses Wissen? Fachunterricht als Ort ethischer Reflexion. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 52–66.
Nietzsche, Friedrich (1981/1873). Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. In: Ders.: Werke. Bd. III. Hrsg. v. K. Schlechta. Berlin: Ullstein, 1017–1030.
Poscher, Ralf (2013). Was Juristen besser können als Ethiker. Ein interdisziplinäres Argument für die gerichtliche Kontrolle von Ethikkommissionen. In: Vöneky, Silja et al. (Hrsg.) Ethik und Recht. Die Ethisierung des Rechts. Heidelberg et al.: Springer, 433–441.
Potthast, Thomas/Ammicht Quinn, Regina (2015). Ethik in den Wissenschaften und das Tübinger Ethikzentrum – Einleitende Bemerkungen. In: Ammicht Quinn, Regina/Potthast, Thomas (Hrsg.) Ethik in den Wissenschaften. 1 Konzept, 25 Jahre, 50 Perspektiven. (IZEW Materialien, Bd. 10). Tübingen: IZEW, 9–13.
Richter, Philipp (2015). Was bedeutet ‚Anwendung‘ in der Ethik? In: Ammicht Quinn, Regina/Potthast, Thomas (Hrsg.) Ethik in den Wissenschaften. 1 Konzept, 25 Jahre, 50 Perspektiven. (IZEW Materialien, Bd. 10). Tübingen: IZEW, 199–206.
Treptow, Rainer (2015). Wissenschaftswelten. Sieben Vignetten zum Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW). In: Ammicht Quinn, Regina/Potthast, Thomas (Hrsg.) Ethik in den Wissenschaften. 1 Konzept, 25 Jahre, 50 Perspektiven. (IZEW Materialien, Bd. 10). Tübingen: IZEW, 53–57.
Wolf, Ursula (1994). Applied Ethics, Applying Ethics and the Methods of Ethics. In: Pauer-Studer, Herlinde (Hrsg.) Norms, Values and Society. Dordrecht: Kluwer, 187–196.
Zill, Rüdiger (2007). Art. Grenze. In: Konersmann, Ralf (Hrsg.) Wörterbuch der philosophischen Metaphern. Darmstadt: WBG, 138–149.
Die Freiheit, etwas tun zu müssen – zum Zusammenhang von Selbstbestimmung und praktischer Normativität bei Hegel
Sebastian Ostritsch
Die Überlegungen, die ich im Folgenden anstellen möchte, drehen sich um den begrifflichen Zusammenhang zweier wesentlicher Merkmale des alltäglichen menschlichen Selbstverständnisses. Ich meine erstens die Erfahrung, ein freies Wesen zu sein und zweitens die Erfahrung, durch Normen zu bestimmten Handlungen bzw. Handlungsweisen verpflichtet zu sein. Diese beiden Grunderfahrungen menschlichen Daseins scheinen sich auf den ersten Blick schlecht miteinander zu vertragen: Frei zu sein, so könnte man meinen, heißt auch frei zu sein von Normen, die das selbstbestimmte Wählen und Wollen reglementieren und damit einengen. Die Lage wird dadurch noch verzwickter, dass die Rede von praktischen Normen nur dann sinnvoll ist, wenn diese Normen an Wesen gerichtet werden, die nicht fremdbestimmt, sondern in irgendeinem Sinne selbstbestimmt sind. Denn praktische Normen sind solche, die vorschreiben, was getan werden soll . Wer nichts für sein Verhalten kann, an den können auch keine normativen Forderungen gerichtet werden. Wir scheinen somit vor der paradoxen Situation zu stehen, dass praktische Normativität zwar der Freiheit bedarf, umgekehrt aber Freiheit nur ohne die Zwänge des Sollens Freiheit zu sein scheint.
Im Folgenden möchte ich versuchen, das Verhältnis von Freiheit und praktischer Normativität zu erhellen und die vermeintliche Spannung zwischen diesen beiden aufzulösen. Meine Leitthese lautet, dass Freiheit wohlverstanden nicht völlige Ungebundenheit bedeutet, sondern die Verpflichtung, das Richtige zu tun. Diese Verpflichtung ist aber keine fremde, uns von außen aufgezwungene, sondern selbstbestimmte Selbstverpflichtung.
Читать дальше