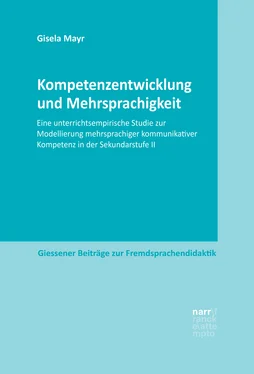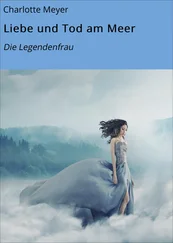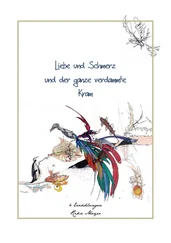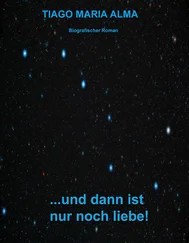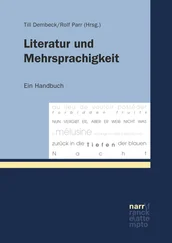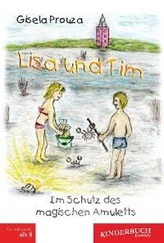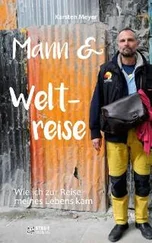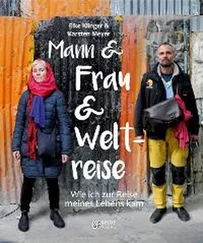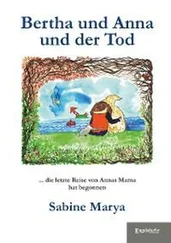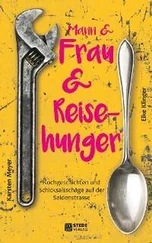Diese Mittlerfunktion ist aufgrund der besonderen Gegebenheiten in Südtirol sehr wichtig. Wie bereits im vorhergehenden Absatz erwähnt, findet sich hier eine für den Spracherwerb z.T. sehr problematische Situation. Die DLC ( Dominant Language Constellation ) ist üblicherweise Deutsch; Italienisch und Englisch, Englisch folgt also auf Italienisch und ist demzufolge L3. Aufgrund der geschichtlichen Ereignisse und der daraus resultierenden Konsequenzen auf sprachlicher Ebene ergibt sich bei vielen SchülerInnen folglich eine als problematisch anzusehende Sprachkonstellation, da L2 (Italienisch) weitgehend negativ behaftet ist, wie unter anderem auch aus der KOLIPSI-2-Studie der EURAC hervorgeht (2017). In der vorliegenden Studie ist zu zeigen, dass ein mehrsprachiger Unterricht, der Italienisch nicht gesondert von anderen Sprachen behandelt, sondern es integriert und durch diese Gleichbehandlung in seiner Funktion und seinem sozialen Prestige aufwertet, die subjektive Wahrnehmung der Sprachkonstellation einzelner Lernenden dahingehend positiv beeinflusst, dass Italienisch psychotypologisch und emotional anders empfunden wird und somit das metasprachliche Bewusstsein und sein Potenzial für den Sprachenerwerb und die kulturelle Begegnung besser ausgeschöpft werden kann. Ein wichtiges Instrument hierfür ist der mehrsprachige Aushandlungsprozess, weil unter anderem durch die Mittlerfunktion mehrsprachiger Lernender die durch geschichtliche Ereignisse bedingte emotionale Trennung von Sprachen und Kulturen durchlässiger werden.
Die aufgezeigten Unterschiede zwischen einsprachigen und zwei- bzw. mehrsprachigen Sprechern, die zunehmende sprachliche Vernetzung durch simultanen Sprachgebrauch bei beiden und der daraus resultierende Kompetenzzuwachs sind im Rahmen einer Modellierung mehrsprachiger Kompetenz ein Erkenntnispool, der bei der Datenauswertung und Ausformulierung der Deskriptoren zur MKK herangezogen werden kann, denn erst dieser ermöglicht die Analyse der vielfältigen mehrsprachigen Gesprächspraktiken.
4.5 MKK – Mehrsprachige Gesprächspraktiken und einfaches Sprachmanagement
Die Verwendung mehrsprachiger Gesprächspraktiken wie Code-switching (CS ) , Code-mixing (CM), Translanguaging (TL) u.a.m. in sprachlich heterogenen Gruppen ist eine kennzeichnende Praxis und verschafft Einblick in die Entwicklung der MKK. Im Falle der vorliegenden Studie konnte anhand von Audio- und Videoaufzeichnungen über einen Zeitraum von 7 Monaten beobachtet werden, wie sich diese Praktiken und der Kompetenzzuwachs im Bereich Mehrsprachigkeit bei den Lernenden der Recherchegruppe entwickeln.
Die mehrsprachigen Gesprächspraktiken fallen größtenteils in den Bereich des einfachen Sprachmanagements1 (Neustupný & Nekvapil 2003). Gemeinhin wird angenommen, dass mit Sprachmanagement vor allem Fragen der sprachlichen Kompetenz gelöst werden. Es werden demzufolge im Diskurs sprachliche Probleme aufgegriffen und durch entsprechende Korrekturmaßnahmen gelöst. Allerdings umfasst das Forschungsgebiet ein viel umfassenderes Spektrum an möglichen Interventionen. Diese beinhalten unterschiedliche kommunikative Phänomene sowie soziokulturelle und sozioökonomische Aspekte. Man versteht also darunter im weitesten Sinne all jene Aktivitäten metasprachlicher Art, die mit der Sprachproduktion zusammenhängen, mit der Absicht, diese durch bewusste oder unbewusste Eingriffe zu regulieren. Als „Verhaltensmuster gegenüber Sprache“ (Fishmann 1975: 30) betrifft es die individuellen Merkmale des Sprachgebrauchs eines Individuums in einer konkreten Interaktionssituation. Es kann sich sowohl mit Sprachvarietäten und Dialekten beschäftigen als auch mit der Verwendung mehrerer Sprachen im Diskurs. Dabei wird der Frage nachgegangen, nach welchen Kriterien und aufgrund welcher Bedürfnisse im Diskurs bestimmte Sprachen anderen vorgezogen werden, wie die Sprachwahl erfolgt und was sie beeinflusst. Fälle von Sprachmanagement oder gesprächsstrategischem Einsatz von Mehrsprachigkeit sind integraler Bestandteil des mehrsprachigen Diskurses. In den Aufzeichnungen soll ihre Funktion und Wichtigkeit für den Sprachlernprozess aufgezeigt werden.
Mittels der diskursanalytischen Auswertung der mehrsprachigen Aushandlungsprozesse konnten diese sprachlichen Phänomene in ihrer Funktion identifiziert und als Indikatoren für den Erwerb von spezifischen Kompetenzen für den mehrsprachigen Diskurs herangezogen werden. In diesem Sinne können CS, CM und TL als Fenster bezeichnet werden, die Einblick verschaffen in Lernprozesse und Kompetenzzuwachs im Bereich MKK, die sich bei den einzelnen Lernenden über einen längeren Zeitraum durch einen mehrsprachigen aufgabenorientierten Unterricht entwickeln. Dies gibt auch Aufschluss über die veränderte Einstellung einzelner Lernenden zu den verschiedenen Sprachen sowie über ihre Haltungen und Emotionen.
Ein erstes bedeutendes Phänomen ist das Code-switching (CS)1. Darunter versteht man die Verwendung mehrerer Sprachen und Sprachvarietäten im Gespräch zwischen Menschen mit der gleichen Herkunftssprache oder unterschiedlicher Herkunftssprachen und insbesondere den Wechsel von einer Sprache in die andere im Verlauf des Gespräches. Die Forschung hat CS lange Zeit als Sprachvermischung negativ bewertet und als ein Signal unzureichender sprachlicher Kompetenzen aus dem Unterricht ausgeschlossen. Dies geschah in der vermeintlichen Verteidigung eines sprachlichen Reinheitsgebotes, das es um jeden Preis zu erhalten galt. Aus soziolinguistischer Perspektive und aufgrund von Theorien zur sozialen Interaktion wurde jedoch bald klar, dass CS keine Sprachvermischung darstellt, sondern als kommunikative Strategie sowohl bewusst als auch unbewusst eingesetzt wird. Seitdem erfreut sich CS einer langen Forschungstradition (Auer 1998; Milroy & Muyskens 1995; Basnight-Brown & Altarriba 2007; Gardner-Chloros 2009a, 2009b) ,es wurde jedoch weiterhin weitgehend darauf zurückgeführt, dass Sprechende einen Sprachwechsel vornehmen, um einen temporären Wortausfall zu kompensieren. Dieses sog. Code-mixing wird heute als Kompensationsstrategie aufgewertet und kann im mehrsprachigen Unterricht eine - Funktion einnehmen.
Cook untersucht erstmals die pragmatischen Aspekte des CS im Fremdsprachenunterricht (Cook 2001: 39, 1991: 132). Dabei stellt sich heraus, dass CS als strategisches Instrument in der mehrsprachigen Kommunikation dient. Es wird zwischen CS innerhalb des Satzes (intrasententiell), zwischen den Sätzen (extrasententiell) und satzunabhängigem CS unterschieden. Die Positionierung dient unterschiedlichen Bedürfnissen in der Kommunikation. CS kann pragmatischer, metalinguistischer und sprachlicher Natur sein. Pragmatisches CS befähigt die Lernenden, die Konversation zu bearbeiten, die Rolle der Teilnehmer festzulegen oder einen impliziten Adressatenwechsel vorzunehmen zum Zweck der Aushandlung und Aufgabenverteilung oder für einen Themenwechsel. Es kann zudem herangezogen werden, um Informationen hervorzuheben oder um zu signalisieren, dass aus zweiter Hand berichtet wird. Häufig beobachtet werden beim pragmatischen CS Sprachwechsel bei Interjektionen, Heckenausdrücken, kurzen Fragen, Gesprächseröffnung, Abschluss und Unterbrechungen. Metalinguistisches CS hingegen wird eingesetzt für Kommentare (auch in Form von Seitengesprächen), zur Besprechung sprachlicher Aspekte wie Grammatik, Syntax, Phonetik usw. Sie sind die häufigste Form von CS im Klassenzimmer und leiten oft zu einem Seitengespräch über, das sich auf formelle Aspekte bezieht. Oft wechselt die Lehrperson zu L1 der Lernenden, um etwas verständlicher zu machen oder zu erklären, für einen metalinguistischen Einschub oder ganz einfach, um ein Wort zu übersetzen. Sprachliche CS signalisieren einen Hilferuf vonseiten des Sprechenden, der informell und implizit entweder Hilfe anbietet oder um Hilfe bittet. Dazu kommen unbewusste CS, deren Intention dem Beobachter verborgen bleibt. Im letzteren Fall handelt es sich oft um Funktionswörter, die keine besondere Relevanz in der Kommunikation einnehmen (Bono 2011a: 36f., 43). Ungerer-Leitzke erwähnt eine besondere Form des CS, nämlich das informelle Dolmetschen (Ungerer-Leitzke 2008: 254) und meint damit die Praxis von Lernenden, schnell von einer Fremdsprache nach L1 zu übersetzen. Dies kann aus unterschiedlichen Gründen geschehen, meistens jedoch wird übersetzt, um umständliche Erklärungen zu vermeiden und sich durch Übersetzung im Sinne der Sprachökonomie in der gemeinsamen Erstsprache oder der Lingua franca unmittelbar verständlich zu machen. Kognate fallen auch in diesen Bereich, ihre Übersetzung im Aushandlungsprozess ist laut Cummins ein Transferunterricht-Beispiel, um das Prinzip der konzeptionellen Interdependenz von Sprachen aufzuzeigen (Cummins 2009: 319). Besonders eignen sich dafür Sprachen, die genetisch in einem Verwandtschaftsverhältnis zueinander stehen, nicht aber unbedingt zur gleichen Sprachfamilie gehören. Im polyglotten Dialog können bei bestimmten Wortformen (darunter sind Internationalismen und Latinismen besonders hervorzuheben) die Interdependenz zwischen den Sprachen genutzt werden. So können Kognate durch das Instrument der „sieben Siebe“ abgeleitet werden.
Читать дальше