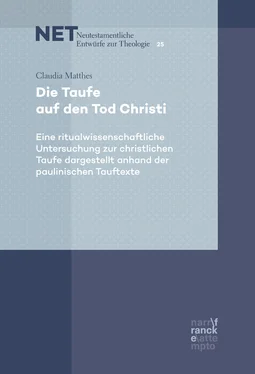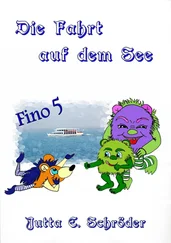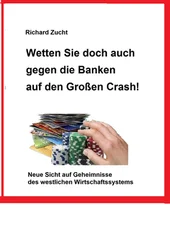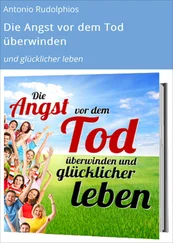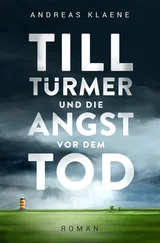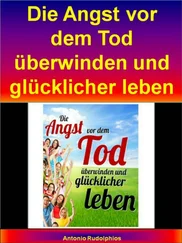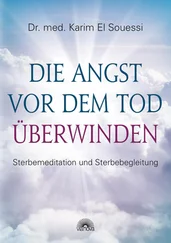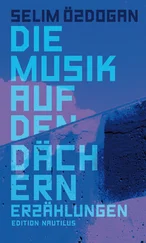1 ...7 8 9 11 12 13 ...40
2.2.2.8 Alternative Beschreibungskategorien
Ähnlich den hier auf die neutestamentliche Taufe und ihrer Quellen abgestimmten Ritualaspekten wählt etwa auch Babcock in seiner Studie zu den Festkalendern1 und Al-Suadi in ihrer Untersuchung zu Mahlgemeinschaften2 Beschreibungskategorien, welche sich von dem jeweiligen Ritual her ableiten. Ganz andere, themenungebundene Vorschläge für Beschreibungsmerkmale finden sich etwa bei Klingbeil, welcher eine Orientierung an linguistischen Kategorien als sinnvoll erachtet,3 oder auch bei Theißen.4
Oben wurde bereits die These Klingbeils dargestellt, die Interpretation eines Ritualtextes gelinge am sichersten über einen Vergleich mit anderen, vorzugsweise schriftlichen Quellen zu Ritualen, welche ersterem entweder in ihrem historischen Kontext oder aber in ihrer Typologie ähneln.2
Wenn auch ein vergleichender Ansatz im Grundsatz vielversprechend erscheint, so sind die von Klingbeil beschriebenen Prämissen dennoch in drei Punkten anzufragen: 1) Wenn ein historical comparison angestrengt werden soll, stellt sich die Frage, wie viele den christlichen Tauftexten vergleichbare Ritualtexte sich überhaupt finden ließen. 2) Mit Blick auf ein typological comparison ist fraglich, wie weit „the common religious conscience of humanity“3 reicht und wie aussagekräftig demnach ein entsprechender Vergleich sein kann, wenn Rituale – wie grundsätzlich bei Klingbeil – als „empty containers“ beschrieben werden. 3) Das Ritualverständnis Klingbeils lässt sich vielleicht vereinfacht auf die Formel bringen „Ritual = Handlungsablauf + dessen Deutung“, und demnach würden lediglich Rituale, welche der Taufe in ihrem Ablauf ähneln, als mögliches Vergleichsmaterial in Frage kommen.
Gegen diese fehlgehenden Prämissen Klingbeils erscheint es mit Blick auf die christliche Taufe in den neutestamentlichen Texten jedoch zunächst sinnvoll, nicht einen einzelnen Tauftext mit einem anderen Ritualtext zu vergleichen, sondern auf der Grundlage mehrerer Texte das Ritual selbst zu einem anderen Ritual ins Verhältnis zu setzen. Sodann ist zu bedenken, dass die neutestamentlichen Tauftexte weder das Wasserritual im Allgemeinen, noch seinen Ablauf im Besonderen, in den Fokus stellen, sondern vielmehr eine bestimmte Funktion oder einen konkreten, anderen Ritualaspekt. Insofern liegen Rituale, welche der Taufe in diesen Punkten gleichen, als mögliche Vergleichsrituale mindestens ebenso nah wie andere Wasserrituale. Hebt beispielsweise ein Text nachdrücklich auf den initiativen Aspekt der Taufe ab, ist nicht zuerst die Johannestaufe als ähnliches Wasserritual, sondern sind andere Initiationsrituale vergleichend heranzuziehen.
3 Aufbau und Fragestellung(en) der Arbeit
3.1 Gegenstand und Ziel der Arbeit
Die Untersuchung versteht sich als eine erste dezidiert ritologische Beschreibung der christlichen Taufe in ihrem Wesen als Ritual. Sie unterscheidet sich daher von den vielfältigen bisherigen neutestamentlichen Arbeiten zur christlichen Taufe sowohl in ihrem methodischen Vorgehen, welches ritualwissenschaftliche Methoden für die biblische Exegese adaptiert, als auch in ihrer Zielsetzung, die christliche Taufe erstmals in der Fülle ihrer neutestamentlich belegten Ritualaspekte zu beschreiben, zu analysieren und zu interpretieren.
Die biblische Textgrundlage bilden dazu die paulinischen Tauftexte, welche als die ältesten Belege zwar bereits den Vollzug der Taufe voraussetzen, allerdings noch in die Entstehungsphase des Rituals zu rechnen sind. Dementsprechend richtet sich das Augenmerk der Untersuchung nicht allein auf Erhebung und Beschreibung der Taufe in der Zeit und in der Theologie des Paulus, sondern ebenso auf die dem vorangehenden und noch anhaltenden Entwicklungstendenzen bezüglich sämtlicher Ritualaspekte.
Der methodischen Einleitung folgen fünf inhaltliche Kapitel, wobei im Verlauf der Arbeit entsprechend der Entwicklung der Fragestellung die Quellenbasis ausgeweitet wird.
Kapitel II „Begrifflichkeiten“ beinhaltet semantische sowie traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu den wesentlichen griechischen Begriffen und Formulierungen, welche im Kontext der Taufe Verwendung finden: βάπτω und βαπτίζω sowie die sog. Tauf- bzw. Namensformel in den Varianten βαπτίζειν εἰς Χριστὸν und βαπτίζειν εἰς τὸ ὄνομα Χριστοῦ.
Kapitel III „Die paulinischen Tauftexte“ untersucht eingehend die ältesten schriftlichen Zeugnisse zur christlichen Taufe und konzentriert sich dazu auf vier Haupttexte, welche in besonderer Weise die Taufe thematisieren bzw. problematisieren: Gal 3,23–29; 1Kor 1,10–17; 1Kor 12,12–20; Röm 6,1–11. Weitere paulinische Tauftexte werden in Exkursen kurz dargestellt.1
Kapitel IV „Die rituelle Umwelt der christlichen Taufe. Ritualvergleiche“ stellt zunächst die vorgängigen und neutestamentlich gegenwärtigen Vorstellungen zum Element Wasser und den damit verbunden Ritualen im jüdisch-christlichen Kontext dar. Sodann werden drei jüdische Rituale ausführlich dargestellt, welche entweder in ihrem Ritualablauf oder aber in ihrer Ritualfunktion und –deutung in einem direkten Verhältnis zur christlichen Taufe stehen: die Johannestaufe, die Beschneidung und das Proselytentauchbad. Die Ergebnispräsentation folgt dabei den oben bereits eingehend vorgestellten2 sieben Ritualaspekten. Schließlich werden vier der bedeutendsten Vertreter der sog. Täufersekten – die Gemeinschaft von Qumran, die Elchasaiten, die Mandäer sowie die Ebioniten – mit einem besonderen Fokus auf die von ihnen verwendeten Rituale untersucht. Auch wenn es sich dabei mehrheitlich um Phänomene handelt, welche nach der Etablierung der christlichen Taufe entstehen, bilden diese in ihrer Fokussierung auf Wasserrituale eine interessante Vergleichsfolie für die christliche Gemeinde, welche die Taufe als Initiationsritual vollzieht. Auf Grund der teilweise sehr beschränkten Quellenlage können die Wasserrituale dieser Gruppierungen lediglich bezüglich ihrer Bezeichnung und Art, Ritualablaufes, Ritualfunktion und –deutung dargestellt und verglichen werden. Sämtliche Unterkapitel laufen sodann auf eine Verhältnisbestimmung zur christlichen Taufe hinaus, einem Ritualvergleich.
Kapitel V „Ritologische (Deutungs)Motive“ thematisiert fünf Metaphern und Deutungen, welche zur Interpretation der Taufe in den paulinischen Texten Verwendung finden und sich zugleich als klassische Motive erweisen, wie sie auch bei anderen, jüdischen wie nichtjüdischen Ritualdeutungen begegnen: „Leben-Tod(-Leben)“; „Freiheit/Befreiung“; „Leib/Einheit“; „Erbe/Sohn“; „Name“.
Kapitel VI „Die christliche Taufe als Ritual. Eine Zusammenfassung“ bündelt die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Untersuchungsschritten in einer umfassenden Beschreibung und Interpretation der christlichen Taufe an Hand der sieben Ritualaspekte.
3.3 Begriffliche Differenzierungen
Die Forschungsliteratur zum Thema Ritual konnte sich bisher nicht auf einen einheitlichen Sprachgebrauch bezüglich bestimmter Fachtermini einigen. Dieses Problem potenziert sich zusätzlich durch die Übertragung englischer Begrifflichkeiten ins Deutsche. Unabhängig von den teilweise vehement geführten Auseinandersetzungen darüber gelten für die Untersuchung folgende begriffliche Differenzierungen:
1) rituell – ritologisch: „Rituell“ bezeichnet Eigenschaften, welche eine Handlung als Ritual kennzeichnen bzw. prägen. „Ritologisch“ hebt auf die ritualtheoretische und demnach methodische Ebene einer Fragestellung ab.
2) Ritual – Ritus: Die gelegentlich anzutreffende Differenzierung zwischen „Ritus“ als kleinster Sinneinheit bzw. Handlungsbestandteil und „Ritual“ als dem Gesamtgeschehen1 bleibt letztlich schwierig, da bspw. dieselbe rituelle Handlung sowohl als eigenständiges „Ritual“ existieren und gleichzeitig als Teil eines größeren rituellen Zusammenhanges und somit „Ritus“ vorkommen kann.2 Zudem trägt eine derartige Unterscheidung nichts zur Beschreibung und Interpretation der in der Arbeit untersuchten Rituale bei. Daher wird im Folgenden durchgehend von Ritual gesprochen und damit jede Art ritueller Handlung bezeichnet.3
Читать дальше