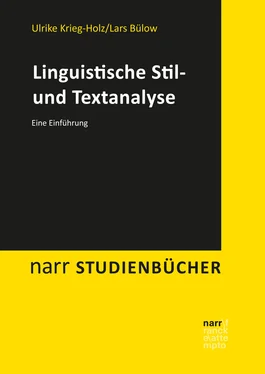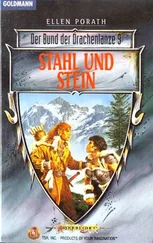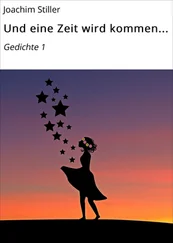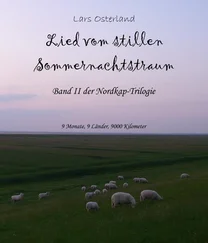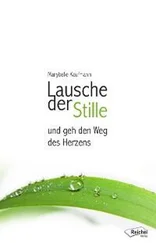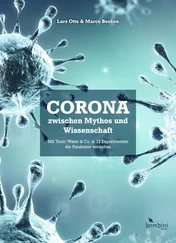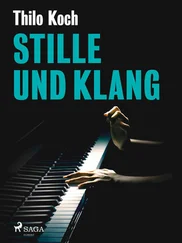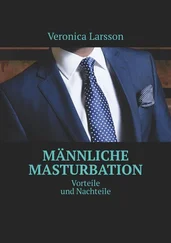1 ...8 9 10 12 13 14 ...19 Die lexikalischen Inhaltswörter bilden ein zusammenhängendes Begriffsystem, das auf Beziehungen zwischen Lexemen und kulturellen Abstraktionen zu diesen beruht. So befindet sich fast jedes Wort im Spannungsfeld einer Klasse von Wörtern, die eine gleiche oder eine ähnliche Bedeutung ausdrücken. Wenn zwei oder mehrere Wörter die gleiche Bedeutung haben und in derselben syntaktischen Umgebung vorkommen können, liegt Synonymievor. Als Beispiele dafür werden häufig Wörter wie Apfelsine – Orange, Fahrstuhl – Lift – Aufzug oder anfangen – beginnen genannt. Eine echte Synonymie (auch: ‚totale Synonymie‘), für die eine uneingeschränkte Austauschbarkeit der betreffenden Ausdrücke in allen denkbaren Kontexten Voraussetzung ist, tritt jedoch äußerst selten auf. Das hängt vor allem mit dem Prinzip der Sprachökonomie zusammen, das das Bestehen zweier absolut bedeutungsgleicher Ausdrücke im Lexikon hemmt.
Sehr oft unterscheiden sich Synonyme durch konnotative Merkmale, d.h. zusätzliche – meist emotional – bewertende Informationen (z.B. Hund vs. Köter , vgl. Kap. 3.2.3), sowie durch weitere stilistische Merkmale wie die Markierung von Stilebenen (z.B. sterben – abkratzen ; vgl. Kap. 3.1 „Zentrale Begriffe der Stilanalyse“), regionale Markierungen (z.B. Sonnabend – Samstag ) u.v.m. In solchen Fällen handelt es sich um die sog. „ partielle Synonymie“, die auch dann vorliegt, wenn Lexeme nur in einigen Kontexten austauschbar sind, jedoch nicht in allen: einen Brief bekommen/erhalten vs. einen Schnupfen bekommen/*erhalten .11 Im Rahmen von Substitutionsprozessen sind kontextabhängig natürlich auch derartige partielle Synonyme dazu geeignet, zu Textverknüpfung und Themavariation bzw. Themaentwicklung beizutragen.
Durch Substitution können auch lexikalische Elemente verknüpfen, wenn diese Bestandteile von sog. „Wortfeldern“ (vgl. Kap. 3.2.3) sind. Wortfelder12 werden von Wörtern gebildet, die auf paradigmatischer Ebene bedeutungsverwandt sind. Solche Wortfelder umfassen alle Wörter, die einen bestimmten begrifflichen oder sachlichen Bereich abdecken. Sie teilen zentrale Bedeutungselemente miteinander, heben sich aber auch durch spezielle Seme13 (evtl. Oppositionsseme) und/oder stilistische Merkmale voneinander ab, z.B.: Insel , Schäre , Eiland , Hallig , Fischerinsel , Urlaubsinsel, Atoll usw.
Rentnermorde sorgen für Angst
Mallorca eine Mafiainsel?
Palma de Mallorca.Nach dem zweiten tödlichen Raubüberfall auf ausländische Rentner binnen weniger Monate wächst auf der FerieninselMallorca die Angst unter den europäischen Residenten. Zum Jahresbeginn war ein 77-jähriger Schweizer Pensionär an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben, die er bei einem brutalen Überfall erlitten hatte. Vieles deutet darauf hin, dass dieselben skrupellosen Täter dahinterstehen, die vier Monate zuvor im Inselosten einen deutschen Rentner überfielen und töteten.
Mallorca werde zunehmend „ein Paradies für die Mafia“ warnte die Zeitung „Diaro de Mallorca“. Die Inselhabe sich in ein „Rückzugsgebiet für das internationale Verbrechen verwandelt“. Die Tourismusbranche sorgt sich, dass derartige Gewaltverbrechen das Image der berühmten Insel beschädigen könnten. Im vergangenen Jahr verbrachten rund neun Millionen ausländische Touristen ihre Ferien auf der spanischen Urlaubsinsel. Zudem leben mehr als 100000 Ausländer fest auf dem Eiland, davon allein 30000 Deutsche […]. (Ostthüringer Zeitung 22.01.2014 [Fettdruck zur Hervorhebung, nicht im Original])
Satzübergreifende lexikalische Beziehungen können auch durch Wortschatzelemente hergestellt werden, die in antonymischer Relation zueinander stehen. Antonymesind Wörter, die durch die semantische Relation des Bedeutungsgegensatzes verbunden sind. Dabei können zwei Formen voneinander unterschieden werden: Die kontradiktorische oder komplementäre Antonymie, die etwa bei zwei Zuständen vorliegt, die sich gegenseitig ausschließen (z.B. lebend – tot ). Um konträre Antonyme handelt es sich demgegenüber bei den Extrempunkten einer Skala, zwischen denen Übergangszustände denkbar sind (z.B. heiß – kalt ).
Als Spezialform antonymischer Relation werden mitunter auch Wörter gefasst (vgl. z.B. Schubert 2008, S. 48f.), die unterschiedliche Perspektiven auf ein Ereignis bezeichnen (sog. „konverse Antonymie“ z.B. kaufen – verkaufen ) oder räumliche Bewegungen in verschiedene Richtungen verbalisieren (sog. „direktionale Antonymie“ z.B. vorwärts – rückwärts ).
Durch Substitution verknüpfen vor allem auch Ausdrücke, bei denen eine Relation der Unter- oder Überordnung vorliegt. Dieses semantische Verhältnis zwischen einem Oberbegriff mit weiter Bedeutung (Hyperonym, z.B. Obst ) und einem Unterbegriff (Hyponym, z.B. Apfel ) wird als Hyponymiebezeichnet. Verschiedene Unterbegriffe, die gemeinsam zu einem Oberbegriff gehören werden Kohyponyme genannt (z.B. Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume ). Dabei unterscheidet sich jedes Hyponym durch mindestens ein spezifizierendes Merkmal von seinem Hyperonym.
Mit solchen Formen inhaltlicher Spezifizierung geht neben der Ausdrucksvariation natürlich immer die Weiterentwicklung des Themas einher, etwa durch ein Fortschreiten vom Speziellen zum Allgemeinen. Als besonders allgemeine Hyperonyme gelten in diesem Zusammenhang Lexeme wie Person , Mensch, Ding , Zeug , die innerhalb von Texten kohäsive Verbindungen mit unzähligen anderen Personen- und Sachbezeichnungen eingehen können.
Auf Teil-Ganzes-Beziehungen bezieht sich der Begriff der Meronymie, wobei das Lexem, das das Ganze benennt, als ‚Holonym‘ (z.B. Baum ), das Wort für den entsprechenden Teil als ‚Meronym‘ (z.B. Ast, Stamm ) bezeichnet wird. Meronymische Relationen bestehen typischerweise zwischen Wörtern mit gegenständlicher Bedeutung (sog. ‚Konkreta‘). Sie begegnen in Texten häufig bei Raumbeschreibungen und in Verbindung mit bestimmten Formen der thematischen Progression (s.u. „Progression mit abgeleitetem Thema“).
Weiterführende Literatur:
Cruse, Alan D.: Lexical Semantics. Cambridge UP, Cambridge 1986.
Halliday, Michael A.K. /Hasan, Ruqaiya: Cohesion in English. Longman, London 1976.
Lyons, John: Semantics. Cambridge UP, Cambridge 1977.
Fritz, Thomas: Der Text. In: Duden. Band 4 Die Grammatik. Dudenverlag, Mannheim 2006. S. 1067–1174.
Schubert, Christoph: Englische Textlinguistik. Eine Einführung. Erich Schmidt, Berlin 2008.
Textkonstitution durch Kontext und Weltwissen: Kohärenz
Thematische Progression
Die Verbindung zwischen Kohäsion und Kohärenz verdeutlicht insbesondere die Beschreibung der Thema-Rhema-Gliederung.1 Im Zuge der Thema-Rhema-Gliederung eines Textes werden die Satz-für-Satz-Beziehungen nicht, wie bei den oben genannten Formen der Wiederaufnahme, nur in der Markierung der Ausdrücke, die direkten Bezug aufeinander nehmen, gesehen, sondern „darin, in welcher Weise das Darunterliegende erfasst wird, wie also Sätze mit ihren deiktischen Ausdrücken und nun vor allem mit ihren Prädikaten direkt aufeinander bezogen sind“ (Eroms 2008, S. 45).
Das Modell der Thema-Rhema-Gliederung basiert auf dem Ansatz der Funktionalen Satzperspektive, der im Kontext der Prager Schule entstand (Mathesius 1929). Für die Textanalyse unterscheidet Daneš (vgl. 1970, S. 72ff.) zwischen Thema und Rhema, wobei unter ‚ Thema‘ das verstanden wird, worüber etwas mitgeteilt wird. Dabei handelt es sich unter kontextuellem Aspekt um die Information, die bekannt, vorgegeben, aufgrund der Situation erschließbar oder vom Rezipienten aufgrund seines Vorwissens bzw. seiner Weltkenntnis erkennbar ist. Als ‚ Rhema‘ wird das bezeichnet, was über das Thema mitgeteilt wird. Das Rhema besteht also in der neuen, nicht vorher erwähnten und nicht aus dem Text- bzw. Situationszusammenhang ableitbaren Information.
Читать дальше