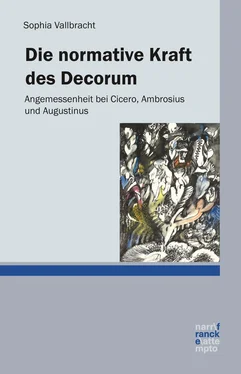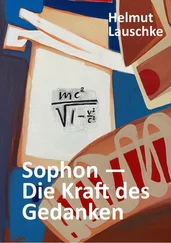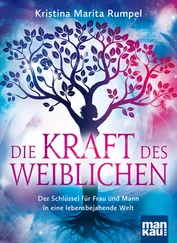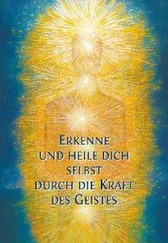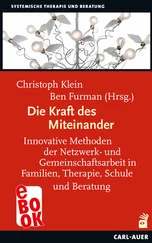Lotte Labowsky ist in ihrer Dissertation aus dem Jahre 1934 der Meinung, Horaz habe seine Ars Poetica in zwei Teile eingeteilt: Vers 1 bis 284 behandelten das ästhetische decorum , während der zweite Teil, der erst in Vers 309 beginnt und sich bis Vers 476 erstreckt, das ethische decorum zum Thema habe.6 Zu Recht weist Labowsky an dieser Stelle außerdem auf die Beziehung zwischen beiden Arten des decorum hin, da auch Horaz das decorum als einen Anspruch an die Perfektionierung von Dichtung per se formuliert, der sowohl ethisch auf den Künstler, Poeten und Redner als Mensch, als auch ästhetisch auf das Kunstwerk, die Dichtung und Rede zielt. Die Mühe und zeitraubende Arbeit des rhetorischen Feilens an der eigenen Dichtung („limae labor et mora“ V. 291), d.h. die poetisch verfeinerte elocutio , verleihe dem Dichter sodann Macht, Ruhm und Ehre. Das zuvor Gedichtete detailliert rhetorisch zu überprüfen, ist für Horaz gleichbedeutend mit der Beachtung des decorum . Die Einheitlichkeit, Stimmigkeit und Einheit eines künstlerischen Werkes wird durch das ästhetische und ethische decorum als dichterisches Telos nach Horaz gewährleistet. Mithilfe des Prinzips der Angemessenheit wird die künstlerische Zusammengehörigkeit einzelner poetischer Teile und rhetorischer Aspekte innerhalb einer Dichtung trotz aller Freiheit in der Kunst garantiert (V. 1-25). Innerhalb der Poetik des Horaz findet sich das rhetorische decorum im Rahmen einer dramatischen Inszenierung von Sprache auch als ethische Kategorie wieder, welche die stilistischen und die ethischen Implikationen einer Dichtung innerhalb einer rhetorischen Situation thematisiert.7
Aristoteles (ethische Tugenden, eth.Nic. X, 8, 1178a10-13), Cicero, Quintilian und Horaz sind sich in der Notwendigkeit des decorum vitae innerhalb der Rhetorik einig und werden auch in den poetologischen Bestrebungen des 17. Jahrhunderts um deutsche „Wohlredenheit“ und Dichtung anerkannt. Dyck spricht in seiner Ticht-Kunst davon, dass „[d]ie Decorum-Lehre, die in der vorbildgebenden antiken Rhetorik und Poetik solchermaßen verankert ist, [...] in die rhetorischen und poetischen Traktate des 17. Jahrhunderts übernommen [wird] und [...] eine zentrale Stellung innerhalb der Stilvorschriften [gewinnt], die der „barocke Klassizismus“ für sich als maßgebend erachtet.“8 Hierbei sind laut Sinemus am Beispiel des Werkes De Poesi graecorum libri octo von Abidas Praetorius jedoch zwei verschiedene Dichtungslehren zu unterscheiden: diejenige des decorum materiae und diejenige des decorum verborum . Er verdeutlicht, inwiefern sich das Wesen der Angemessenheit in deutschen Poetiken ausprägt und stellt fest: „[D]er poetologische Maßstab der Angemessenheit ist keine Subkategorie der Elocutio – Lehre, [...] sondern er umfasst auch die Themen- und Gattungswahl, im rhetorischen Produktionsmodell: die inventio und dispositio.“9
An dieser Stelle ist besonders Martin Opitz zu nennen, der 1624 eine Theorie des decorum in seinem Buch von der Deutschen Poeterey als eine Art von „Zierlichkeit“10 formuliert. Opitz’ Anliegen war es, Regeln und Grundzüge einer deutschen Dichtkunst des Barock zu formulieren, die aufgrund ihrer Nationalsprache auch ein anderes Vermaß als das antike verfolge, – nun nämlich den Alexandriner als Regelvers –, welcher der deutschen Sprache angemessener sei ( Buch von der Deutschen Poeterey , VII. Kapitel). Besonders im VI. Kapitel kommt Opitz auf die „Zierlichkeit“ zu sprechen, die zunächst gemeinsam mit der Eleganz, dann der Komposition oder Zusammensetzung von Worten und schließlich mit der Dignität und dem Ansehen (inneres aptum einer Rede) von Worten je einen Aspekt der Rede darstellen. „Zierlichkeit“ scheint hier (VI. Kapitel, S. 24) noch auf den ornatus im Rahmen der elegantia beschränkt und von der ethischen Kategorie des aptum und dem ihm übergeordneten decorum im Ansehen und der Dignität von Worten getrennt zu sein.11 Opitz versteht unter „Zierlichkeit“ primär reine und deutliche Worte, worunter er zum einen das Hochdeutsche ohne Verwendung von Fremdwörtern fasst, und wenn dies nicht vermeidbar ist, wie bei den nomina propria , den Eigennamen, so sind doch zumindest fremdländische Namen mit deutschen Endungen zu versehen (VI, S. 25) und in eine deutsche Schreibweise zu übersetzen (VI, S. 27). In diesen Rahmen des rhetorischen ornatus sind auch seine Ausführungen zum schicklichen Klang einzuordnen, der ein genaues Studium von Buchstaben und deren Klangfolge erfordert: „Weil ein buchstabe einen andern klang von sich giebet als der andere/soll man sehen/das man diese zum offteren gebrauche/die sich zue der sache welche wir für uns haben am besten schicken.“12 Empfohlen wird eine gute Zusammensetzung von Buchstaben in einem Wort und Satz, die das inhaltlich Gesagte auch phonetisch unterstreichen und so diesem sinnlich angemessen13 sind (Onomatopöie): So sind beispielsweise Fließlaute (Liquide) in der Beschreibung von Bächen angemessen und nützlich (VI, S. 29), während bezüglich des Pleonasmus trotz seiner affektstarken rhetorischen Funktion der Hinzufügung und der „Anastrophe“ (Inversion) dem Dichter geraten wird (VI, S. 28), davon Abstand zu nehmen, da sie den Vers „gezwungen“ machen und die Syntax in der Rede „verstellen“. Ebenso sind Epitheta dem Poeten nicht anzuraten, und besondere Betonung wird auf die korrekte deutsche Rechtschreibung und den Satzbau (VI, S. 26) insgesamt gelegt. Doch häufig ist den Regeln des poetischen Gestaltens durch eine beispielhafte Auflistung ex negativo auf die Spur zu kommen: „Newe wörter/[...] zue erdencken/ist Poeten nicht allein erlaubet“ (VI, S. 26); „Ich darff aber darumb nicht bald auß dem Französischen sagen: approchiren“ (VI, S. 27); „Item/Es siehet nicht wol auß/wenn ein Verß in lauter eynsylbigen wörtern bestehet.“ (VI, S. 29)
Nach dem Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft stellt sich Opitz’ Lehre des decorum und aptum als eine Regel der Poetik, als ideales Verhältnis von „Stilhöhe, dichterischer Gattung und dem sozialen Rang der in der Dichtung vorkommenden Personen, Gegenstände und Situationen“14 dar. Es ist ein harmonisches Abwägen von gestalterischen Figuren in Wort und Satz seitens des Dichters, der die „Zierlichkeit“ im ornatus und das Prinzip des decorum materiae und decorum verborum achte. Opitz verfolge laut Sinemus damit als erster eine „material-soziale Aptum-Lehre“15. Damit verbunden sei auch die Unterscheidung der ciceronischen Dreistillehre gemäß dem hierarchisch-ständischen Regelsystem. Es sei der Habitus, der den Stil einer Rede entscheide: „Denn wie ein anderer habit einem könige/ein anderer einer priuatperson gebühret/und ein kriegesman so/ein Bawer anders/ein kauffmann wieder anders hergehen soll: so muß man auch nicht von allen dingen auff einerley weise reden; sondern zue niedrigen sachen schlechte/zue hohen ansehliche, zue mittelmässigen auch mässige und weder zue grosse noch zue gemeine worte brauchen.“16 Angemessenheit ist in opitzscher Denkweise also Harmonie zwischen Stil und Stand beziehungsweise Habitus. Dementsprechend stehen die verba im Dienst der Sache: Wichtige Angelegenheiten müssen mit „prächtig[en] hohen worten vmbschreiben“ werden, „[d]ie mittele oder gleiche art zue reden ist/welche zwar mit ihrer ziehr uber die niedrige steiget/und dennoch zue der hohen an pracht und grossen worten noch nicht gelanget.“17
Drux schreibt zusammenfassend in seiner Dissertation (1976) über die Angemessenheit als „Kardinaltugend der Stillehre aus der klassischen römischen Rhetorik“ (S. 29), dass Opitz den Begriff der Zierlichkeit als Synonym für decorum verwendet und nicht das Prinzip der elegantia , „sondern [der] ‚dignitas‘ oder – materieller – ‚ornatus‘“ (S. 31) verfolgt. Die natürliche Ordnung der ständischen Gesellschaft zu wahren, ist gemäß Opitz somit auch Aufgabe der Dichter in ihren Poetiken des 17. Jahrhunderts; Sie sollen das decorum auch als sozial-ethische Kategorie in der Theorie der Poetik etablieren.18
Читать дальше