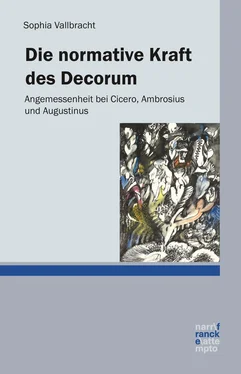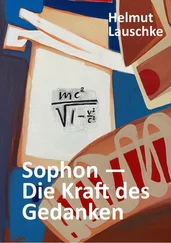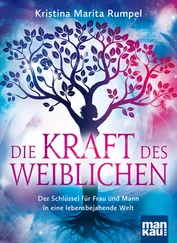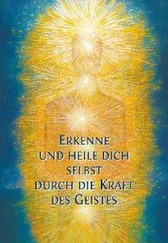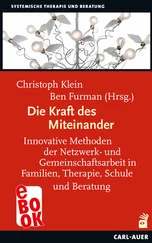1 ...6 7 8 10 11 12 ...21 Anders als Horaz und Opitz vor ihm klassifiziert Christian Thomasius, der Frühaufklärer, Begründer einer Monatsschrift (die Monatsgespräche , 1688/1689) und Verfechter der deutschen Sprache an der Universität, das decorum nicht als eine ethische Kategorie innerhalb eines theoretischen Rahmens von Rhetorik oder Poetik, sondern als eine von drei normativen Richtschnüren menschlichen Handelns. Als Philosophiestudent und schließlich promovierter Jurist interessiert sich Thomasius für das decorum im Rahmen seiner Naturrechtslehre als eine der drei Säulen menschlich-rechten Tuns. Justum (Recht der Natur), honestum (Ethik) und decorum (Politik) bilden eine verlässliche Trias von praktischer Lebensklugheit, Ethik und Recht. Thomasius setzte sich schon vor Kant für die Trennung von Moral und Recht19 ein, kämpfte gegen Vorurteile jeglicher Art und verpflichtete den Menschen auf seine Verantwortung, da der Mensch die Vernunft als Richtschnur und Fähigkeit der Überprüfung und damit der Selbsterkenntnis besitzt.
Auf diesem Hintergrund versteht Thomasius das Naturrecht als ein auf justum , honestum und decorum basierendes Modell, das sowohl den äußeren ( justum und decorum ) wie auch den inneren Frieden ( honestum ) fördert und bewahrt. Mithilfe dieser drei Arten von Gütern, die als Einheit20 zusammenwirken sollen, soll zur Regulierung der gesellschaftlichen Ordnung ein rechtliches, ständisch-soziales und ethisches Grundmodell geschaffen werden.21 Anhand der jeweiligen Prinzipien für die „drei Ideologie-Sterne eines Bürgertums“22 ( justum , decorum , honestum ) wird deutlich, dass diese gesellschaftliche Ordnung durch eine ausbalancierte Gegenseitigkeit, Rücksichtnahme und Vorbildlichkeit, nicht durch die alleinige Macht des Rechtes erreicht werden kann: In § 40 wird das Prinzip des Ehrlichen als dasjenige bestimmt, „[W]as du wilt/daß andere sich thun sollen/das thue du dir selbsten“; in § 41 das decorum als das Anständige, „was du wilt/daß andere dir thun sollen/das thue du ihnen“ und in § 42 wird das Gerechte als dasjenige definiert, „was du dir nicht wilt gethan wissen/das thue du andern auch nicht.“
Die Regeln des Gerechten halten dabei das höchste Übel (wie beispielsweise Taten, die in Krieg und Hass münden), die Regeln des Anständigen das mittlere Übel (fehlende Liebe, die noch nicht in äußersten Hass umgeschlagen ist) und die Regeln des Ehrlichen das unterste Übel (innerer Trieb) im Zaun.23 Während bei den erst genannten notwendigen Regeln die Ursachen dafür – wie Krieg, Hass und fehlende Liebe – klar zu Tage treten, bleibt Thomasius’ Ausführung zu dem untersten Übel unklar. Offensichtlich steht der innere Trieb des Menschen der Regel des Ehrlichen im Weg und muss deshalb zum Nutzen der Gemeinschaft gebändigt werden. Der Mensch verzichtet aus Furcht vor Sanktionen auf die Befriedigung seines inneren Triebes. Soziale Kontrolle verhindert also das Ausleben zerstörerischer Triebe.
Da alle drei Güter wichtige praecepta sind, aber einen unterschiedlichen Rang im Zusammenleben einnehmen, empfiehlt Thomasius in § 78 des ersten Buches seiner Grundlehren des Natur- und Völkerrechts das graduelle Lernen von der leichten zur schwersten Regel, sodass zuerst die Regeln des justum , dann diejenigen des decorum und schließlich des honestum zu erlernen sind.
Zwar geben Thomasius’ Schriften Anreize für weitere Untersuchungen beispielsweise der Pedanterie24 des Zeitalters oder der bürgerlichen Klugheit25, doch müssen diese Aspekte seines Schaffens außen vor gelassen werden, um den Fokus auf seine Theorie von decorum in seinen Werken zu konzentrieren, die sich in der vierten Abhandlung in seinen Kleine[n] Teutsche[n] Schriften (1701), der Einleitung zur Sittenlehre (1692), der Ausübung der Sittenlehre (1696), den Fundamenta Juris Naturae et gentium ( Grundlehren des Natur- und Völkerrechts ) (1705), sowie den Cautelae circa praecognita jurisprudentiae (1710) findet. Dabei sollen folgende Fragen als Orientierung dienen: Wie definiert Thomasius decorum ? Und lässt sich in dieser Zeit der Frühaufklärung von einer Rehabilitierung von Angemessenheit sprechen?
Till weist auf die Tatsache hin, dass Christian Thomasius zwar die „Rhetorik der Figuren“, die in den Schulen gelehrt wird, kritisiert und selbst ein Collegium Styli (deutsche Stilübung) anbietet, aber selbst kein Rhetorik-Lehrwerk hinterlassen hat.26 Und dennoch bieten seine oben genannten Werke genügend interessante Reflexionen über die Beredsamkeit und den Stellenwert des decorum im Besonderen. Im 13. Kapitel von De disciplina decori seines Traktats Christian Thomasius eröffnet der studirenden Jugend einen Vorschlag/wie er einen jungen Menschen/der sich ernstlich fürgeseßt/Gott und der Welt dermahleins in vita civili rechtschaffen zu dienen/und als ein honnet und galant’ homme zu leben/binnen dreyer Jahre Frist in der Philosophie und singulis jurisprudentiae partibus zu informiren gesonnen sey aus dem Jahre 1689 prangert er den Mangel an wissenschaftlicher Forschung („in formam disciplinae vel artis“) bezüglich des decorum an und kritisiert Lambertus Velthuysens Unterscheidung von justum und decorum als fehlerhaft. Die bisherige „Erudition“, d.h. Gelehrsamkeit als solides Wissen und Erziehung („solida eruditio“), lasse in Bezug auf die Erkenntnisse des decorum zu wünschen übrig, was er der „Galanterie“ des Französischen zuschreibt. Er bietet jedoch an dieser Stelle keine deutsche Übersetzung an. Opitz’ Übersetzung von decorum als „Zierlichkeit“ scheint für Thomasius aufgrund der verdächtigen linguistischen Nähe zu ornatus nicht zutreffend zu sein, so dass er später in der Einleitung zur Sittenlehre II, 104 den Begriff der „Wohlanständigkeit“, „Manierlichkeit, Höfflichkeit“ und „Artigkeit der Sitten“ gebraucht.
Die Lehre des decorum wird jeweils zu Beginn des 13. und des 14. Kapitels seines Traktats an die studierende Jugend als ein Teil der philosophia practica bezeichnet. Eine detaillierte Einordnung des decorum in das System der Rhetorik folgt nicht.27 Das Desiderat wird jedoch formuliert: Es solle ein wahrhaftes Konzept de Decoro und in Abhängigkeit von demselben auch ein Konzept de Pudore (Kapitel 13, S. 34) erarbeitet werden. Insgesamt werden 24 verschiedene Aspekte des decorum als mögliche Forschungsfelder angeführt, die von den zuerst genannten de fundamento decori , dem Unterscheid zwischen decorum und justum / decorum und utili und dem Decorum pro bono vero & apparente über die verschiedenen Arten des decorum , von pudor als Verletzung des decorum bis hin zu den zuletzt genannten Themen des decorum im Reden und im Handeln reichen. Anhand dieser hierarchischen Reihenfolge, die das decorum im Reden weit hinten platziert, wird seine Einordnung des decorum in die philosophia practica als einer lebenswichtigen Norm im höflichen Umgang der ständischen Sozietät und nicht als eine bloß rhetorisch-ästhetische Lehre des Stiles untermauert.28
Thomasius’ generelle Rhetorik-Kritik, in die später auch Friedrich Andreas Hallbauer (1725)29 einstimmen sollte, hat den Zweck, eine vortreffliche „Oratorie“ auf den Weg zu bringen, die erst nach dem Studium der Philosophie, der Grammatik und der Poesie in den Schulen gelehrt werden soll.30 Thomasius schreibt: „Ehe ich weiter gehe/sehe ich wohl zuvor/daß ihrer viele mir für einen defect zweiffels ohne anrechnen werden/wenn ich die Oratorie, ehe ich ad Philosophiam practicam schreite/so vorbey passiren solte. Aber ich bin der beständigen Meynung/daß man besser thue/wenn man diese Disciplin etwas weiter hinaus sparet.“31 Denn er will weg von der pedantischen Schulrhetorik, hin zu einer Rhetorik, die sich auf den Orator als selbst denkenden Menschen mit Verstand und freiem Willen32 fokussiert. Der Akzent verschiebt sich auf den sprechenden Menschen und seine Affekte.33
Читать дальше