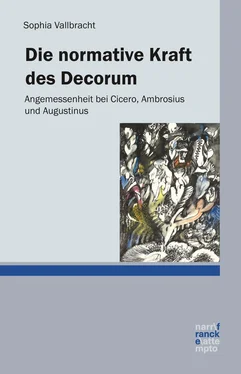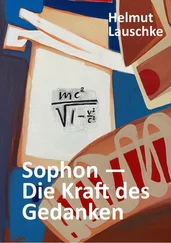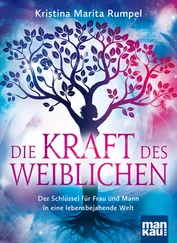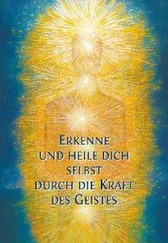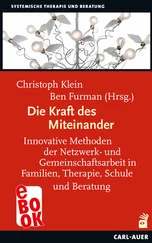Zweierlei Genien sind’s, die durch das Leben dich leiten,
Wohl dir, wenn sie vereint helfend zur Seite dir gehen!
Mit erheiterndem Spiel verkürzt dir der eine die Reise,
Leichter an seinem Arm werden dir Schicksal und Pflicht.21
Seine Konzeption vom Gefühl des Schönen und des Erhabenen entfaltet Schiller in zwei Aufsätzen, in Vom Erhabenen (1793) und ergänzend Über das Erhabene (1794). Während das Gefühl des Schönen ein Ausdruck der Freiheit innerhalb der Natur bedeutet, ist das Gefühl für das Erhabene Ausdruck von Freiheit außerhalb der Natur des Menschen. In der Schönheit passen Sinnlichkeit und Vernunft zusammen, im Erhabenen hat die Sinnlichkeit keinen Einfluss auf die Vernunft. Der Geist ist frei. Dieses Gefühl des Erhabenen ist ein doppeltes, denn es ist aus zwei entgegengesetzten Empfindungen, dem „Wehsein“, das sich als ein Schauer zeigt, und dem „Frohsein“ als positives Gefühl bis hin zum Entzücken, zusammengesetzt. Diese Bandbreite an möglichen Empfindungsextremen im Gefühl22 des Erhabenen zeigt, dass es die Haltung des Menschen zu einem Objekt ist, die entscheidend ist, dass zwei Naturen dem Menschen innewohnen, und beweist nach Schiller auch die „moralische Selbstständigkeit“23. In Vom Erhabenen sprach Schiller noch von zwei Grundtrieben, dem Selbsterhaltungstrieb (Gefühle) und dem Vorstellungstrieb (Erkenntnis) im Menschen als Sinnenwesen. An dieser Stelle führt Schiller aus, inwiefern sich der Mensch von der Natur unabhängig machen kann und er führt terminologisch die beiden Arten des Erhabenen ein: diejenige des „Theoretisch-Erhabenen“ (in Kantischer Diktion dem Mathematischerhabenen entsprechend) und die des „Praktisch-Erhabenen“ (dem Dynamischerhabenen entsprechend). Während das Theoretischerhabene die Natur als Gegenstand nutzt, um des Menschen Erkenntnis im Widerspruch zum Vorstellungstrieb zu erweitern, ist das Praktischerhabene als eine Macht in Opposition zum Erhaltungstrieb (beispielsweise in einer existenziellen Gefahr für den Menschen) zu begreifen, die den Zustand des Menschen selbst beeinflusst. Resümierend fasst Schiller das Erhabene als dreifach zu klassifizierende Macht: als objektive physische Macht, als subjektive physische Ohnmacht und als subjektive moralische Übermacht.24
Der menschliche Geist richtet sich nicht zwangsläufig nach den Sinneserscheinungen oder den Gesetzen der Natur und gibt sich somit der physischen Macht geschlagen, sondern nach dem „selbstständige[n] Prinzipium in uns“25, welches „das absolut Große in ihm selbst erblickt.“26 Das Erhabene, das sich „um den reinen Dämon in ihm [Menschen]“ verdient macht, ist als moralische Übermacht der Weg zur Würde des Menschen: „Ohne das Erhabene würde uns die Schönheit unsrer Würde vergessen machen.“27 Für Schiller ist die Kunst – worunter er in erster Linie die Dichtung und das Drama versteht – eine Quelle der Veredelung des inneren Menschen. In der tragischen Kunst wird mithilfe des Mitleids und der Rührung beim Anblick einer Tragödie der Zuschauer in die Lage versetzt, sein Ich zu verlassen und zum dargestellten Andern zu werden.28 Die Bühne hat bei Schiller das Verdienst, eine Stiftung für den Menschen zu sein:
Jeder Einzelne genießt die Entzückungen aller, die verstärkt und verschönert aus hundert Augen auf ihn zurück fallen, und seine Brust gibt jetzt nur Einer Empfindung Raum – es ist diese: ein Mensch zu sein. 29
Für Schiller ist also die Ästhetik als schöne Kunst das Mittel der Veredelung des Menschen, und der moralisch gebildete Mensch ist frei.
Auch für Arthur Schopenhauer ist die Kunst eine Wirkkraft, die er der Wissenschaft gegenüberstellt: Kunst ist der Wissenschaft überlegen, weil sie ihr Ziel nicht sucht; sie hat es immer schon gefunden. Kunst ist zum einen der wirkende Genius, sie ist zum anderen vollkommene Objektivität, reine Kontemplation30, die Schopenhauer auch Geistesruhe31 nennt. Kunst hat ferner die Fähigkeit, die Erkenntnis der ewigen Ideen (Platons) (III, § 31 und 34) zu vermitteln: „Sie wiederholt die durch reine Kontemplation aufgefaßten ewigen Ideen, das Wesentliche und Bleibende aller Erscheinungen der Welt [...]. Ihr einziger Ursprung ist die Erkenntniß der Ideen; ihr einziges Ziel Mittheilung dieser Erkenntniß.“32 Das Objekt der Kunst ist also immer die Idee, sie ist kein Abbild einer wie auch immer gearteten Wirklichkeit. Die Kunst macht die Ideen aber mittels der Phantasie des Genius anschaulich, wobei die Phantasie „Begleiterin, ja Bedingung der Genialität“ (III, § 36, S. 254) ist. Auch gewöhnliche Menschen haben Phantasie, sind deswegen aber nicht automatisch genial. Andererseits hat nach Schopenhauer aber jeder Mensch die Fähigkeit, das Schöne zu empfinden und zu schätzen, denn jeder ist für das Schöne und das Erhabene empfänglich, allerdings in unterschiedlichem Grad ( Die Welt als Wille und Vorstellung III, § 37, S. 263). So nötigt allein die Betrachtung der Natur dem Menschen „ästhetisches Wohlgefallen“ ab und verwandelt ihn, denn wenn das Schöne auf ihn wirkt, wird er zum „willensfreien Subjekt des Erkennens“ erhoben.33
Dieser Prozess des sich Erhebens über die eigene Individualität kennt aber noch eine Steigerung: Das Schöne wird dann zum Erhabenen, wenn die Betrachtung der Gegenstände einen Widerwillen auslöst (wie bei Kant), wenn er sich der unermesslichen Größe der Gegenstände gegenüber als ein Nichts empfindet, er in seinem Körper einen Widerstand nicht nur bemerkt, sondern diesen Widerstand überwindet, indem er sich gewaltsam von seinem Willen losreißt (III, § 39, S. 272), sodass er sich an diesen Willen nicht einmal mehr erinnert: „[B]ei dem Erhabenen ist jener Zustand des reinen Erkennens allererst gewonnen durch ein bewusstes und gewaltsames Losreißen von den als ungünstig erkannten Beziehungen desselben Objekts zum Willen“34.
Was versteht Schopenhauer aber unter dem Willen, dem er die Vorstellung gegenüberstellt? „Die Welt ist meine Vorstellung:“ Mit diesen apodiktischen Satz beginnt sein Werk Die Welt als Wille und Vorstellung . Die Welt ist, kurz gesagt, Objekt für das Subjekt (I, § 1, S. 31), also seine Vorstellung, alles was mit den Sinnen und dem Verstand (I, § 4, S. 41) wahrgenommen wird (für Kant „Erscheinung“). Sie ist aber auch Wille. Dieser gibt ihm den „Schlüssel zu seiner eigenen Erscheinung“ (II, § 18, S. 151): „[D]er Wille ist die Erkenntniß a priori des Leibes, und der Leib die Erkenntniß a posteriori des Willens.“ (II, § 18, S. 152) Schopenhauers Begriff vom Willen ist weit gefasst und er meint nicht nur den Willen eines Menschen, sondern er spricht auch Tieren und Pflanzen einen Willen zu, indem er den Willen als „jede willkürliche Bewegung ( functiones animales )“ und „Erscheinung eines Willensaktes“ und als „Wille zum Leben“ (II, § 20, S. 160-161 und § 27, S. 199 und 208) definiert. Für Schopenhauer ist der Wille der Wille zum Leben generell, er ist das beherrschende Lebensprinzip, die grundlos wirkende Kraft, ein dunkler zielloser Drang, der in allem Lebendigen wirkt (II, § 27, S. 199 und S. 208/211/213 und § 28, S. 220). Wille und Vorstellung stehen einander gegenüber, aber der Wille ist mächtiger, er beherrscht die Vernunft, nicht umgekehrt. Der Wille ist im Menschen ein ständiges Wollen, das nach Schopenhauer einem Mangel entspringt.35 Da jede Erfüllung nur von kurzer Dauer ist, jagen wir rast- und ruhelos den Objekten des Wollens nach. Ruhe findet der Mensch nur, wenn er den Willen verneint. Für die Willensverneinung gibt es zwei Möglichkeiten, die Askese (IV, § 66, S. 479), die von vielen Religionen praktiziert wird, oder eben die Kunst.
In der Kunst vergisst der Mensch seine Individualität, um sich „als rein erkennendes Subjekt, klares Weltauge“36 der Erkenntnis zu öffnen. Die Kunst antizipiert das Ideal oder die Idee des Schönen, wobei die Möglichkeit der „Anticipation des Schönen a priori im Künstler“, seine „Anerkennung a posteriori im Kenner“ liegt.37
Читать дальше