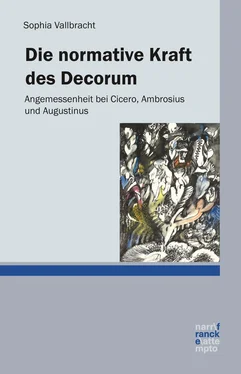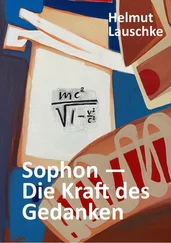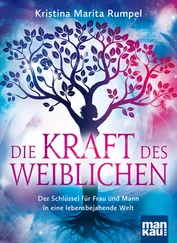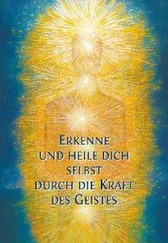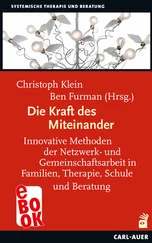Wenn das Erhabene nach Kant eine Idee der Vernunft ist und im Menschen als ästhetisches Urteil und Gefühl wirkt, wie lässt es sich dann angemessen darstellen? Foessel merkt an, dass die reflektierende Urteilskraft die Vorstellung des Erhabenen in erster Linie auf das Subjekt zurückführt, nicht auf das Objekt, und dass es sich somit einer objektiven Darstellung entziehe.10
Ist das Erhabene somit eine nicht darstellbare Figur der menschlichen Einbildungskraft und Vernunft? Kant gibt auf diese Fragen in seinen mannigfaltigen Definitionen des Erhabenen (KdU B, 77/B, 94/B, 118) Antwort. Zunächst entzieht sich das Erhabene dem Angemessenen aufgrund der Unangemessenheit der ästhetischen „Größenschätzung“ (KdU B, 94). In seiner Kritik der Urteilskraft B, 77 definiert Kant das Erhabene als ein „übersinnliche[s] Substrat der Erscheinungen“ (KdU B, 238), als transzendentalen Vernunftbegriff. Solche Ideen sind nicht angemessen darzustellen, da sie nicht objektiv vorliegen, sondern als Vernunftbegriff „indemonstrabel“ (KdU B, 241) sind. Doch gerade diese Unangemessenheit kann sinnlich erfasst werden, beispielsweise über Naturphänomene, durch deren Anblick im Betrachter Ideen von Erhabenheit entstehen, die eine erhabene Denkungsart im Menschen auslösen. Aufgrund dieser Rückwirkung des Erhabenen auf die jeweils individuellen Empfindungen des Menschen spricht Dietmar Till in seiner Studie über das Erhabene (2006), ausgehend vom begrifflichen Konzept des Selbstgefühls, von einem „reflexive[n] Moment des ‚Erhabenen‘“ und einem „Ich-Bezug“ bei Kant.11 Wenn nach Kant das Erhabene übersinnlich ist und sich als Idee im Gemüte formt, so muss der Mensch mehr als nur eine tobende See anschauen, um Erhabenheit zu erleben. Der Mensch selbst wird Teil dessen, indem er durch die Anschauung von erhabenen Naturphänomenen in seinem Innern aktiviert wird: Er wird von den erhabenen Phänomenen ergriffen, jedoch nicht zwangsläufig überwältigt im eigentlichen Sinne. Befindet sich ein Mensch beispielsweise am Strand eines tobenden Meeres, das, von Orkanwinden aufgepeitscht, sich bedrohlich dem Land zuwendet, wird er zwar die reale Bedrohung für sein Leben spüren und sich fürchten, aber zugleich eine Idee von Unendlichkeit und von Unangemessenheit seines Denkens verspüren.12
Deshalb betont Kant in KdU B, 119, dass „in der transzendentalen Ästhetik der Urteilskraft lediglich von reinen ästhetischen Urteilen die Rede sein müsse, folglich die Beispiele nicht von solchen schönen oder erhabenen Gegenständen der Natur hergenommen werden dürfen, die den Begriff von einem Zwecke voraussetzen;“ das Erhabene als ein ästhetisches Urteil wird durch die Unangemessenheit der Einbildungskraft als eine Idee der Vernunft reflexiv gebildet.
Eine zweite Antwort könnte lauten, dass das Erhabene die einzige Ausnahme ist, die das Postulat von Angemessenheit erlaubt. Für Kant ist das Erhabene letztlich die Unmöglichkeit einer objektiven und positiven Repräsentation. Nach § 23 (B, 75/76) ist das Erhabene an einem formlosen Gegenstande zu finden, der in seiner Unbegrenztheit und in Totalität gedacht wird. Kein Maß kann es fassen, ist es doch in der Kategorie der Quantität als Größe, Macht, Chaos gedacht und so sich selbst Maß. Die menschliche Einbildungskraft scheitert an dieser ästhetischen Größenordnung, ist den Ideen unangemessen. So resultiert die Unangemessenheit des Erhabenen aus der Unangemessenheit der sinnlichen Vorstellung des Menschen selbst.
Das Erhabene ist hier als Idee der Unendlichkeit zwar nicht angemessen darzustellen, doch erreicht es eine Angemessenheit auf einer höheren Ebene. Indem der Mensch sich auf die Unendlichkeit als solche besinnt und begreift, dass die Natur keine Macht über ihn hat, kann er sich in Freiheit, die Willensbestimmung im autonomen Menschen ist, von der Furcht befreien. Sein Verhalten ist nicht von der Natur festgelegt, sondern von seiner eigenen Vernunft bestimmt. Sein Endzweck ist das rechte Handeln. Sich des Erhabenen als Idee der Vernunft klarzuwerden, bedeutet, dass sein Verhalten dann ethisch-moralisch angemessen sein kann. Denn Kant spricht in Bezug auf das Sittengesetz von „der Erhabenheit des Gegenstandes“ (KpV A 291), die darin besteht, dass der Mensch durch seine Intelligenz, Persönlichkeit und sein inneres moralisches Gesetz seinen eigenen Wert entfaltet (KpV A 289/290). Kants Sittengesetz geht ins Unendliche insofern, als es nicht auf Bedingungen des Lebens begrenzt ist, sondern über meine individuelle Existenz hinausgeht. Es ist die formale Bedingung menschlicher Freiheit. Ergo könnte man schlussfolgern, dass das Sittengesetz nach Kant den Menschen erhaben werden lässt. Kants transzendentale Ästhetik und seine Pflichtethik konvergieren in diesem Punkt, wenn das Erhabene, von einer transzendentalen Idee ausgehend, zu einem ethischen Prinzip wird: „Der Gegenstand eines reinen und unbedingten intellektuellen Wohlgefallens ist das moralische Gesetz in seiner Macht, die es in uns über alle und jede vor ihm vorhergehende Triebfedern des Gemüts ausübt“ (KdU B, 120).
Kants Moralphilosophie und Ästhetik des Schönen und Erhabenen finden in Friedrich Schiller einen begeisterten Anhänger, der dem kantischen Weg der „Kraft der Vernunft“ zwar folgt, doch bisweilen auch Abzweigungen nimmt.
Schiller erweist sich nicht nur bezüglich der ethischen Sittenlehre (vgl. Kapitel 3.3), sondern auch bezüglich des Erhabenen bei Kant als sein Vermittler und künstlerischer Weiterdenker13. Kant scheint für Schiller eine Art philosophischer Anregung und literarischer Ausgangspunkt gewesen zu sein.14 Schiller selbst schreibt in einem Brief am 3. März 1791 über Kant: „Seine Kritik der Urteilskraft, die ich mir selbst angeschafft habe, reißt mich hin durch ihren lichtvollen geistreichen Inhalt und hat mir das größte Verlangen beigebracht, mich nach und nach in seine Philosophie hineinzuarbeiten.“15 Man könnte sogar sagen, Schiller lernt bei der Lektüre Kants16 und dessen konzeptuellen Begrenzungen, selbst eine eigene Kunstphilosophie zu entwickeln. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich nach Burke ( A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the Sublime and Beautiful ) und Kant auch Schiller mit dem Erhabenen befasst und dieses sogar neu verortet, nämlich in der literarischen Gattung der Tragödie.
Während für Kant „das moralische Gesetz in mir“, der kategorische Imperativ als der durch den Willen bezwungene Trieb, das Zentrum seiner Pflichtethik bildet, ist für Schiller der Wille des Menschen nicht dem Sollen, sondern der Kunst unterworfen, mit dem Ziel der sittlichen „Veredelung“.17 Die Überzeugung, dass die Kunst als Mittel der Befreiung und Veredelung des Menschen dient, teilt Schiller mit seinem späteren Freund Goethe, mit dem ihn im zweiten Anlauf schließlich eine anregende Freundschaft und eine Art Arbeitsgemeinschaft intellektuell Gleichgesinnter verbindet.
In seinem Gedicht An einen Moralisten schreibt Schiller zwar skeptisch: „Zu Göttern schaffst du Menschen nie“18, doch sie zu vervollkommnen, ihren Charakter zu veredeln, ist ein lohnenswertes Ziel, womit sich Schillers neunter Brief Über die ästhetische Erziehung des Menschen beschäftigt. Das Mittel zur sittlichen Vervollkommnung des Menschen ist die Ästhetik: „Dieses Werkzeug ist die schöne Kunst, diese Quellen öffnen sich in ihren unsterblichen Mustern.“19 Die Kultur als ästhetische Erziehung macht den Menschen fähig, seinen Willen zu behaupten und Freiheit zu erlangen, indem der Mensch als „das Wesen, welches will“ ( Über das Erhabene , S. 822) sich moralisch bildet, denn „nur dieser, ist ganz frei“ ( Über das Erhabene , S. 824). Mit Hilfe der Energie des Willens, so Schiller weiter, kann der Mensch die Natur beherrschen und sich dann von ihr unabhängig machen. Zur moralischen Anlage20 muss aber die ästhetische Kultivierung des Gemüts hinzukommen. Diese kann durch zwei „Genien“, wie Schiller in seinem Gedicht Schön und Erhaben selbst formuliert, gelingen: durch die Schönheit und das erhabene Gefühl.
Читать дальше