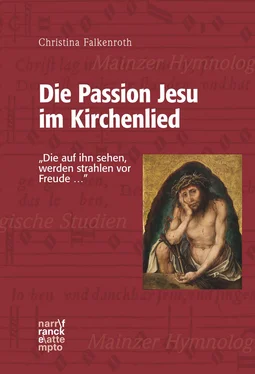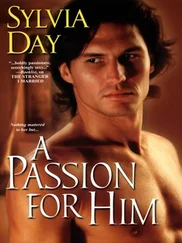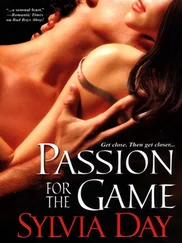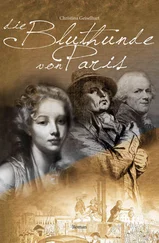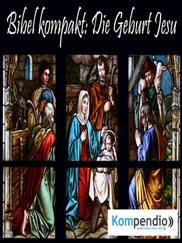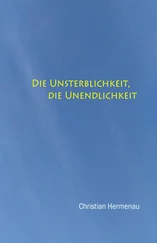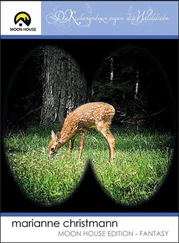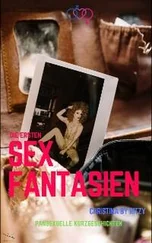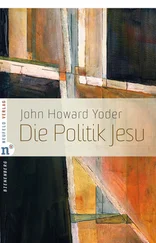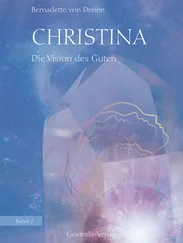Es besteht auch die Möglichkeit, daß wir nicht erkennen, wenn Gott so an uns handelt. Auch dieses Nicht-Erkennen unterstreicht wiederum das autonome Handeln Gottes in dem Geschehen. In seinem letzten Gliederungspunkt geht Luther auf die Folgen der Betrachtung des Leidens Christi ein: Das Betrachten selber ist ein mehrfacher Erkenntnisvorgang: Die Selbsterkenntnis und Sündenerkenntnis, das Erkennen der Liebe Christi und des Vaters. Aus diesem Erkennen folgt, daß nun das Leiden Christi zum Exempel für das ganze Leben wird. Hier deutet er den Betrachtungsvorgang nach der augustinischen Unterscheidung von sacramentum und exemplum. Die durch das rechte Betrachten des Kreuzes sich vollziehende Neugeburt des Menschen ist von Gott gewirkt, das Leiden ist also „sacramentum“, „das in uns wirkt und wir leiden“. Darauf folgt nun die Bedeutung des Leidens als „exemplum“, „das wir wirken“: Den Anfechtungen des Lebens wie Leiden, Unterworfenheit unter fremden Willen, Anfechtung durch Hoffart, Rachsucht oder Trübsal, können wir begegnen, indem wir uns vor Augen halten, daß unsere Anfechtungen im Vergleich zu denen, denen Christus standgehalten hat, gering sind, oder wir können aus dem Verhalten Christi für das eigene Verhalten lernen und ihn nachahmen. Auf diese Weise können wir „Christi Leben in das eigene Leben ziehen“. Implizit wird eine Veränderung im Verständnis des „exemplum“ deutlich: Diese imitatio des Handelns Christi ist nicht selbstgezeugt, sondern sie entspringt der Wandlung, die durch die Erkenntnis der Liebe Gottes sich in uns vollzogen hat: Aus der erkannten Liebe Gottes heraus, die unsere Liebe zu Gott weckt, werden wir zu Sündenfeinden. So ist das Leiden Christi uns zum Exempel geworden. Unser Handeln in seiner Nachfolge ist aber kein Tun aus eigener Kraft, sondern es ist von Gott selbst hervorgerufen. Die Hauptlinien der Argumentation Luthers cognitio sui Die Bewegungsrichtung auf ein Ziel gerichtet, die cognitio sui. Ihr Wert und Sinn ist die Selbsterkenntnis. Die Betrachtung dient dazu, am Gegenüber sich selbst zu erkennen. Die eigene Sünde vor Gott erkennen, die eigene Verlorenheit ist erkennbar an dem Ausmaß des Zornes Gottes, der sich hier zeigt. Es wird offenbar zum Einen an der Schwere des Leidens Christi. Zum anderen an der Tatsache, daß der geliebte Sohn dies tragen muß. Der Gedanke folgt dem Prinzip der Überhöhung: Wenn schon der geliebte Sohn und dazu noch einer, der ohne Sünde ist, solche Strafe zugemessen bekommt, wieviel mehr müßte ich vor Gott schuldiger Mensch an Strafe entgegennehmen. Das Schicksal Christi dient also als Sündenspiegel. Dabei geht es, wenn man der Argumentation Luthers folgt, nicht um ein neu erworbenes Wissen „Ich bin ein Sünder“, sondern darum, daß den Betrachter die Erkenntnis trifft, daß „Ich“ es bin, um den es hier geht; der Betrachter stellt einen Bezug zwischen sich und dem betrachteten Geschehen her. Er sieht sich selbst in den Vorgang hineingenommen. Darin entspricht dieses Erkennen dem vorausgegangenen Wort „… was hilfft dichs, das gott got ist, wan er dier nit eyn got ist?“ Was hilft es dir, dich als Sünder zu wissen, wenn du die Sünde nicht auf dein Gottesverhältnis beziehst? Cognitio sui bedeutet also strenggenommen: Das Ich erkennt sich in seinem Verhältnis zu Gott und zu dem Leiden Christi. Die Beschaffenheit des Gottesverhältnisses wird am Leiden offenbar. Es handelt sich also um keine absolute Selbsterkenntnis, sondern eine relative. Sie bedeutet den Beginn einer Begegnung mit dem Gekreuzigten. Der Erkenntnisweg Die gewonnene Selbsterkenntnis bleibt aber nicht bei sich selber stehen: Nachdem der Betrachter im Leiden des Gekreuzigten sich selbst in seiner Verfassung vor Gott erkannt hat, über sich erschrocken ist und im Gewissen leidet1, soll er von sich weg blicken, wieder hin zum Gekreuzigten, von dem her sein Blick auf sich selber gelenkt worden ist. Der erneute Blick auf Christus eröffnet weitergehendes Erkennen: Der Betrachter sieht das liebende Herz Christi, durch dieses hindurch erkennt er das Herz des Vaters, das voll Liebe ist. Nachdem am Beginn der Zorn Gottes über die Sünde stand, folgt nun die Erkenntnis Gottes als gütigen, liebenden Vater. Die Erkenntnis von Zorn und Liebe, d.h. eine doppelte Gotteserkenntnis vollzieht sich also in der Betrachtung des Gekreuzigten. Der Zorn Gottes und seine Liebe gehören bei Luther zueinander. Schon in der Ersten Psalmenvorlesung hat er seine Christologie dargelegt, nach der im Kreuz Christi sich Zorn und Liebe als konstitutiv für das Rettungshandeln Gottes am Menschen erweisen. Das Zorngericht am Sohn ist nach seinem Verständnis das opus alienum Gottes, der darin das opus proprium verwirklicht. Durch das Gericht, das er an ihm vollzieht, führt er ihn zum Leben. So ist es sichtbar an Christus, und so gilt es für den Menschen, der sich diesem Gericht unterwirft und Gott in seinem Urteil über ihn recht gibt. Christus zieht den Menschen hinein in sein Leiden, Sterben und Auferstehen. Es scheint, daß Luther in der Darstellung des Erkenntnisweges von den Hoheliedpredigten Bernhards herkommt. Bernhard versteht die Seitenwunde, die auf das durchbohrte Herz Jesu verweist, als Wunde, in der die Liebe Gottes sichtbar wird: „Patet arcanum cordis perforamina corporis, patet magnum illud pietas sacramentum, patent viscera misericordiae dei nostri“2. Durch nichts konnte die hier offen erkennbare Liebe deutlicher werden als durch die Wunden Christi, betont Bernhard. In dieser Tradition stehend hat Luther aus ihr doch ein eigenes christologisches Konzept entwickelt. conformatio Nach dem Sermon ist die Selbsterkenntnis des Betrachters des Leidens Christi letztlich der Schlüssel dazu, Christus gleichförmig zu werden. Der Selbsterkenntnis, die durch Erschrecken vor sich selbst ausgelöst wurde, folgt der Verlust aller Zuversicht auf „creaturen“ und aller Möglichkeiten, sich vor den Folgen der Sünde zu bewahren, am Ende steht die Erfahrung der Gottverlassenheit. Das durch die Betrachtung des Gekreuzigten ausgelöste Leiden im Gewissen ist das Erleiden der Gottverlassenheit, das Christus erlitt. Durch dieses Leiden wird der Mensch christusförmig. Dieser Prozeß des Gleichförmig-werdens ist in der Tradition verankert. Die conformatio, die in der spätmittelalterlichen Passionsbetrachtung zum allgemein verbreiteten Denkschema geworden ist, entspricht dem hier im Sermon beschriebenen Prozeß. In der Tradition erreicht der Betrachter die conformatio dadurch, daß er sich selber in das Geschehen hineinversetzt, es mitempfindet und in der Nachfolge Christi in seinen Tugenden sich selber ihm gleichförmig macht. Der große Unterschied dazu bei Luther besteht nun darin, daß hier nicht das eigene Handeln zur Erlangung der Gleichförmigkeit führt, sondern sich das Leiden im Gewissen an dem Betrachter ereignet. Luther weist darauf hin, daß es Gott ist, der das rechte Erkennen schenkt, das zum Leiden im Gewissen führt. Es steht nicht im Bereich der Möglichkeiten des Menschen diese conformatio herbeizuführen. So hatte es Luther schon in der Psalmen-Vorlesung entwickelt: Christus wird in seinem Leiden uns zum Exempel. Aber nicht wir bilden uns diesem Vorbild nach, sondern Gott bildet uns nach dem Bild Christi. Die Beziehung der Gleichförmigkeit liegt allein in Gottes Tat.3 Allein Gottes Handeln Der Sermon Luthers ist durchwoben von Hinweisen darauf, daß Gott in der fruchtbaren Betrachtung der Passion am Menschen wirkt. Gott wirkt die cognitio sui, Gott erweicht das Herz (Gliederungspunkt 9). Gott schenkt das „Werk des Leidens Christi“, das Absterben des alten Menschen, die wesentliche Wandlung (10), die Neugeburt, die conformatio. Sogar oft ohne daß wir es erkennen (11). Gott schenkt den Glauben (14), mit dem wir unsere Sünden fort aus dem Gewissen, auf Christus schütten. (12) Es erweist sich, daß Luther die Passionsbetrachtung und ihren Nutzen in ihrer Gesamtheit als Handeln Christi am Menschen versteht: Hierin besteht das grundlegend Neue bei Luther.
Читать дальше