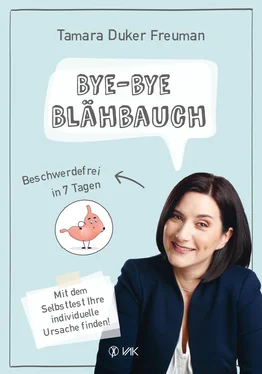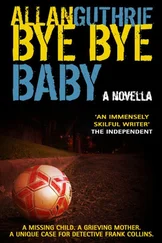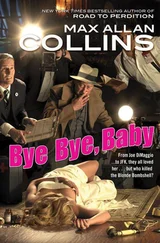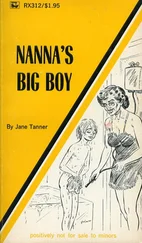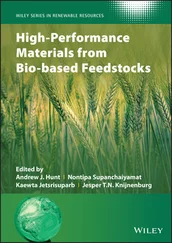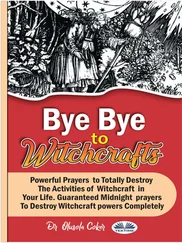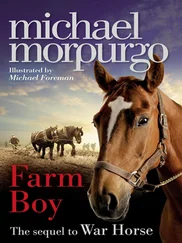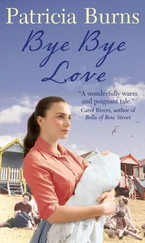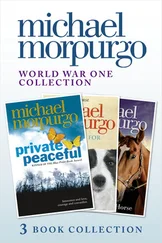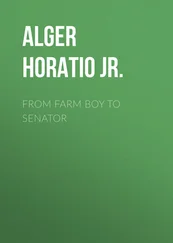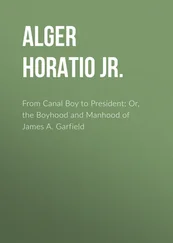Die Gastroparese diagnostizieren
Der gastrische Entleerungs-Scan
Hat Ihr Arzt aufgrund Ihrer Symptomenbeschreibung, wie im vorigen Abschnitt genannt, den Verdacht, dass Sie an einer GP leiden, veranlasst er normalerweise einen sogenannten gastrischen Entleerungs-Scan, auch als Magenentleerungsszintigrafie (MESz) bekannt. Dies gilt als die beste Diagnosemethode.
Ein gastrischer Entleerungs-Scan ist eine meist zwei bis vier Stunden dauernde Untersuchung, die in einer radiologischen Praxis durchgeführt wird; er misst, wie lange eine standardisierte Portion Nahrung oder Flüssigkeit braucht, um den Magen zu verlassen. Die Geschwindigkeit Ihrer Magenentleerung wird mit der normalen Entleerungsgeschwindigkeit verglichen, indem man in regelmäßigen Abständen feststellt, wie viel Prozent der aufgenommenen Nahrung sich jeweils noch im Magen befinden. Ist es am Ende der Untersuchung eine größere als die normale Menge, wird die Diagnose Gastroparese, Magenlähmung, gestellt. Sie wird in die Schweregrade leicht, mittel oder schwer unterteilt, je nachdem, wie hoch der Prozentsatz der im Magen verbliebenen Nahrung am Ende der Untersuchung ist.
Vor dieser Untersuchung bekommen Sie eine kleine Mahlzeit. Die Nahrung wird radioaktiv markiert, sodass der Radiologe den Weg durch Ihren Verdauungstrakt mithilfe von Aufnahmen des Abdomens mit einer Spezialkamera verfolgen kann. Röntgenaufnahmen werden nicht gemacht. Gastrische Entleerungs-Scans können mit Flüssigkeiten oder fester Nahrung durchgeführt werden, um die Magenentleerungsgeschwindigkeit der jeweiligen Konsistenz zu bestimmen. Es ist möglich, dass es bei fester Nahrung zu einer verzögerten Entleerung kommt, nicht aber bei Flüssigkeiten. Doch selbst wenn bei beiden Formen eine Verzögerung vorliegt, verlassen Flüssigkeiten den Magen im Allgemeinen schneller als feste Nahrung. Hat Ihr Arzt den Verdacht, dass nicht nur der Magen, sondern eventuell auch andere Abschnitte des Verdauungstrakts von Motilitätsproblemen betroffen sind, kann er eine erweiterte Version dieser Untersuchung veranlassen, die die Passagezeit der Nahrung durch den Magen, den Dünndarm und den Dickdarm bestimmt. Dazu sind Sie am ersten Tag meist sechs Stunden in der radiologischen Praxis und gehen in den nächsten drei Tagen noch einmal hin, um jeweils schnell eine Aufnahme machen zu lassen.
Außer den eben beschriebenen Untersuchungen gibt es noch ein paar andere, die zwar nicht als spezifisch für die Diagnose einer GP gelten, aber trotzdem hilfreich sind, um Anhaltspunkte für das Vorliegen der Krankheit zu finden.
Aufnahmen vom oberen Gastrointestinaltrakt (GI)
Diese Untersuchung nutzt die Röntgentechnologie, um den Weg der Flüssigkeit durch den Magen und den ersten Dünndarmabschnitt zu verfolgen. Dazu schlucken Sie eine dickflüssige bariumhaltige Substanz, der Radiologe überwacht auf dem Monitor deren Weg durch den Verdauungstrakt und macht dabei Aufnahmen. Mit dieser Untersuchung ist eine GP nicht leicht zu diagnostizieren, doch damit kann bei bereits diagnostizierten Menschen festgestellt werden, ob Probleme mit dem Pylorus, dem Magenpförtner, die Ursache der verzögerten Magenentleerung sind. So kann zum Beispiel aufgedeckt werden, ob eine Pylorusstenose, eine Verengung des Magenpförtners, vorliegt, durch die ein Engpass für die Nahrung entsteht, die versucht, den Magen zu verlassen. Das ist eine mögliche, der GP zugrunde liegende behandelbare Ursache, da die Ärzte die Pylorusöffnung eventuell erweitern beziehungsweise dehnen können. Die beschriebene Untersuchungsmethode ist nicht schmerzhaft, doch die Menschen klagen oft darüber, dass Geschmack und Konsistenz der bariumhaltigen Flüssigkeit ekelhaft seien; außerdem haben Sie danach wahrscheinlich ein bis zwei Tage lang eine Verstopfung.
Endoskopie
Die Endoskopie oder – in diesem Fall – die ÖGD (eine gnädige Abkürzung für Ösophagogastroduodenoskopie) ist eine Untersuchung, bei der ein Arzt (meist der Gastroenterologe) ein Rohr mit einer daran befestigten Mini-Kamera durch den Mund in den Ösophagus (die Speiseröhre) und in den Magen einführt, um sich alle diese Organe von innen ansehen zu können. Die Untersuchung dauert nur etwa 15 Minuten und wird meist unter Sedierung des Patienten (durch ein Beruhigungsmittel, das ihn schläfrig macht) durchgeführt.
Die ÖGD ist zwar keine Untersuchung, die Ärzte zur Diagnose einer Gastroparese heranziehen, doch stoßen sie bei einer Endoskopie aus anderen Gründen manchmal auf Hinweise, die diese Erkrankung nahelegen. Wenn sie zum Beispiel Nahrung in Ihrem Magen vorfinden, die vom Abendessen am Tag vorher stammt, kann das eventuell auf eine verzögerte Magenentleerung hinweisen. Denn eigentlich dürfen Sie in der Nacht vor der ÖGD von Mitternacht an nichts mehr essen, wodurch ein normal arbeitender Magen genügend Zeit haben sollte, sich zu entleeren. Ein weiterer Anhaltspunkt, den Ihr Gastroenterologe während einer ÖGD beobachten kann, ist die fehlende Magenperistaltik während der Untersuchung. In beiden Fällen empfiehlt er Ihnen vielleicht, noch einen gastrischen Entleerungs-Scan machen zu lassen.
Eine ÖGD kann auch Pylorusblockaden ans Licht bringen, die eine Magenentleerung verhindern. Diese können durch Narben aufgrund früherer Operationen, durch ausgeheilte Magengeschwüre, Tumore oder sogar durch sogenannte Bezoare, also Klümpchen unverdauter Substanzen – etwa Nahrung, Tabletten, Haare oder Arten von klebrigem Süßkram wie Karamellbonbons – verursacht werden, die verklumpen, den Pylorus blockieren und die Magenentleerung verhindern.
Die Gastroparese behandeln
Die Behandlung besteht im Allgemeinen aus einer Kombination von Ernährungsumstellung und Medikamenten, je nach Schwere der Symptome. Da alle GP-Präparate potenzielle Nebenwirkungen haben, schlägt Ihr Arzt Ihnen eventuell vor, es zunächst mit einer Umstellung der Ernährung zu versuchen. Man kann auch endoskopisch oder chirurgisch Abhilfe schaffen.
Die medizinische Behandlung der Gastroparese
Die medizinische Primärbehandlung bei GP erfolgt mit sogenannten Prokinetika. Diese Medikamente stimulieren die Magenperistaltik, sodass der Magen häufiger kontrahiert, sich dadurch schneller entleert und die Beschwerden, das Gefühl des Aufgebläht-Seins, das Völlegefühl, der Appetitmangel, die Übelkeit, der Reflux und/oder das Erbrechen, gelindert werden. Beispiele solcher Prokinetika sind Reglan (Wirkstoff Metoclopramid; in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter anderem unter dem Handelsnamen Paspertin erhältlich, in Deutschland gibt es auch zahlreiche Generika; Anm. d. Übers.) und Motilium (Wirkstoff Domperidon). Die Antibiotika Erythromycin und Zithromax (Wirkstoff Azithromycin) haben ebenfalls prokinetische Eigenschaften. Alle diese Medikamente sind selten eine Wunderwaffe bei GP, und eine Ernährungsumstellung ist fast immer auch erforderlich.
Andere Präparate mögen dazu beitragen, die Symptome der GP, insbesondere Übelkeit und Erbrechen, unter Kontrolle zu halten, aber sie setzen faktisch nicht bei der zugrunde liegenden Ursache an. Medikamente gegen die Übelkeit (die sogenannten Antiemetika) sind eine solche Option, doch ihr Nutzen sollte gegen die möglichen Nebenwirkungen abgewogen werden. Manche Antiemetika können eine Verstopfung verursachen und die Blähbeschwerden bei Menschen verschlimmern, deren Gesamtperistaltik im Magen und im Dickdarm verlangsamt ist und die aufgrund eines „Rückstaus“ bereits Blähbeschwerden haben (mehr zu dieser Art von Blähbeschwerden erfahren Sie in Kapitel 7).
Die Behandlung der Gastroparese durch die Ernährung
Die Ernährungstherapie bei der GP ist auf den Umgang mit Ihren Symptomen ausgerichtet, nicht auf die Heilung der Krankheit, denn die Ernährung kann die Anzahl Ihrer Magenbewegungen faktisch nicht erhöhen. Doch die Konsistenz, die Menge, der Fett- und der Ballaststoffgehalt von Mahlzeiten können sicher Einfluss darauf nehmen, wie schnell diese den Magen passieren und in die nächste Phase der Verdauung eintreten.
Читать дальше