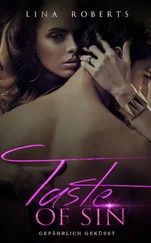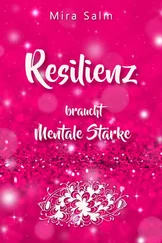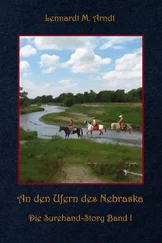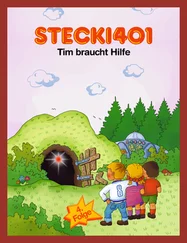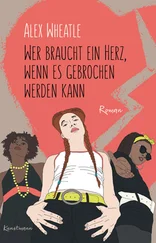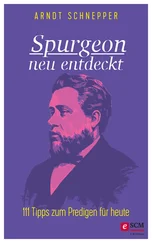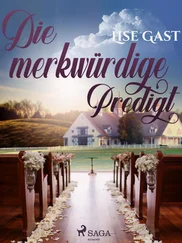Mit anderen Worten: Der Intellekt ist ein wichtiger Teil des Herzens, aber eben nicht alleiniger. Gefühle bewegen uns oftmals viel stärker. Darauf sollte eine Predigt unbedingt Rücksicht nehmen. Der Berliner Erweckungstheologe August Neander (1789–1850) sagte es so: Pectus est quod facit theologum, also: Das Herz macht den Theologen.
 Praxis
Praxis
Ich denke, es ist höchste Zeit, die immer sehr beliebte Konfrontation von Gefühlen und Gedanken zu überwinden. Sie entspricht weder den modernen medizinischen Ergebnissen noch dem biblischen Menschenbild. Beide Funktionen sind zutiefst menschlich und gehören zusammen. Deshalb darf es bei aller Wertschätzung der Emotionen auch nicht um die Preisgabe der Rationalität gehen. Es muss außerdem immer legitim sein, Emotionen kritisch zu hinterfragen. Gefühl ist eben nicht alles, wie Goethe seinen Protagonisten Faust im gleichnamigen Drama sagen lässt. Genauso wenig, wie Verstand und Intellekt alles bedeuten. Beide Funktionen des menschlichen Herzens haben ihren jeweils eigenen Wert und bedürfen ihrer gegenseitigen Ergänzung. Die Gefährdung tritt dann ein, wenn sie isoliert erscheinen.
Es wäre aber zu kurz gegriffen, die Bedeutung der Emotionen nur vom Menschen her zu begründen. Gefühle sind nämlich nicht nur zutiefst menschlich, sie haben ihren Ursprung in Gott selbst. Immer wieder fällt beim Bibellesen auf, dass Gott ziemlich emotional dargestellt wird. So reut es ihn, dass er den Menschen geschaffen hat (1. Mose 6,69), und er zürnt gegen Mose (2. Mose 4,14). Gleichzeitig freut er sich über die Menschen (Zefanja 3,17) und ist gnädig gegenüber den Sündern (Psalm 25,8). Gleiches lässt sich auch über Gottes Sohn sagen. Er weint (Johannes 11,35), er jubelt (Lukas 10,21) und liebt (Johannes 11,5). Ja, Gott wird deshalb auch die Liebe selbst genannt (1. Johannes 4,16). Von theologischer Seite hat man manchmal mit Blick auf solche Aussagen von einem Anthropopathismus gesprochen. Darunter verstand man eine Vermenschlichung Gottes. Der Mensch habe, weil er es nicht besser gewusst habe, seine Gefühle auf Gottes Wesen übertragen. Gott sei aber Gott und habe deshalb keine Gefühle. Wenn in der Bibel nun doch von Gottes emotionalen Regungen die Rede sei, dann nur, weil der Mensch nicht umhinkönne, Gott aus seinen menschlichen Erfahrungen heraus zu beschreiben.
Das klingt erst mal gut, wird aber bei näherem Hinsehen dem biblischen Sachverhalt nicht gerecht. Denn der Clou des christlichen Menschenverständnisses ist ja gerade der, dass der Mensch nach Gottes Wesen und Bildnis geschaffen wurde (1. Mose 1,26). Er erhält von Gott sogar den Atem des Lebens (1. Mose 2,7). All dies sind Hinweise auf die Quelle der geistigen Verfasstheit des Menschen. Seine intellektuellen und emotionalen Fähigkeiten sind nicht nur menschlich erklärbar, sondern sind auf Gottes Wesen zurückzuführen. Mit anderen Worten: Wenn wir denken und wenn wir fühlen, tun wir es, weil es Gottes Wesen bildhaft entspricht. Und wenn wir in den Predigten emotional werden und die Gefühle ansprechen, so liegt das Motiv nicht in einer rhetorischen Überzeugungsstrategie, sondern im Wissen um den göttlichen Ursprung der Gefühle und die geschöpfliche Signatur des Menschen.
Die Schatten der Geschichte – Gründe unserer Gefühlsarmut
 Eindruck
Eindruck
Hören, Verstehen und Spüren – diese drei Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit eine Predigt wirklich wirken kann. Trotzdem haben es gerade die Gefühle oft schwer, ernst genommen zu werden. Verständlich und klug kann eine Predigt eigentlich nie genug sein. Dem bedachten und bewussten Appell an die Emotionen wird dagegen meist kritisch begegnet. Wenn ich bei Vorträgen über den Zusammenhang von Predigt und Gefühl spreche, begegnet mir in großer Regelmäßigkeit die Frage nach einer möglichen Manipulation. Besteht nicht die Gefahr, dass arglistige Prediger und Predigerinnen die Emotionen nutzen, um die Zuhörenden gewissenlos zu täuschen? Könnte es nicht sein, dass Menschen mithilfe starker Erregungen getäuscht werden? Darauf gibt es nur eine Antwort: Ja, das ist durchaus möglich. Es ist aber nur konsequent nachzufragen: Können all diese Befürchtungen nicht auch mit sachlichen Argumenten verfolgt werden? Und das ist die zweite Seite der Medaille. Manipulieren und täuschen kann man mittels der Gefühle, aber ebenso durch sachliche Rede. Es ist wie vieles in der Welt: Auf den richtigen Gebrauch kommt es an. Und es hilft nicht, aufgrund von Missbrauch einen wichtigen Kanal der menschlichen Wahrnehmung abzulehnen. Denn dann dürften wir streng genommen gar nichts mehr sagen.
 Inspiration
Inspiration
Doch wie ist es zu erklären, dass die Gefühle es in unseren Predigten so schwer haben? Warum wird mehr vor ihnen gewarnt, als dass sie empfohlen werden? In der einschlägigen Literatur wird oft auf zwei historische Ereignisse hingewiesen, die gegensätzlicher nicht sein könnten: die europäische Aufklärung und der deutsche Nationalsozialismus. Beide haben – obwohl sie nun gar nicht miteinander zu vergleichen sind – die Haltung zu öffentlichen Gefühlen maßgeblich geprägt.
Gehen wir auf eine kleine Zeitreise und schalten einmal 400 Jahre zurück. Es ist die Nacht von Sonntag, dem 10. November, auf Montag, den 11. November 1619. Im oberbayerischen Neuburg an der Donau befindet sich der 23-jährige Franzose René Descartes (1596–1650). Es herrscht der Dreißigjährige Krieg und als Kriegsfreiwilliger steht er im Dienst der bayerischen Armee. Noch ist Descartes unbekannt, bald wird er als bedeutendster Philosoph der beginnenden Neuzeit gelten. Der Winter zwingt die Soldaten zum Abwarten. Es ist bitterkalt und Descartes zieht sich in ein Kaminzimmer zurück. Während draußen der eisige Wind über das Lager pfeift, setzt er sich nahe an einen Ofen und schaut lange in die glühende Kohle. Er denkt über eine uralte Frage der Menschheit nach: Was kann der Mensch wirklich wissen? Können wir, so fragt Descartes, unseren Sinnen wie Augen und Ohren eigentlich trauen? Nein, sie können täuschen. Ist es dann das Denken, dem wir immer folgen könnten? Nein, auch dieser Weg ist versperrt. Denn das Nachdenken könnte möglicherweise von einem Dämon getrübt sein. Descartes beginnt an allem zu zweifeln. Und in dieser Nacht findet er über den Zweifel zur Gewissheit. Im kritischen Denken wird ihm bewusst, dass er lebt. Er kann zwar nicht sicher sein, dass das, was er denkt, richtig ist. Doch das Denken und Zweifeln sind für ihn ein untrüglicher Beweis, dass es ihn gibt. So wird das Denken für ihn zur Basis, das Leben und die Welt zu verstehen.
Etwa 20 Jahre später wird er seine Einsicht mit einem berühmten Ausspruch schriftlich festhalten. Es ist der Satz, der die neue Zeit der Philosophie markiert: »Je pense, donc je suis«, das heißt auf Deutsch: »Ich denke, also bin ich.« Und da Descartes viele seiner Bücher wie damals üblich in Latein verfasste, ist auch die lateinische Variante heute noch bekannt: »Ego cogito, ergo sum.« Es ist diese Überzeugung von Descartes, die den Boden für die sogenannte Aufklärung bildet. Die ratio, die Vernunft, gilt fortan als der goldene Schlüssel, um die Welt zu verstehen. Ihr wird nun so gut wie alles zugetraut. Und darum wird sie auch als der wesentliche Teil des Menschen geschätzt. Körper und Gefühle spielen natürlich noch eine Rolle, aber sie sitzen nur noch auf der Ersatzbank. Die These mancher Wissenschaftler ist, dass mit der Aufklärung die Rolle der Gefühle langsam zurückging. Dieser Prozess vollzog sich nicht von einem Moment auf den anderen, sondern er verlief in langen Wellen, aber er vollzog sich unaufhaltsam. Und das wirkte sich natürlich auch auf die Predigt aus.
Читать дальше
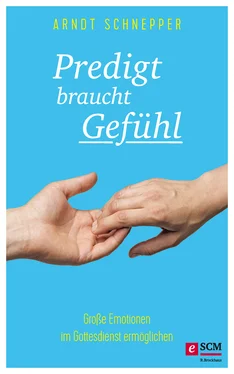
 Praxis
Praxis Eindruck
Eindruck Inspiration
Inspiration