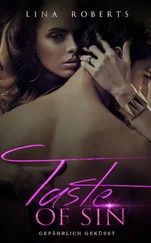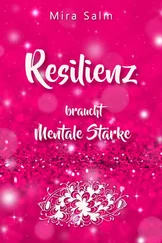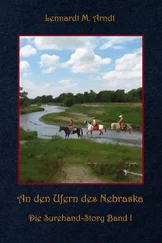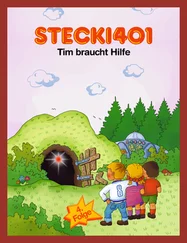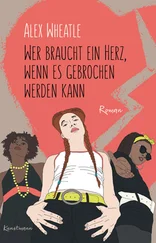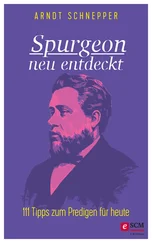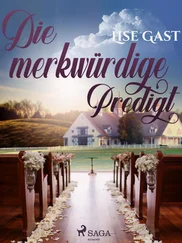Inspiration
Inspiration
Beginnen wir mit dem äußeren Kreis – den sinnlichen Voraussetzungen. Ohne technische Hilfsmittel und nur mit der Stimme zu sprechen, war im Altertum eine enorme Herausforderung. Daher nutzte man gerne naturgegebene oder künstliche Erhöhungen, um besser gehört zu werden. Schauspieler stellten sich auf eine Bühne und Feldherren kletterten auf ein Gerüst, um vor der Schlacht eine Rede an die Soldaten zu richten. Das taten sie aus zweierlei Gründen: Zum einen wurde so der Schall ihrer Stimme nicht vorschnell von den anwesenden Zuhörern abgeschwächt, sondern konnte sich über ihre Köpfe hinweg besser ausbreiten. Und zum anderen wurden sie an einer solch exponierten Stelle viel besser gesehen. Wo ihre Stimme vielleicht nur noch schwach vernehmbar war, da konnten sie mittels Gestik und Mimik immer noch verstanden werden. Auch Jesus wusste von solchen akustischen Rahmenbedingungen. So wird etwa zu Beginn der Bergpredigt darauf hingewiesen, dass er beim Anblick der vielen Menschen auf eine Anhöhe stieg (Matthäus 5,1). Das war eine wichtige Voraussetzung, damit er auch von allen Zuhörern gehört werden konnte.
Auch das Bemühen um die zweite Ebene des Sprechens – die Verständlichkeit – ist bei Jesus in hohem Maße gegeben. Natürlich können wir nur die Reden Jesu beurteilen, die uns die Evangelisten überliefert haben. Aber was uns vorliegt, ist auch heute noch nach rund 2000 Jahren erstaunlich gut verständlich. Sicher, viele Begriffe unterliegen einem Bedeutungswandel. Umso erstaunlicher ist die große Klarheit seiner Reden, die das Lesen auch heute ohne große Vorkenntnisse im Großen und Ganzen ermöglicht. Für etliche andere religiöse Schriften aus dieser Zeit, wie etwa aus der gnostischen Literatur, lässt sich das so nicht immer behaupten. Mit anderen Worten: Jesus sprach nicht dunkel und raunend wie ein Esoteriker, sondern er bemühte sich als Lehrer um Klarheit und Unkompliziertheit. Verständlichkeit im Reden, plain talk und einfache Sprache erscheinen bei ihm als hohes Ideal. Diesem Ideal fühlte sich auch Paulus verpflichtet, wenn er etwa den Christen in Korinth ins Stammbuch schrieb: »Aber in einer Gemeindeversammlung spreche ich lieber fünf verständliche Worte, die anderen helfen, als zehntausend Worte in einer anderen Sprache« (1. Korinther 14,19).
Verständlichkeit bedeutete für Jesus aber keinesfalls geistige Unbedarftheit oder gar Dummheit. So einfach seine Sprache damals und heute scheint, so akkurat waren bisweilen seine Argumentationsverfahren. Ganz offensichtlich waren ihm viele der damals gängigen Diskussionstechniken geläufig. So schließt er zum Beispiel in der Bergpredigt vom Kleineren aufs Größere. Wenn Gott das Gras des Feldes (das Kleine), das morgen in den Ofen geworfen wird, so schön ausstattet, sollte er sich nicht viel mehr auch um seine Kinder (das Große) kümmern (Matthäus 6,30)? Rhetoriker nennen dieses Beweisverfahren das argumentum a minore ad maius. Aber er nutzt auch das umgekehrte Verfahren, was gemeinhin als argumentum a maiore ad minus bezeichnet wird. Hier schließt er vom Größeren auf das Kleinere, wie etwa bei der Heilung des Gelähmten, der durch das Dach zu ihm heruntergelassen wird (Markus 2,12). Wenn er heilen kann (in den Augen der Zuschauer das Größere), dann hat er auch die Macht, Sünden zu vergeben (das Kleinere im Dafürhalten der Anwesenden). Mal argumentiert er mit der Erfahrung, sehr häufig auch mit dem Hinweis auf die Heilige Schrift. Jesus war, so Martin Luther, der »beste Dialecticus« (WA 47, 777, 17), also ein hervorragender Diskutant und Dialogpartner. Er war in keinem Gespräch um gute Gründe verlegen und erwies sich als ziemlich schlagfertig.
Jesus war ein großer Lehrer – aber er besaß kein Lehrhaus und leitete auch keine eigene Schule. Ganz im Gegenteil: Wohl hielt er sich manchmal in Kapernaum auf, doch die längste Zeit war er unterwegs. Er eilte von Ort zu Ort, um das Evangelium vom anbrechenden Reich Gottes zu predigen. Im Grunde ist das eine schlechte Voraussetzung, um viele Menschen um sich zu sammeln. Denn die mögen in aller Regel stabile und tragfähige Beziehungen. Einem Durchreisenden gegenüber sind sie eher skeptisch.
Jesus gelang es trotzdem die Leute mit seiner Predigt zu gewinnen – aber was war sein Geheimnis?
 Praxis
Praxis
Literaturwissenschaftler sprechen hier von der »poetischen Form« der Sprache Jesu. Auch wenn Jesus in Aramäisch predigte, die Evangelisten seine Reden ins Griechische übertrugen und wir heute die Texte in deutscher Sprache lesen, so ist bis heute der unnachahmliche »Sound« der Reden von Jesus zu spüren. Alles klingt und schwingt bei ihm. Seine Worte sind voller Bilder und Beispiele, Langeweile ist nicht möglich. Ja, man wird bei ihm von einem Thema zum nächsten mitgerissen.
Poetisch nennt man seine Predigtweise also nicht, weil er sich um hebräische Lyrik bemüht hätte. Mit dieser Bezeichnung ist vielmehr gemeint, dass es bewusst für die Zuhörenden geformte Sprache ist. Er nutzte keine Schriftsprache, wie etwa Paulus es in seinen Briefen tat, wo man beim Abfassen jedes Satzes noch mal nachdenken kann. Bei Jesus finden wir die typische Sprechsprache, die versucht, Aufmerksamkeit zu erregen. Es ist keine kühle und sachliche Sprache, es ist eine Rede, die den Hörenden berühren und bewegen soll. Es ist eine Predigtweise, die zielsicher auf die Emotionen abzielt. Als ungeheuer stark empfinden wir noch heute seine Geschichten und Gleichnisse, wie etwa die vom barmherzigen Samariter (Lukas 10), vom verlorenen Sohn (Lukas 15), vom vierfachen Ackerfeld (Matthäus 13) oder den Arbeitern im Weinberg (Matthäus 20). Durch und durch einprägsam sind auch seine sogenannten »Ich-bin«-Worte, wie sie im Johannesevangelium überliefert werden. Theologische Spitzenaussagen werden hier in ein emotionales Kleid eingewickelt, sodass sie bis heute ihre Wirkung nicht verfehlen.
Jesus predigte in einer Zeit, die wir heute als orale, also mündliche Kultur bezeichnen. Auch wenn die Menschen damals begannen, mehr und mehr zu schreiben – man denke an Paulus und seine zahlreichen Briefe –, so war die mündliche Rede doch die vorherrschende Kommunikation. Man wusste: Wer überzeugen möchte, muss zu den Menschen sprechen können. Er muss alle wesentlichen Voraussetzungen des Redens im Blick haben. Man konnte es sich nicht leisten, leise und langweilig vor sich hin zu reden – es war geboten, laut und vernehmlich sowie verständlich und mit viel Gefühl zu den Menschen zu sprechen. Nur so ließen sich die Zuhörer erreichen.
Was Jesus nun erfolgreich in seinem Alltag praktizierte, war auch Gegenstand der damaligen Wissenschaften. Immer wieder wurde im Altertum gefragt, wie mithilfe von Erfahrung und Überlegung die Voraussetzungen der wirksamen Rede beschrieben werden könnten. Eine wichtige Stimme war hier der römische Philosoph und Jurist Marcus Tullius Cicero (106–43 v.Chr.), der rund 100 Jahre vor Jesus geboren wurde. In seinem Werk »Über den Redner« (Original: »De oratore«) benennt er drei unersetzliche Aufgaben, die ein erfolgreicher Redner verfolgen muss, damit er Wirkung erzielt. Diese Faktoren wurden später auch als die officia oratoris, also die Wirkungsarten der Redekunst, bezeichnet. Es handelt sich um das Belehren (lat. docere), das Erfreuen (lat. delectare) und das Bewegen oder Erschüttern (lat. movere):
So konzentriert sich die gesamte Redekunst auf drei Faktoren, die der Überzeugung dienen: den Beweis der Wahrheit dessen, was wir vertreten, den Gewinn der Sympathie unseres Publikums und die Beeinflussung seiner Gefühle im Sinne dessen, was der Redegegenstand jeweils erfordert. (Cicero, De oratore II, 115)
Читать дальше
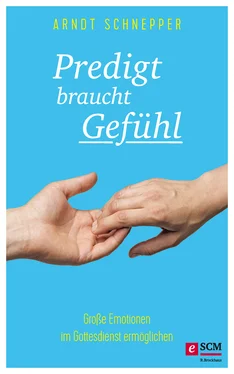
 Inspiration
Inspiration Praxis
Praxis