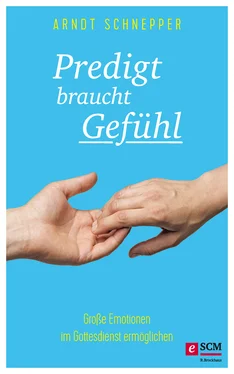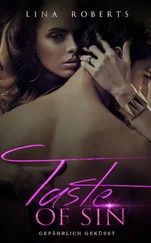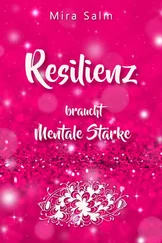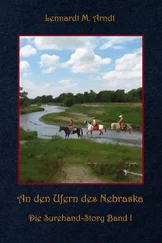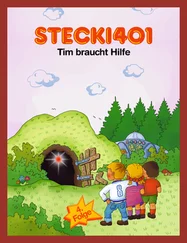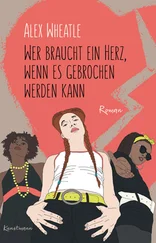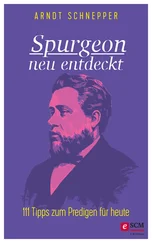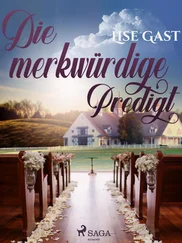Arndt Schnepper - Predigt braucht Gefühl
Здесь есть возможность читать онлайн «Arndt Schnepper - Predigt braucht Gefühl» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Predigt braucht Gefühl
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Predigt braucht Gefühl: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Predigt braucht Gefühl»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Arndt Schnepper ermutigt dazu, Gefühlen in Predigten mehr Raum zu geben – so wie es jahrhundertelang in Gottesdiensten der Fall war. Ganz praktisch zeigt Schnepper, wie Predigten ihr Ziel nicht verfehlen: den Hörer. Damit die Worte nicht nur in den Kopf, sondern auch ins Herz gehen.
Predigt braucht Gefühl — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Predigt braucht Gefühl», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Für seine Sache kann man die Zuhörer also nur gewinnen, wenn es gelingt, bei ihnen Gefühle zu wecken. Sich allein an den Verstand zu richten, reicht nicht, es muss das Herz getroffen werden. Es ist dieser Realismus der antiken Rhetorik, der ihr bis heute Bewunderung und Anerkennung verschafft. Die ausschließliche Betonung der Vernunft und der Argumentation wird dem Menschen nicht gerecht. Die Zuhörer wollen natürlich verstehen, sie möchten aber auch spüren und fühlen. Beides ist wichtig: gute Gedanken und große Gefühle. Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um eine gegenseitige Ergänzung. Diese Gewissheiten waren zu Jesu Zeiten Allgemeinwissen – und Jesus scheint dieses Wissen auf vollkommenste Weise verkörpert zu haben. Er sprach nicht an den Menschen vorbei – im Gegenteil. Nach seiner Predigt auf dem Berg »entsetzten« sich (Lutherbibel) bzw. »erstaunten« (Elberfelder Bibel) die Menschen sehr. Denn, so die Begründung des Evangelisten, »er sprach mit Vollmacht – anders als die Schriftgelehrten« (Matthäus 7,29).
Glaube ist kein Gefühl – oder doch?
 Eindruck
Eindruck
»Glaube ist kein Gefühl!« Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört? Ich weiß es nicht, aber dass er mir in Fleisch und Blut übergegangen ist, das weiß ich mit Sicherheit. Wahrscheinlich habe ich ihn auch selbst schon gebraucht. Doch sosehr er einerseits stimmt, so schwierig finde ich ihn mittlerweile. Unterstellt er doch, dass Glaube und Emotionen zwei unterschiedliche Welten sind. Erst spät stieß ich auf das Buch, das diesen Satz geprägt hat. Doch der Reihe nach.
Am 31. Juli 1976 stieg im US-Bundesstaat Colorado der Big Thompson River über die Ufer. Wolkenbruchartige Regenfälle hatten den Fluss anschwellen lassen. Nun überflutete er ganze Landstriche, entwurzelte Bäume, zerstörte Häuser und riss Fahrzeuge mit. Es entstanden enorme Sachschäden. Und viel schlimmer: Rund 140 Menschen fanden während des Unwetters den Tod. Es war eine furchtbare Katastrophe. Unter den Getöteten befanden sich auch sieben Mitarbeiterinnen der christlichen Studentenorganisation »Campus für Christus«. In großer Runde hatte man sich zu einem Freizeitwochenende auf der Sylvan Dale Guest Ranch getroffen. Es begann alles so verheißungsvoll. Doch dann brach das Unglück über sie herein. Auf der Flucht vor den Wassermassen wurden zwei ihrer Autos überspült. Zwei der jungen Frauen konnten sich noch befreien und später an Bäumen festklammern, für die anderen sieben kam jedoch jede Hilfe zu spät. Was mit so viel Erwartung und Freude begonnen hatte, endete als Tragödie. In dem später viel gelesenen Buch »Faith is not a feeling«, das anschließend auch in deutscher Sprache erschien (»Glaube ist kein Gefühl«), zeichnete Bailey die schrecklichen Ereignisse nach. Dabei machte sie keinen Hehl aus ihren tiefen, emotionalen Krisen, die sie erlebte. Immer wieder empfand sie große Trauer und fühlte sich von Gott verlassen. Aber sie berichtete auch, wie sie als Christin mit diesem schrecklichen Verlust umzugehen lernte. Ihre persönliche Entdeckung sei, so schreibt sie, dass Glaube kein Gefühl, sondern eine Entscheidung sei. Und sie hält fest, dass der Glaube sich nicht von schlechten Gefühlen herumreißen lassen darf, sondern sich an Gottes Wort und den darin enthaltenden Zusagen orientieren soll:
Jeder von uns hat Gefühle. Sie können uns zu Freunden oder zu Feinden werden, je nachdem, wie wir mit ihnen umgehen. Ich möchte Ihnen von einigen Kämpfen und Prüfungen berichten, die ich bestehen musste, bis ich lernte, meine Gefühle zu bändigen und zu meistern. Ich möchte Ihnen erzählen, wie ich es lernte, sie als einen Zugang zu Gottes Wort zu gebrauchen. (Bailey 2007, S. 7)
Das Buch enthält eine wichtige Botschaft, die auch heute gilt: Gefühle sind nicht neutral. Das stimmt etwa für die Traurigkeit. So kann sie echter Ausdruck eines erlittenen Verlustes sein. In einem solchen Fall gibt es keine Alternative, als diesem Gefühl auch Ausdruck zu verleihen. Von keinem Christen wird etwa in einem Todesfall erwartet, dass er sich freut und in die Hände klatscht. Dann ist nicht die Zeit, ein »Halleluja« (Lobet Gott) zu rufen, sondern ein »Kyrie eleison« (Herr, erbarme dich) zu seufzen.
Gefühle wie Traurigkeit können sich aber auch verselbstständigen und manchmal alle anderen inneren Regungen – wie etwa den Glauben – dauerhaft ersticken. Dunkle Stimmungen legen sich dann wie ein Mehltau auf den Menschen. Hier gilt die alte Weisheit, dass die entscheidende Nahrung des Glaubens das Evangelium ist. Auch wenn ich mich nicht danach fühle, so bestätigt mir die Heilige Schrift, dass ich Gottes Sohn und Tochter bin. Selbst wenn vieles dagegenspricht, so sichert mir die Verheißung zu, dass niemand mich aus Gottes Hand reißen kann. Als Christ und Christin darf ich mich dann nicht von irrlichternden Emotionen beunruhigen lassen. Darum hat der Buchtitel auch seine Berechtigung: »Glaube ist kein Gefühl.«.
 Inspiration
Inspiration
Ohne das Buch zu lesen, wird der Titel jedoch schnell missverständlich. Denn auch wenn der Glaube kein Gefühl ist, so geht er fast immer mit Gefühlen einher. Einen Glauben ohne Gefühle gibt es eigentlich gar nicht. Ein Blick ins Neue Testament untermauert diesen Standpunkt. So sind für Paulus etwa Glaube und Gefühl keine Gegensätze, sondern das eine folgt aus dem anderen. So schreibt er etwa in seinem Brief an die Gemeinde Roms: »Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist« (Römer 14,17).
Mit anderen Worten: Freudengefühl und innere Ruhe sind wesentliche Ausgestaltungen der Zugehörigkeit zu Gottes neuer Welt. Wegweisend ist für diesen Zusammenhang auch Paulus’ Darstellung der sogenannten »Frucht des Geistes« im Brief an die Galater: »Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung« (Galater 5,22-23).
Nicht alle der genannten Kennzeichen sind dem Bereich der Emotionen zuzuordnen, einige aber schon, wie etwa Freude und Frieden. Man sieht: Glaube ist kein Gefühl. Aber wie gute Früchte folgen Gefühle auf den Glauben.
Heute sind wir daran gewöhnt, scharf zwischen Denken und Fühlen zu unterscheiden. Dem biblischen Verständnis entspricht das aber nicht. Hier steht die Bezeichnung des »Herzens« im Mittelpunkt. Und in ihm denkt und fühlt der Mensch. Es war Martin Luther, der diese ganzheitliche Sicht zu seiner Zeit wieder stark betonte. Für ihn sind Verstand (lat. intellectus) und Emotionen (lat. affectus) zwar eigenständige Vorgänge, sie gehören aber eng zusammen. Und ihr gemeinsamer Ort ist das Herz. Mit dem Herzen wird gedacht und gefühlt – und nicht bloß Letzteres, wie es heute oft verstanden wird. Das Herz ist das Zentrum der Persönlichkeit. Mit dem Herzen glaubt der Mensch auch. Eine Bevorzugung des Verstandes vor den Gefühlen kennt Luther nicht. Gefühle und Intellekt sind für Luther gleichermaßen elementare Seiten des Menschseins. Mit ihnen kann sich der Mensch von Gott abwenden oder ihm zuwenden. Ein Glaube ohne Intellekt ist blind, ein Glaube ohne Gefühl ist nicht lebendig. In seiner Vorrede zum Psalter entwirft Luther ein plastisches Bild, wie massiv die Gefühle das Herz bewegen und bestürmen. Er greift dabei auf ein Bild aus der Seefahrt zurück:
Denn ein menschliches Herz ist wie ein Schiff auf einem wilden Meer, welches die Sturmwinde von den vier Orten der Welt treiben. Hier stößt her Furcht und Sorge vor zukünftigem Unfall. Dort fährt Grämen her und Traurigkeit von gegenwärtigem Übel. Hier webt Hoffnung und Vermessenheit von zukünftigem Glück. Dort bläst her Sicherheit und Freude in gegenwärtigen Gütern. (Luther, WA DB 10 I, 100,33-37)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Predigt braucht Gefühl»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Predigt braucht Gefühl» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Predigt braucht Gefühl» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.