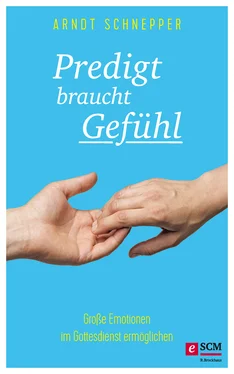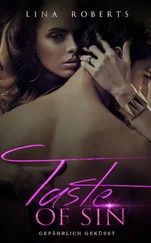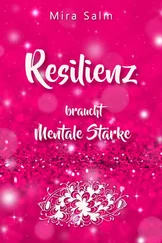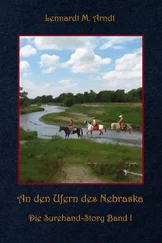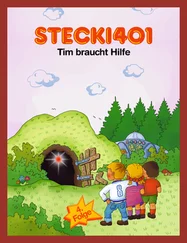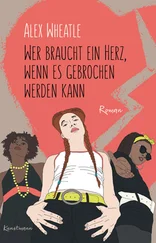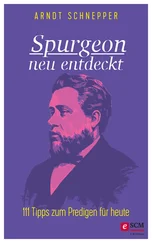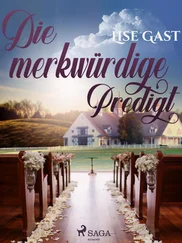Arndt Schnepper - Predigt braucht Gefühl
Здесь есть возможность читать онлайн «Arndt Schnepper - Predigt braucht Gefühl» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Predigt braucht Gefühl
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Predigt braucht Gefühl: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Predigt braucht Gefühl»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Arndt Schnepper ermutigt dazu, Gefühlen in Predigten mehr Raum zu geben – so wie es jahrhundertelang in Gottesdiensten der Fall war. Ganz praktisch zeigt Schnepper, wie Predigten ihr Ziel nicht verfehlen: den Hörer. Damit die Worte nicht nur in den Kopf, sondern auch ins Herz gehen.
Predigt braucht Gefühl — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Predigt braucht Gefühl», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Eine weitere Einsicht der Hirnforschung betrifft nun das Verhältnis von Großhirnrinde und limbischem System. Denn hier gibt es eine klare Rangordnung: Das limbische System ist viel einflussreicher als die Großhirnrinde. Die emotionalen Schaltstellen steuern sehr viel stärker die Verstandesebene als umgekehrt. Diesen biologischen Befund kann man jederzeit an sich selbst nachvollziehen. Zum einen haben die Gefühle einen mächtigen Partner, nämlich unseren Körper. Viele unserer Emotionen, die sich im Kopf bilden, werden von körperlichen Erscheinungen begleitet. So kann unser Herz vor Freude hüpfen oder vor Angst rasen. Die Sorge vermag uns niederzudrücken, die Gewissheit schenkt uns einen aufrechten Gang. Bei innerer Unruhe bilden sich Falten auf unserer Stirn. Empfinden wir Glück, dann lächeln wir und fangen an zu strahlen. Zum anderen treffen wir viele unserer wichtigen Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Auch wenn wir alles sachlich durchdenken und die Argumente gegeneinander abwägen, gibt meistens unser Gefühl den Ausschlag. Denn das Leben verläuft anders als Mathematik oder Geometrie.
Blicken wir nun wieder auf die Predigt: Wenn sie Resonanz finden soll, dann muss sie dem Menschen entsprechen. Nicht dem Menschen, wie er im Idealfall sein sollte, sondern dem, der er in Wirklichkeit ist. Mit anderen Worten: Zuerst müssen die Schallwellen einen Weg durch das Gehör finden – das ist die leibliche Ebene. Das Gesagte muss sodann vom Gehirn verarbeitet und verstanden werden können – das ist die kognitive Dimension. Und das Geäußerte muss schließlich vom limbischen System als bedeutungsvoll empfunden werden – das ist die emotionale Bedingung. Fehlt der Predigt eine der drei Facetten, dann fehlt ihr Wesentliches. Ja, ein anschließendes Wirken wird fast unmöglich gemacht.
Natürlich gibt es auch hier die berühmten Ausnahmen, etwa wenn Gott eine Eselin zu Bileam sprechen lässt (4. Mose 22,28). Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Und so ist es auch einzuordnen, wenn eine ziemlich schlichte und schlechte Predigt manchmal doch zu viel Nachdenken anregen kann. Oder wenn es passiert, dass eine emotionslose und langweilige Andacht zu heftigen Erschütterungen führt. Solche Fälle gibt es immer wieder, aber sie sind und bleiben eher selten. Damit Gott durch Predigten wirken kann, müssen Prediger und Predigerinnen von außen nach innen die Voraussetzungen hierfür schaffen.
 Praxis
Praxis
Doch wie sehen Predigten heute bei uns aus? Welche der drei genannten Faktoren werden möglicherweise bei uns vernachlässigt? Das ist natürlich eine Frage, die sich pauschal so nicht beantworten lässt. Ich wüsste auch nicht, wie man das messen sollte. Zu unterschiedlich sind kirchliche Traditionen, zu individuell auch die vielen Predigerinnen und Prediger. Dennoch gibt es Indizien, die in eine gewisse Richtung weisen.
Beginnen wir mit dem ersten Rahmenfaktor, also der akustischen Vernehmbarkeit. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war das eine riesige Herausforderung. Wohl traten immer wieder Prediger wie der mittelalterliche Berthold von Regensburg (1220–1272) auf, die zu vielen Tausend Zuhörern auf freiem Feld reden konnten. Doch sie waren echte Ausnahmeerscheinungen. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts musste der durchschnittliche Prediger zeit seines Lebens seine Stimme in Form halten, um im Kirchenraum durchzudringen. Viele Predigten werden die letzten Reihen nicht mehr erreicht haben. Und viele schwerhörige Menschen werden kaum etwas verstanden haben. Das änderte sich schlagartig mit der Einführung des Lautsprechers. Seitdem ist die Akustik überall gewährleistet. Das Schlimmste, was heute mancher Gemeinde am Sonntag zustoßen könnte, wäre ein Stromausfall.
Und wie steht es um den zweiten Faktor – das Verstehen? Erfahrungsgemäß ist das ein weites Feld. Das formale Verständnis ist ja in vielen Fällen gegeben. Wachse ich in Deutschland auf, dann verstehen mich dort die allermeisten Menschen, darüber hinaus auch in Österreich und der Deutschschweiz. Wenn wir nun das formale Verstehen der Sprache voraussetzen, so bleibt die Herausforderung, einmal die Bibel an sich zu verstehen, sodann die Zuhörer und ihre Hintergründe zu kennen und dann auch noch eine Brücke zwischen beiden zu schlagen. Für das Verständnis der Heiligen Schrift bieten sich theologische Zweige wie die Hermeneutik, die Exegese, die Sprachwissenschaften und die Geschichtswissenschaften an. Die Menschen und ihre Lebensverhältnisse versuchen wir mit den Sozialwissenschaften besser zu verstehen: Hier stehen Psychologie, Soziologie oder Pädagogik zur Verfügung. Wer predigt, wird immer versuchen, neue Einsichten dieser Forschungszweige in Anspruch zu nehmen.
Bleibt noch die dritte Bedingung der menschlichen Wahrnehmung: das Fühlen. Und hier wird schnell deutlich, dass es sich dabei meist um ein unbekanntes Terrain handelt. Natürlich nicht in dem Sinne, dass man von diesem Land des menschlichen Lebens überhaupt nichts wüsste. Schließlich gehört ein psychologisches Grundwissen heute zu einer Art Grundausbildung. Das Land der Gefühle ähnelt einem mehr oder weniger gut kartografierten Gelände. Man weiß darum Bescheid – aber man begibt sich dort nicht hinein. Man hat von den Emotionen und Motivationen gehört, ist aber zögerlich, sie für die Predigt nutzbar zu machen. Man spricht über die Gefühle ohne viel Gefühl – das kann nicht gut gehen.
Noch gelten die Emotionen vielen Predigern und Predigerinnen als zu vernachlässigende Faktoren. Für manche ist es geradezu ein hohes Ideal, Predigten ohne viel Gefühl zu halten. Denn der Glaube an den dreieinigen Gott, so die Annahme, sei ja schließlich auch kein Gefühl. Der Verstand erscheint ihnen als der Haupteingang zur menschlichen Seele. Und auch wenn Prediger im Gefolge einer reformatorischen Theologie der Vernunft nicht allzu viel zutrauen, so operieren sie doch weitestgehend immer mit denkerischen Mitteln. Man interpretiert, argumentiert, strukturiert, formuliert und definiert – so will man die Menschen erreichen.
Doch der Wind dreht sich. Hier und da spricht man in den Wissenschaften von einem »emotive turn«, also einer Wendung hin zu den Emotionen. Sie rücken heute mehr und mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit. Und das ist keineswegs eine Stilfrage. Für die Predigt geht es ums Überleben. Denn die Frage ist, ob wir mit der einseitigen Ausgestaltung der Predigt dem Menschen gerecht werden. Predigen wir menschlich, also mit Verstand und Gefühl? Falls nicht, predigen wir am Menschen vorbei.
Christus – der Meisterprediger
 Eindruck
Eindruck
Am Anfang der christlichen Predigt steht Jesus Christus. Folgt man den Berichten der vier Evangelisten, war die öffentliche Rede eine seiner vornehmsten Tätigkeiten. Mal sprach er im kleinen Kreis, mal vor vielen Menschen. Manchmal stieß er auf vehemente Ablehnung, andere Male erlebte er enormen Zuspruch. In der Summe lösten seine Predigten eine Bewegung aus, die bis heute weiterlebt. Was er sagte und was die Evangelisten dann später schriftlich festhielten, bildet heute einen wesentlichen Teil des Neuen Testaments. Wenn wir heute danach fragen, wie wir predigen sollen, darf eine Orientierung an Jesus nicht fehlen.
Doch wie predigte Jesus eigentlich? Bekanntlich ist die Zahl der Veröffentlichungen zur Frage, was genau Jesus predigte, Legion. Heerscharen von Theologen unternehmen immer wieder aufs Neue den Versuch, seine überlieferten Aussagen zu verstehen und zu verorten. Sehr viel übersichtlicher wird es aber, wenn wir die Frage stellen, wie Jesus predigte. Das liegt daran, dass in keinem der Evangelien etwas darüber berichtet wird. Lässt sich daher überhaupt etwas zu seiner Predigtweise sagen? Bereitete Jesus sich etwa vor oder sprach er spontan? Hatte er auch die Gefühle seiner Zuhörer im Blick? Finden wir bei ihm eine Rücksicht auf die drei skizzierten Voraussetzungen, unter denen Predigt überhaupt gelingen kann? Es lohnt sich, die Evangelien auf diese Frage hin ein wenig näher zu betrachten.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Predigt braucht Gefühl»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Predigt braucht Gefühl» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Predigt braucht Gefühl» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.