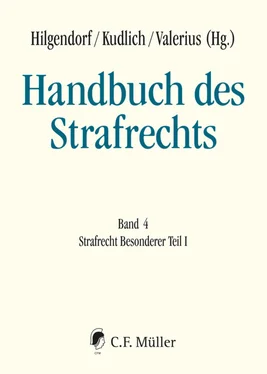f) Mordmerkmale § 211 Abs. 2 StGB – 2. Gruppe
27
Mordmerkmale der „2. Gruppe“ des § 211 Abs. 2 StGB sind Heimtücke, Grausamkeit und gemeingefährliche Mittel. Gemeinsames Charakteristikum der drei Merkmale ist die besondere Ausführungsweiseder Tötungshandlung.[136]
28
Dafür, dass § 211 StGB heftig in der Kritik steht und als dringend reformbedürftig eingeschätzt wird, gibt es mehrere Gründe. An erster Stelle steht die Starrheit der absolut gesetzten lebenslangen Freiheitsstrafe, also die Sanktionsregelung. Auf der Tatbestandsebene ist es neben der Beweggrundgeneralklausel das Merkmal „Heimtücke“, das dafür sorgt, dass die geltende Fassung des Mordparagraphen quasi unter Dauerbeschuss gesetzeskritischer Literatur steht.[137] Gleichwohl wollte die von Justizminister Maas eingesetzte Expertengruppe nicht die Streichung des Merkmals empfehlen. Zur Erklärung der Mordtauglichkeit dieses Tatmerkmals wird auf die „besonders gefährliche Tatausführung“ verwiesen.[138] Dies trifft zwar zu, ist aber ungenau und erklärt gar nichts. Denn jede erfolgreiche Tötung ist ex post betrachtet eine besonders gefährliche Vorgehensweise. Die spezifische „besondere Gefährlichkeit“ der heimtückischen Tötung besteht darin, dass sie auch physisch starke und robuste Menschen in die Lage bringen kann, gegenüber Angriffen physisch an sich unterlegener Täter chancenlos zu sein. Heimtückische Tötung gilt deswegen auch als Methode der Schwachen, nicht zuletzt von Frauen gegenüber männlichen Opfern („Haustyrannentötung“).[139] Gewiss schwingt bei der Bewertung der heimtückischen Tötungsweise als besonders „verwerflich“ auch archaische Verachtung des Täters mit, der sein Opfer „feige“ von hinten meuchelt, weil er sich nicht traut, seinem Gegner mutig und offen im Kampf „Mann gegen Mann“ zu begegnen. Es ist richtig, dass heimtückische Tötungen das Sicherheitsgefühl der Menschen erschüttern, weil der Angriff auf das Leben jäh und unvorhergesehen in einer Situation stattfindet, in der das Opfer sich sicher fühlt.[140] Heimtückische Tötung unterläuft den Selbstschutz des Opfers in besonders perfider Weise. Denn um sein Leben zu schützen, nützt es nichts Warnungen zu befolgen und bestimmte durch äußere Gefährlichkeitsindizien hinreichend gekennzeichnete „no go areas“ zu meiden,[141] wo man sich „seines Lebens nicht sicher“ sein kann. Die heimtückische Tötung trifft das Opfer an einem Ort und zu einer Zeit, wo und wann mit einer solchen Attacke nicht gerechnet werden muss. Die Heimtücke unterminiert das gegenseitige Vertrauen, das Menschen in einer Gesellschaft brauchen, um halbwegs frei und unbefangen miteinander kommunizieren und sich aufeinander einlassen zu können. Hinreichende Gründe, der heimtückischen Tötung den Rang eines höchststrafwürdigen Verbrechens zuzuweisen, sind also durchaus vorhanden. Die Schwierigkeit bei der Anwendung einer Strafnorm mit diesem Merkmal besteht darin, Einzelfälle auszusondern, denen der Höchststrafwürdigkeitsgehalt fehlt.
29
Das Gesetz definiert nicht, was unter „Heimtücke“ oder „heimtückisch“ zu verstehen ist. In Rechtsprechung und Schrifttum ist seit langem folgende Umschreibung anerkannt: Heimtückisch tötet, wer die Arg- und Wehrlosigkeitdes Opfers zur Tötung ausnutzt.[142] Die Definition bildet zwar das Wesen der Heimtücke zutreffend ab und ist Rückgrat des Begriffs, für eine am Verhältnismäßigkeitsgebot orientierte Rechtsanwendung aber zu weit. Das zu erkennen hatte der BGH schon früh die Gelegenheit und fügte der Definition das einschränkende Element der „feindseligen Willensrichtung“ hinzu.[143] Vor allem Fälle der „Haustyrannentötung“ machen aber deutlich, dass auch mit dieser zusätzlichen Komponente der Heimtückedefinition immer noch Tötungen erfasst werden, die nicht höchststrafwürdig sind und deren Sanktionierung nach § 211 StGB unverhältnismäßig ist.[144] Restriktionsvorschläge der Literatur – insbesondere der „verwerfliche Vertrauensbruch“[145] – leiden an dem Dilemma, dass sie dem § 211 StGB Fälle entziehen, deren Mordqualität nicht zu bestreiten ist. Egal, wie man zu dem Mordmerkmal „Heimtücke“ steht: Der geltende § 211 StGB zwingt zu einem Kurs zwischen Scylla und Charybdis. Dem kann nur der Gesetzgeber abhelfen. Die Elemente „Arglosigkeit“, „Wehrlosigkeit“ und „Ausnutzen“ stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern zueinander in einer funktionalen Beziehung. Das Opfer ist wehrlos, weil es arglos ist, Wehrlosigkeit ohne Arglosigkeit oder nicht auf Arglosigkeit beruhende Wehrlosigkeit begründen also keine Heimtücke. Die Ausnutzung der Lage des Opfers äußert sich in der herabgesetzten Verteidigungsfähigkeit des Opfers und der dadurch bewirkten Erleichterung der erfolgreichen Tatbegehung. Arglos ist ein Opfer, das mit einem Angriff auf sein Leben nicht rechnet.[146] Kündigt der Täter dem Opfer an, dass er es sogleich töten werde, entfällt die Arglosigkeit. Daher ist für die Anwendung des § 211 StGB entscheidend, zu welchem Zeitpunkt die Arglosigkeit des Opfers bestehen muss, damit heimtückische Tötung gegeben ist. Grundsätzlich kommt es auf Arglosigkeit bei Versuchsbeginn (§ 22 StGB) an.[147] Hat das Opfer bereits zu diesem Zeitpunkt eine hinreichend konkrete Ahnung von der bevorstehenden Attacke, kann seine Tötung nicht heimtückisch sein. Ausnahmsweise soll ein Schwund der Arglosigkeit vor diesem Zeitpunkt unbeachtlich sein, wenn der Täter sein Opfer arglistig in eine Falle gelockt hat und ihm anschließend beim Beginn der unmittelbaren Tötungshandlung offen feindselig gegenüber tritt.[148] Als grobe Richtlinie ist das Abstellen auf den Beginn des Tötungsversuchs hilfreich. Eine sklavische Bindung an die Versuchsdogmatik kann hingegen keine Lösung sein, da die Vielgestaltigkeit von Versuchskonstellationen gepaart mit der Uneinheitlichkeit der Ansichten zum Versuchsbeginn in Literatur und Rechtsprechung zu vollkommen verfehlten Ergebnissen führen kann. Bei einem in mittelbarer Täterschaft begangenen Mord hinge die Erfüllung des Mordmerkmals Heimtücke gegebenenfalls davon ab, ob das unmittelbare Ansetzen an das zeitlich frühere Handeln des „Hintermannes“[149] oder das spätere Handeln des „Werkzeugs“[150] gekoppelt wird. Sieht das Opfer den vom mittelbaren Täter aufgehetzten geisteskranken Tatmittler schon von weitem mit einem Messer in der Hand anrücken, liegt nach der zum Versuchsbeginn bei mittelbarer Täterschaft vertretenen „Einzellösung“ Heimtücke vor, nach der „Gesamtlösung“ hingegen nicht. Es ist evident, dass in diesem Fall ein Opfer angegriffen wird, das nicht arglos ist und demzufolge auch nicht heimtückisch getötet wird, sollte es zur Tötung kommen. Diese Beurteilung kann aber nicht davon abhängig sein, welche Ansicht man im Streit um den Versuchsbeginn bei mittelbarer Täterschaft bevorzugt. Ebenso liegen die Dinge bei einer actio-libera-in-causa-Tat: wer – wie Roxin [151] – das unmittelbare Ansetzen schon in der Herbeiführung des Rauschzustandes sieht, müsste heimtückische Tötung bejahen, auch wenn das Opfer die Tötungsabsicht des Volltrunkenen frühzeitig erkennt. Nach der h.M. beginnt der alic-Versuch hingegen erst, wenn der schuldunfähige Täter in die unmittelbare Tatausführungsphase eintritt.[152] Das zu diesem Zeitpunkt nicht mehr arglose Opfer kann nicht heimtückisch getötet werden. Schwierigkeiten bereitet das unmittelbare Ansetzen als Richtschnur auch in Fällen des Mordes durch Unterlassen, vorausgesetzt man hält die Verwirklichung des Heimtücke-Merkmals durch garantenpflichtwidriges Unterlassen überhaupt für möglich.[153] Da dem Garanten oftmals ein längerer Zeitraum für die Erfüllung der Handlungspflicht zur Verfügung steht und nach h.M. der Versuch nicht schon mit dem Verstreichenlassen der frühestmöglichen Handlungsgelegenheit beginnt,[154] kann der Täter die Arglosigkeit des Opfers vor Überschreiten der Versuchsgrenze beseitigen, indem er ihm z.B. ankündigt, dass er es verhungern lassen werde. Eine solche Vorgehensweise würde allerdings das Mordmerkmal „grausam“ erfüllen.
Читать дальше