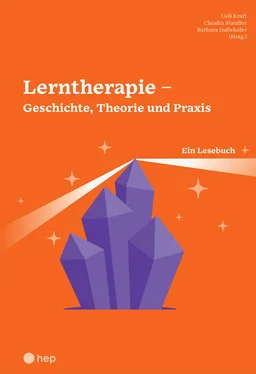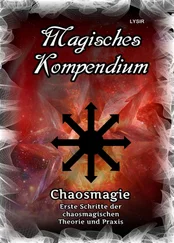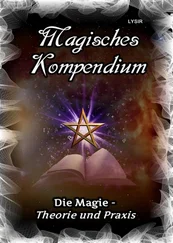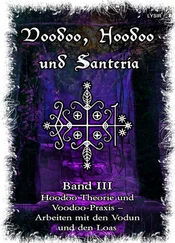All dies erzählt Sophia freimütig und unbefangen, insgesamt wirkt sie recht heiter. Nun übernimmt die Mutter das Wort und erzählt:
Sie lerne viel mit Sophia zusammen. Damit das möglich ist, hat die dreiköpfige Familie den Alltag umgestellt: Früher gab es ein kaltes Mittag- und ein warmes Abendessen, nun gibt es für die dreiköpfige Familie ein warmes Mittagessen, das die Mutter am Morgen, wenn Sophia in der Schule ist, vorkocht, am Abend gibt es ein kaltes Abendessen, am Nachmittag lernt sie mit ihrer Tochter. Die Mutter tritt dabei recht engagiert auf; sie beschreibt, wie sie zusammen mit Sophia lernt, und sagt bezüglich des Faches Biologie: «Wir lernen das so», und führt dann aus, dass sie mit Sophia den Lernstoff zusammenfasst, Sophia diesen dann auswendig lernt und die Mutter sie schliesslich darüber abfragt. Vielleicht aber, so meint die Mutter, gebe es ja bessere Methoden, das sei eben ihr Anliegen an die Lerntherapeutin: professionelle Unterstützung im Bereich von Lerntechnik und Lernstrategien, dies im zeitlichen Rahmen von fünf Stunden, da die Finanzierung der Lerntherapie für die Familie doch eine Budgetbelastung darstelle.
Hier schaltet sich der Vater ins Gespräch ein und meint, dass sie alle beim Wechsel ins Gymnasium «auf die Welt gekommen» seien. Es sei doch eine grosse Umstellung hinsichtlich der Anforderungen. Sophia müsse nun aber halt selbst «den Knopf aufmachen und sich durchbeissen».
Sophia verhält sich während der Ausführungen der Eltern sehr ruhig, sagt kaum etwas. Sie wirkt aber keineswegs bedrückt, sondern vielmehr als aufmerksame und interessierte Zuhörerin.
Welche Informationen erhält die Lerntherapeutin nun aufgrund dieses Erstgesprächs?[22] Da sind zunächst einmal die Aussagen zu den konkreten Lernschwierigkeiten , die wie folgt zusammengefasst werden können: Sophia bekundet Schwierigkeiten beim Nachvollzug mathematischer Erklärungen und im Französisch fehlt ihr wohl ein Teil des nun erwarteten Vokabulars; zudem hat sie Mühe beim Lesen und Verstehen von Sachtexten, beim Memorieren von Jahreszahlen sowie beim Erarbeiten von umfangreichen Stoffmengen. Diese Schwierigkeiten bestehen seit dem Wechsel von der Sekundarstufe I ins Gymnasium und äussern sich in Form von ungenügenden Noten.
Welche Auswirkungen haben diese Schwierigkeiten auf Sophia? Da die Promotion gefährdet ist, steht sie, die am Gymnasium bleiben möchte, zwar unter einem gewissen Leistungsdruck, sie reagiert darauf aber nicht mit psychosomatischen Beschwerden – diesbezüglich scheint sie also stabil zu sein. Hinsichtlich der Auswirkungen der Lernschwierigkeiten auf das Umfeld, die Familie sind dann aber doch recht grosse Veränderungen zu verzeichnen: Der Familienalltag wurde umorganisiert, so dass die Mutter mit Sophia lernen kann, und das heisst ja auch, dass die Mutter und Sophia aufgrund des gemeinsamen Lernens mehr Zeit miteinander verbringen. Zudem kann auch vermutet werden, dass die Mutter, die über keinen Gymnasialabschluss verfügt, selber auch einiges für sie Neues erlernt. Der Vater, der einen handwerklichen Beruf ausübt, bleibt hingegen bei diesem Lernsetting von Mutter und Tochter aussen vor, ist dabei eher ein passiv Beteiligter. Indem sich die Lerntherapeutin nach dieser Bestandsaufnahme nun nach dem Warum von Sophias Lernschwierigkeiten fragt, und damit sowohl deren mögliche Gründe wie auch deren potenziellen Sinn und Nutzen meint, formuliert sie eine vorläufige Hypothese.
4.2.1 Eine erste vorläufige Hypothese
Es kann gut sein, dass Sophia von den höheren Anforderungen, die nun am Gymnasium an sie gestellt werden, sowohl kognitiv wie auch bezüglich der Lerntechniken und Lernstrategien ziemlich stark gefordert ist. Es kann auch sein, dass die Umstellung an sich, sich in eine neue Lernumgebung einleben zu müssen (neues Schulhaus, neue Lehrpersonen, neue Fächer, neue Klasse) für Sophia nicht einfach ist – darauf deuten gleich mehrere ihrer Aussagen: Biologie sei für sie ein neues Fach, Fremdwörter, also: ihr fremde Wörter, würden ihr Schwierigkeiten bereiten wie auch die Aussage, dass sie trotz grundsätzlich gutem Orientierungssinn immer noch Mühe habe, sich im Schulhaus zurechtzufinden. So betrachtet kann es auch sein, dass die Umstellung, der Schritt von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II an die weiterführende Schule bei Sophia Unsicherheit und Angst auslöst und sie darauf mit Regression reagiert, und das heisst, dass sie bereits erworbene Positionen der Reife aufgibt und sich auf eine frühere Position zurückzieht, in der sie wieder vermehrt mütterliche Zuwendung und Pflege erfährt. Darin würde dann auch Sinn und Nutzen der Lernschwierigkeit bestehen: Sie und ihre Lernschwierigkeiten geben zu reden, sie erhält von mehreren Personen viel Aufmerksamkeit, in der Familie wurde der Ablauf extra für sie umgestellt, auf dass ihre Mutter sich wieder intensiv um sie kümmern kann. Angesichts dieses Nutzens, den Sophia aus ihren Lernschwierigkeiten ziehen kann, stellt sich der Lerntherapeutin die Frage, ob denn Sophia den «Knopf» überhaupt aufmachen will, wie es der Vater ja von ihr fordert. Die Frage nach dem Nutzen der Lernschwierigkeit stellt sich aber nicht einzig in Bezug auf Sophia; sie stellt sich ebensosehr in Bezug auf die Mutter: Beim gemeinsamen Lernen – sie meinte ja: «Wir lernen das so» – erweitert sich auch das Wissen der Mutter und das scheint etwas für sie zu sein, was ihr zusagt, sonst würde sie wohl kaum den tradierten Tagesablauf umstellen, und von ihr kam auch die Frage, ob es bessere Lerntechniken gebe. Und nicht zuletzt gilt es auch zu fragen, ob die Mutter denn überhaupt will, dass Sophia diesen «Knopf», mittels dessen sie ihrer Tochter derart verbunden bleiben kann, auflöst.
4.2.2 Lernschwierigkeiten als Symptom
Diese Überlegungen zu potenziellem Sinn und Nutzen der Lernschwierigkeiten weisen darauf hin, dass diese auch Symptomcharakter haben können. Was aber ist ein Symptom? Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, versteht unter einem Symptom das Produkt einer erfolgreichen Verdrängung und bezeichnet mit Verdrängung den folgenden psychischen Vorgang: Das Subjekt wird von Gedanken, Bildern, Erinnerungen heimgesucht, deren Befriedigung ihm zwar Lust bereiten würden, zugleich aber würde diese Triebbefriedigung im Bewusstsein des Ichs Unlust hervorrufen (Freud, 1915). Im Fall von Sophia könnte das heissen, dass sie in der aktuellen Situation der weiterführenden Schulstufe, die sie als kognitive Herausforderung erlebt und die sie auch bildungsmässig weiter weg von ihren Eltern führt, eigentlich lieber wieder zurück in eine frühere Lebensphase möchte, dass in ihr der unbewusste Wunsch nach mütterlichem Schutz und mütterlicher Nähe wirkt. Dieser Wunsch kollidiert aber mit dem Wunsch, am Gymnasium bleiben zu können und schulischen Erfolg zu haben. Aus dieser psychodynamischen Perspektive betrachtet sind Sophias Lernschwierigkeiten ein Symptom und das heisst, sie sind das Produkt einer erfolgreichen Verdrängung: Die Schulschwierigkeiten ermöglichen es ihr, wieder viel Zeit zusammen mit der Mutter zu verbringen, sie erhält wieder viel Zuwendung von ihr und steht ganz klar im Zentrum der Familie.
4.2.3 Die gemeinsame Arbeit am Symptom
Was aber macht nun der Lerntherapeut mit dieser vorläufigen Hypothese? Er behält sie vorerst einmal für sich, denn würde er die Familie schon jetzt damit konfrontieren, wäre es wohl wirklich eine Kon-frontation: Er würde die Familie, die davon ausgeht, dass Sophias Schwierigkeiten das Resultat fehlender Lerntechniken und -strategien sind, mit dieser These vor den Kopf stossen, ist doch im Erstgespräch seitens der Familie in keiner Weise erwogen worden, dass die Lernschwierigkeiten auch psychodynamisch bedingt sein könnten.[23] In einer Lerntherapie muss diese Sichtweise der Lernschwierigkeit als (potenzielles) Symptom mit dem Ratsuchenden oftmals allererst erarbeitet werden, das macht auch einen der Unterschiede zur Psychotherapie aus. Es darf jedoch nicht vergessen werden: Bei den oben genannten Überlegungen handelt es sich zunächst um eine Vermutung, keinesfalls um gesichertes Wissen des Lerntherapeuten. Die vorläufige Diagnose dient Lerntherapeuten vielmehr als eine Spur, auf die er in den weiteren Sitzungen und Gesprächen mit Sophia achten wird. Dieses Sich-Achten-auf muss sich aber davor hüten, die Wahrnehmung zu sehr auf diese eine Spur auszurichten, es kann nämlich auch sein, dass sich die vorläufige Hypothese als eine nicht zutreffende erweisen wird. Der Lerntherapeut, die Lerntherapeutin muss also offen sein für das, was sich in den Sitzungen und in den Gesprächen mit dem Gegenüber ereignet.
Читать дальше