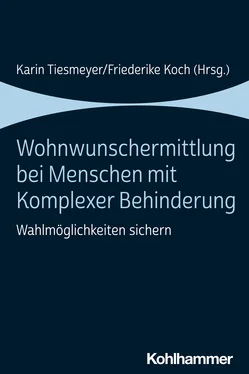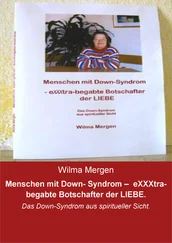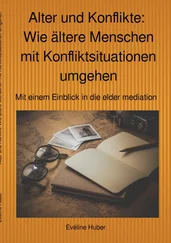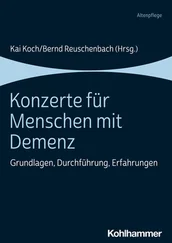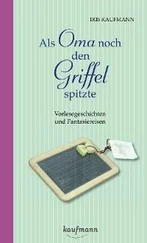3. Frau Prof. Dr. Gudrun Dobslaw (FH Bielefeld) hat als externe Wissenschaftlerin die partizipative Gestaltung der Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse mit den Selbstvertretungsgruppen und den Projektbeteiligten auf Basis von Videoaufzeichnungen ausgewählter Eingangs- und Abstimmungssequenzen aus den Beratungssitzungen kritisch überprüft. Dies wurde in gemeinsamen Sitzungen mit dem Projektteam reflektiert, so dass die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die weitere Ausgestaltung einbezogenen werden konnten.
4. Die partizipative Gestaltung der Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse wurde zudem in den Projektsitzungen und in halbjährlichen Sitzungen mit dem Bochumer Zentrum für Disability Studies (BODYS) – einer Forschungseinrichtung der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe für menschenrechtsorientierte, partizipative und intersektionale Forschung und Lehre, in dem das Projekt angesiedelt war – kritisch reflektiert.
5. Zu einigen Fragestellungen wurden ad-hoc-Fokusgruppen mit beteiligten Klient*innen sowie deren Bezugsmitarbeitenden durchgeführt, um gemeinsam wesentliche Elemente eines Prozesses der Wohnwunschermittlung zu identifizieren und Rückschlüsse für weitere Prozesse zu ziehen.
6. Zur Präsentation und Diskussion der Projektergebnisse wurden schließlich alle beteiligten Personengruppen zu einer inklusiven Fachtagung im November 2019 eingeladen: die Klient*innen, Angehörige, Mitarbeitende und Führungskräfte aus der Eingliederungshilfe, Vertreter*innen von Sozialleistungsträgern, Mitarbeitende aus kommunalen Beratungsstellen sowie Wissenschaftler*innen unterschiedlicher Disziplinen. Die Projektergebnisse wurden über verschiedene Formate vorgestellt: klassische Vorträge, Dialoge mit Bildern der Leichten Sprache, Thementische zur gemeinsamen Bearbeitung verschiedener eingesetzter Methoden und Materialien etc. Wenn auch in Bezug auf die wissenschaftlichen Vorträge nicht davon auszugehen war, dass alle Anwesenden allen Inhalten folgen konnten, so sprach doch die fröhliche und zugewandte Atmosphäre für sich: Alle Projektbeteiligten waren dabei und die Bezugspunkte für alle vorgestellten Inhalte bildeten die Personen, deren Wohnwünsche im Projekt erhoben worden waren.



Eine filmische Dokumentation der Abschlusstagung ist auf der Projekthomepage: www.wahlmöglichkeiten-sichern.de/projektabschlusszu sehen.
Neben der konsequenten Beteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen wurde während der gesamten Projektlaufzeit der fachliche Austausch und Transfer mit verschiedenen Professionen und Personengruppen sichergestellt. Projekt-(Zwischen-)Ergebnisse wurden daher in verschiedenen Formaten diskutiert, um einerseits Rückmeldungen einzuholen und andererseits einzelne Ergebnisse und daraus resultierende Schlussfolgerungen einer (Teil-)Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen:
1. In zwei ganztägigen Expert*innenworkshops mit Projektbeteiligten und Expert*innen unterschiedlicher Fachdisziplinen aus Hochschulen und Praxisfeldern wurden die Projektergebnisse vorgestellt und diskutiert. Im ersten Workshop im Juni 2017 wurden die bis dahin im Projekt recherchierten Instrumente zur Erhebung von Wohnwünschen (vgl. Bössing et al. 2020) in Bezug auf ihre Anwendung mit Menschen mit Komplexer Behinderung geprüft. Folgende Ansätze wurden diskutiert:
a) Persönliche Zukunftsplanung
b) »Teilhabekiste«
c) IHP-3 (LVR)
d) Persönliche Lebensstilplanung
e) Unterstützungskreise
f) Sozialraum- und Netzwerkorientierung
g) Peer Counseling
Zusammenfassend wurde festgehalten, dass die zur Verfügung stehenden Methoden zur Wohnwunscherhebung bislang noch nicht hinreichend auf die Situation von Menschen mit Komplexer Behinderung hin angepasst waren. Für die Gestaltung der Prozesse wurde dem Projektteam daher empfohlen, die Ansätze – im Sinne einer echten Personenzentrierung – individuell auf die Person hin auszurichten. Elemente aus der Persönlichen Zukunftsplanung wie auch aus der individuellen Lebensstilplanung wurden dazu als geeignete Grundlagen identifiziert.
Unterstützungskreise, Sozial- und Netzwerkorientierung bzw. -analyse sowie die Einbindung von »Peer-Erfahrung« wurden – ebenfalls jeweils angepasst an die individuelle Situation – als weitere wichtige Aspekte konsentiert. Insbesondere die angemessene und systematische Einbindung von »Peer-Erfahrungen« war bisher noch nicht hinreichend untersucht, so dass diesem Aspekt in der Erprobung und Evaluation besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.
Im zweiten Workshop im Juni 2018 wurden folgende Projektzwischenergebnisse vorgestellt und diskutiert:
a) die Ergebnisse einer Interviewstudie mit Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf sowie Fachkräften, deren Fokus auf den Erfahrungen mit bisherigen Wohnveränderungen lag
b) das methodische Vorgehen sowie die Erkenntnisse aus den ersten Prozessen der Wohnwunscherhebung
Die Diskussion brachte wertvolle Hinweise für die Wohnwunscherhebung mit Menschen mit Komplexer Behinderung, die sich drei Kategorien zuordnen ließen:
a) Hinweise für die praktische Umsetzung des Projekts
b) Hinweise an die Organisation/Bethel.regional
c) Hinweise an die Forschung
Über die Methode der Live-Visualisierung entstand ein anschauliches Protokoll der wesentlichen Erkenntnisse des Workshops.
2. Das ebenfalls von der Stiftung Wohlfahrtspflege geförderte Projekt »Wohnen selbstbestimmt« ( www.wohnen-selbstbestimmt.de) hatte zum Ziel, Empfehlungen für Politik und Gesellschaft zu formulieren, um für alle Menschen unabhängig vom Grad der Behinderung das in der UN-BRK verbriefte Recht auf die freie Wahl des Wohnorts zu gewährleisten. Ein Austausch zwischen beiden Projekten wurde über die jeweiligen Projektleitungen sichergestellt. Darüber hinaus beteiligten sich Mitarbeitende des Projekts »Wahlmöglichkeiten sichern!« im Mai 2018 an einer Expert*innen-Gruppe aus Politik, Wissenschaft, Praxis, Bau- und Finanzwesen zu den Grundlagen für die Finanzierung von Unterstützungskonzepten in selbstbestimmten Wohnformen.
3. Anlass für den Fachaustausch im Herbst 2018 mit der Beratungsstelle Unterstützte Kommunikation im Geschäftsbereich Behindertenhilfe der Ev. Stiftung Hephata waren deren Erfahrungen a) mit Methoden der Unterstützten Kommunikation b) mit dem Instrument der »Teilhabekiste« c) mit der »Persönlichen Zukunftsplanung«, die dort bereits seit 2014 flächendeckend zur Bedarfsermittlung genutzt wurde. Deutlich wurde, dass viele der Projekterkenntnisse durch die Praxiserfahrungen in Hephata gestützt wurden, z. B.:
a) Die einzelnen Bedarfsermittlungs-Prozesse waren nach Inhalt und Dauer sehr individuell.
b) Methoden aus dem Bereich der Unterstützten Kommunikation konnten auch in den Prozessen der Persönlichen Zukunftsplanung gut eingesetzt werden.
c) Für die Erhebungen erwies sich ein Pool an Methoden, der individuell auf die Person angepasst wird, als sinnvoll.
Insgesamt wurde von vielen positiven Entwicklungen bei Menschen mit Komplexer Behinderung und einem deutlichen Rückgang herausfordernden Verhaltens berichtet, was im Wesentlichen darauf zurückgeführt wurde, dass jegliche Willens- und Wunschäußerung der planenden Person wertfrei ernstgenommen und wertgeschätzt wurde. Die Person wurde als Gegenüber, als soziale Person mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt gestellt.
4. Mitte Juli 2019 wurde ein Fachaustauch mit zwei ausgewiesenen Moderator*innen für Zukunftsplanung aus Hamburg initiiert. Im Schwerpunkt ging es darum, die Erfahrungen mit Unterstützungskreisen aus dem Projekt zu reflektieren. Folgende Fragen wurden auf Grundlage von Praxisbeispielen reflektiert und beraten:
Читать дальше