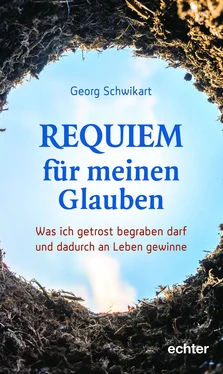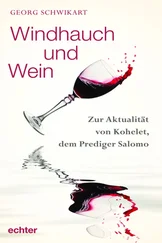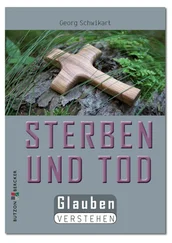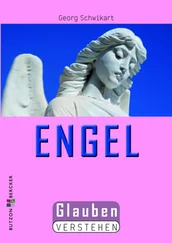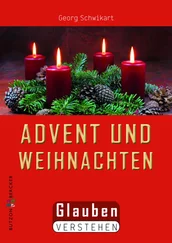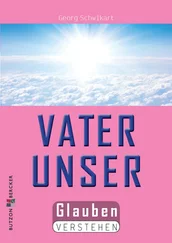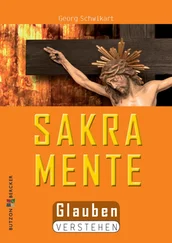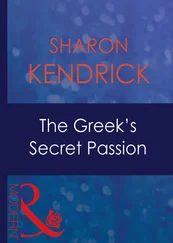Früher hieß es in der Trauerbegleitung, man müsse die Verstorbenen loslassen. Das sagen wir schon lange nicht mehr, denn sie gehören dennoch zu uns. So ist es auch nicht ganz leicht, sich von Glaubenssätzen zu trennen. Aber es ist notwendig.
Wem nahegelegt wurde: „Du kannst das nicht“ oder „Das ist nichts für dich“, der muss sich von diesen Botschaften lösen und sie begraben unter zwei Metern Erde, sonst kann er sich als Mensch nicht entfalten. Auch in meinem Glauben gab es Botschaften, die mich auf der Wanderung zu Gott nicht förderten, sondern hinderten. Sie darf ich getrost begraben. Hiermit werfe ich ein paar Blumen nach.
„Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.“ Diese Zeile aus dem Lied „Großer Gott, wir loben dich“ schmettere ich an Festtagen inbrünstig mit. Aber sie trifft nicht zu. Das heißt, kann sein, Gott ist tatsächlich so unwandelbar, aber ich bin es nicht. Ich verändere mich dauernd, nicht nur mein alternder Körper, sondern auch meine Lebenseinstellung, meine Träume, Wünsche, Sorgen, mein Glauben, meine Beziehung zu Gott.
Vielleicht kennen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, all das, was ich hier beschreibe. Dann sind Sie herzlich eingeladen, mich auf der Wanderung über den Friedhof meiner toten Glaubenssätze zu begleiten. Es ist ein Ort der Auferstehung! Auferstehung bedeutet: Alles wird verwandelt. Leben und Glauben sind möglich, hier und jetzt, weit über das hinaus, was wir üblicherweise als Leben und Glauben bezeichnen. Mitunter wird manche Wegstrecke unangenehm. Ich dämpfe meine Angst, denn ich vertraue: „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich“ (Psalm 23,4).
Existiert in Wirklichkeit, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann?
Den Zweifel integrieren statt eliminieren
Angenommen
da wäre kein Himmel, kein Gott ,
keine Ewigkeit ,
obwohl vom Menschen besungen, bedichtet ,
da wären nur die Erde, ein Du und die Zeit .
Angenommen, es wölbte sich um uns
das Nichts ,
die Gebete zielten ins Leere ,
wir gäben jemand die Ehre, der nicht existiert .
Eine Idee, immerhin, tröstliche Phantasie .
Angenommen also, was bliebe?
Na, Glaube, Hoffnung
und Liebe .
Glaube, dass Glück gelingen kann ,
wenn auch nur für Momente .
Hoffnung auf eine gerechte Welt, obwohl
die Erfahrung dagegen spricht .
Liebe schließlich, ich hab sie gespürt .
Es blieben dein Schoß, Gedichte und Wein ,
es blieben Blumen und Sonnenschein ,
es blieben freilich Krieg und Gewalt ,
Naturkatastrophen, Krankheit und Tod .
Die Übel nimmt nämlich jener nicht weg ,
der – angenommen – alles erschuf .
Er schweigt .
Wir müssen hier durch, mit oder ohne Segen
von oben. Tun wir so, als wäre da niemand .
Mühen wir uns, edel, hilfreich und gut .
Wenn doch, gibt’s am Ende
eine schöne Überraschung .
Was haltet ihr davon?
Dafür? Dagegen? Enthaltungen? Also:
Angenommen .
Manchmal … da überkommt mich dieses unangenehme Gefühl wie ein seelischer Schüttelfrost: „Mach dir nichts vor, Georg, du betuppst dich selbst: Da ist kein Gott! Nirgends!“
Immerhin, ich darf annehmen, der Zweifel hat den Glauben immer schon begleitet. Er kann nicht ein für allemal überwunden werden. Anselm von Canterbury, Mönch, Bischof und als Philosoph ein exzellenter Denker, wollte im 11. Jahrhundert, mitten im „dunklen Mittelalter“, Gott logisch beweisen. Er formulierte einen sogenannten Gottesbeweis. Dessen Spitzenaussage (hergeleitet aus wirklich beeindruckend tiefschürfenden Überlegungen) lautet: „Das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, existiert in Wirklichkeit.“
Anselms Ansinnen ist anerkennenswert, aber seine Methode ist unpassend. Er spricht vom „Glauben, der nach Einsicht sucht“. Anselms Formel, die in der Theologie bis heute Bestand hat, lautet: „Credo, ut intelligam“ – „Ich glaube, damit ich verstehe.“ Wir drehen das üblicherweise um, wir wollen verstehen, um glauben zu können. Aber daran hindert uns dann der Zweifel.
Zweifel ist ein natürlicher Impuls, eine kritische Reflexion, ob eine Sache plausibel ist, also mit unserem Wissen und unserer Erfahrung übereinstimmt. Im „weltlichen“ Bereich ist der Zweifel völlig normal: Ich habe eine Stunde Zeit eingeplant für die Strecke von Bonn nach Düsseldorf, aber ich bezweifle, dass sie reichen wird. Mir erzählt ein Kind, es habe ein Raumschiff am Himmel gesehen – aber war es nicht doch eher eine Wolke oder eine Luftspiegelung? Ein Gemeindeglied behauptet, spontan von einem Krebsleiden geheilt worden zu sein; war die Diagnose wirklich sicher? Beziehungsweise: Ist das Leiden tatsächlich überwunden? Ich bezweifle das. Man kann an der Treue des Ehepartners, an der Glaubwürdigkeit der Zeugin vor Gericht, an der Ehrlichkeit des Angestellten zweifeln. Wer an sich selbst zweifelt, nimmt bestimmte Defizite an seiner eigenen Person wahr; das kann an mangelndem Selbstbewusstsein liegen, jedoch auch der durchaus angemessene Versuch sein, sich selbst objektiv einzuschätzen.
In der Corona-Krise zweifelten auf einmal viele Leute das ganze System unserer Gesellschaftsordnung an. Ihnen schienen krude Verschwörungstheorien glaubwürdiger zu sein als die schlichte Erkenntnis, dass die Natur böse Überraschungen parat hält (wie eben ein Virus), was dann Regierungen zeitweilig überfordern kann. Und solche, die zuvor selbstverständlich von den Erkenntnissen der Medizin profitierten (sich den Blinddarm herausoperieren, einen Stent in die Adern einsetzen oder an das Dialysegerät legen ließen), die zweifelten nun an der gesamten Wissenschaft. Und das nur, weil auch die Wissenschaft nicht immer mit einer Stimme spricht, sondern den Streit der Deutungen kennt.
Unser Alltagszweifel soll uns vor Enttäuschung und falscher Einschätzung einer Lage bzw. Person bewahren. Wir wollen vertrauen können, wollen wissen, wo wir wirklich dran sind. Lässt sich der Zweifel nicht ausräumen, wirkt er verunsichernd.
Das gilt umso mehr für Glaubenszweifel. Muss ich glauben, dass Maria durch den Heiligen Geist schwanger wurde – und nicht durch Josef? (Mindert eine menschliche Vaterschaft die Bedeutung des Christus?) Ist es eine Sünde, daran zu zweifeln, dass Jesus übers Wasser ging, obwohl es so im Evangelium steht? Was Christinnen und Christen auch tun, es geht immer nur um das Reich Gottes – sind an dieser Behauptung Zweifel erlaubt?
Bereits um das Jahr 1200 berichtet der englische Priester Giraldus Cambrensis, viele Geistliche seiner Zeit glaubten selbst nicht, was sie dem Volk predigten. Der österreichische Historiker Peter Dinzelbacher hat bei Giraldus gelesen, was damals ein Amtsbruder seinen Kollegen spöttisch fragte, „ob dieser denn tatsächlich glaube, dass aus Brot und Wein Fleisch und Blut werde, der Schöpfer Mensch geworden sei, eine Frau ohne Geschlechtsverkehr empfangen habe und nach der Geburt auch noch Jungfrau geblieben sei“. Giraldus zitiert diesen anonymen Zweifler wörtlich: „Das ist doch alles Täuschung, was wir da tun. Unsere Vorfahren haben sich das ja schlau ausgedacht, um den Menschen Angst einzujagen und sie von vorwitzigen Anmaßungen zurückzuhalten.“ Giraldus stellt außerdem fest, „unter uns Geistlichen gäbe es viele, die im Geheimen ebenso dächten“.
Wohlgemerkt, das war vor 800 Jahren! Damals konnten sich allenfalls Kleriker solche Zweifel erlauben, nicht das gemeine Volk. Bei uns heute, mehr als 200 Jahre nach der Aufklärung, ist der Zweifel Allgemeingut geworden. Die ganze Religion steht unter dem Verdacht, Lüge und Betrug zu sein, mindestens eine Art Märchenwelt. Lieber tauchen einige Zeitgenossen in Fantasyuniversen ein, erfüllt von Zauberei und Magie, als dem überlieferten Glauben des Christentums zu vertrauen.
Читать дальше